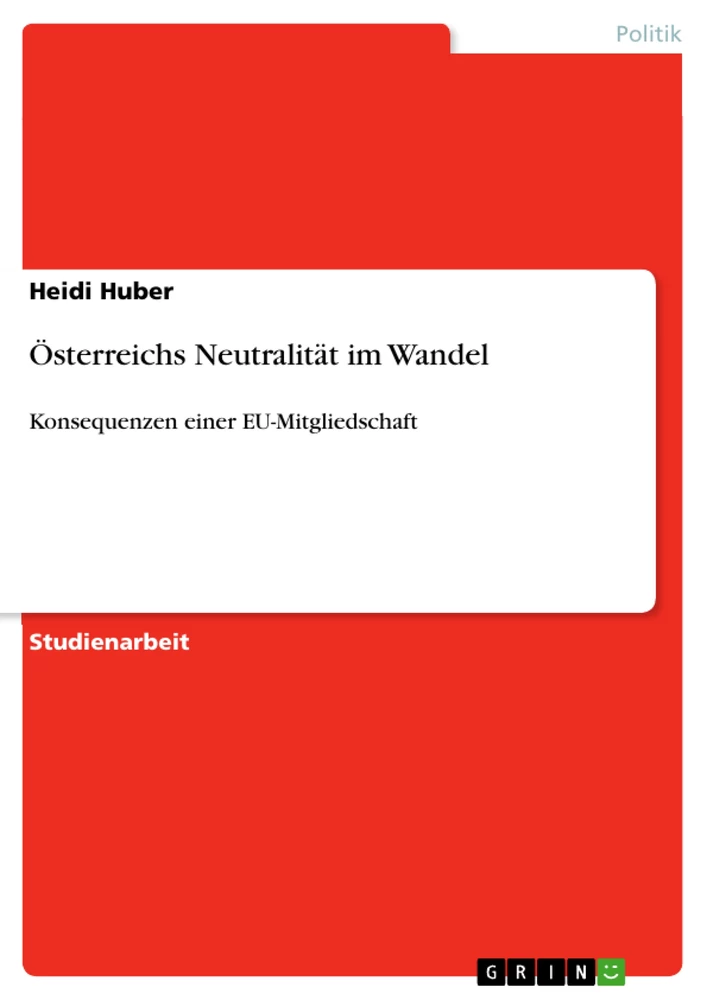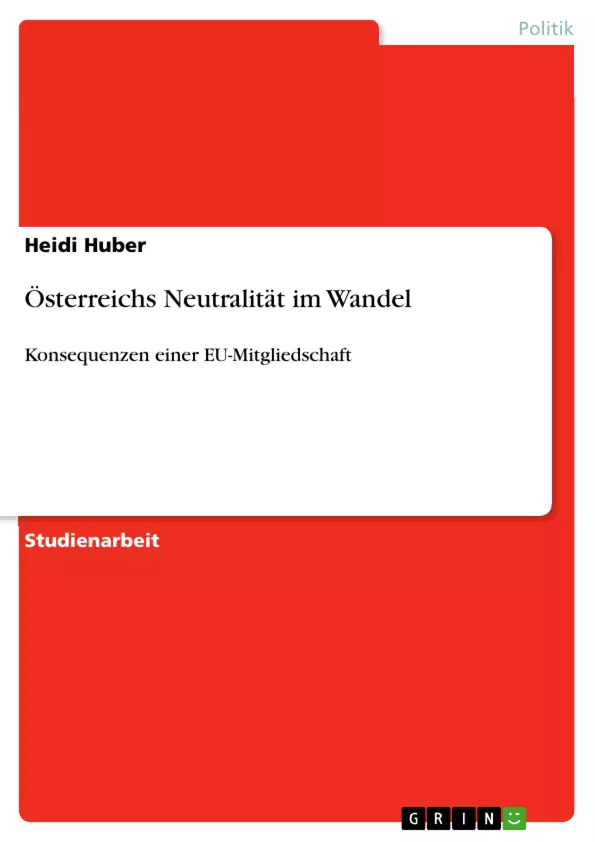„Niemand kann heiraten und trotzdem Junggeselle bleiben.“ (Theo Öhlinger) Seit Österreich sich 1955 aus freien Stücken für die immerwährende Neutralität entschieden hat, ist viel Zeit vergangen. Die Sowjetunion ist Geschichte und die Europäische Union präsent wie noch nie. 40 Jahre später hat man sich entschieden, der EU beizutreten und auch die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik als 2.Säule der Union mitzutragen. Doch Neutralität und Verteidigungsbündnis stehen im Widerspruch zueinander, einen contradictio in se, wie es Theo Öhlinger formuliert und dabei treffend auf einen Bräutigam verweist, der nach der Hochzeit gern Junggeselle wäre (vgl. Öhlinger 2000, 63). Dass sich auch die Positionen der Parlamentsparteien über die Jahrzehnte hinweg verändert haben, ist verständlich, dennoch traut sich kein Politiker, eine Neutralitätsdebatte zu entfachen. Schließlich prägen die Geschichte und die Entstehung der Neutralität gleichermaßen die 2.Republik und auch ihre Bürger. Dennoch, der Beitritt zur Europäischen Union und die Einbindung in die GASP haben die Funktion der Neutralität relativiert und so muss man sich die Frage stellen, was vom ursprünglichen Konzept übrig geblieben ist und welche Perspektiven heute noch realistisch sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Fragestellungen
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Neutralität als Konzept
- 2.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.1 Neutralität
- 2.1.2 Rechte und Pflichten
- 2.2 Vereinbarkeit zweier Gegensätze
- 3. Neutralität Österreichs
- 3.1 Vom Ursprung zur Identität: 1955 - 1990
- 3.1.1 Nolens volens zum Neutralitätsgesetz
- 3.1.2 Identität einer Nation?
- 3.2 Einbindung in internationale Organisationen
- 4. Der Beitritt zur Europäischen Union
- 4.1 Der Weg nach Brüssel
- 4.2 Die Beitrittsverhandlungen 1993/1994
- 4.3 Als „Neutraler\" zur EU?
- 4.3.1 Konsequenzen einer Mitgliedschaft
- 4.3.2 Neutralität „light“
- 5. Perspektiven österreichischer Neutralität
- 5.1 Positionen und Positionswandel der Parteien
- 5.2 Beibehaltung des Status Quo
- 5.3 Zur Zukunft einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der österreichischen Neutralität seit 1955, insbesondere im Kontext des EU-Beitritts und der damit verbundenen Einbindung in die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Ziel ist es, die Konsequenzen dieser Entwicklung für den Neutralitätsstatus Österreichs zu analysieren und zukünftige Perspektiven zu erörtern.
- Wandel der österreichischen Neutralität seit 1955
- Konsequenzen des EU-Beitritts für die österreichische Neutralität
- Vereinbarkeit von Neutralität und GASP
- Positionen der österreichischen Parteien zur Neutralität
- Zukünftige Perspektiven der österreichischen Neutralität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der österreichischen Neutralität ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Wandel der Neutralität seit dem Jahr 1955 in den Mittelpunkt. Die Arbeit untersucht die Konsequenzen des EU-Beitritts und die Vereinbarkeit von Neutralität und der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Drei zentrale Fragestellungen werden formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Zwei Hypothesen werden aufgestellt: Erstens, dass die österreichische Neutralität ihre Funktion mit dem EU-Beitritt verloren hat, und zweitens, dass keine österreichische Partei sich aufgrund der hohen Akzeptanz in der Bevölkerung gegen die Beibehaltung der Neutralität aussprechen wird. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert.
2. Neutralität als Konzept: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Neutralität. Es wird auf die historische Entwicklung des Begriffs eingegangen und die verschiedenen Aspekte der Neutralität im Völkerrecht definiert, wobei die Rechte und Pflichten eines neutralen Staates im Detail erläutert werden. Der Fokus liegt auf der Frage nach der Vereinbarkeit scheinbar gegensätzlicher Konzepte, wie beispielsweise der Neutralität mit einer Beteiligung an internationalen Organisationen.
3. Neutralität Österreichs: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte der österreichischen Neutralität von 1955 bis 1990. Es wird der Prozess der Entstehung des Neutralitätsgesetzes und die Entwicklung der österreichischen Identität im Kontext der Neutralität analysiert. Weiters wird die Rolle Österreichs in internationalen Organisationen behandelt und die Bedeutung der Neutralität für die Außenpolitik Österreichs im historischen Kontext beleuchtet.
4. Der Beitritt zur Europäischen Union: Dieses Kapitel widmet sich dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Es beschreibt den Prozess der Beitrittsverhandlungen, die Rolle des Neutralitätsstatus während dieser Verhandlungen und die Frage, wie ein neutraler Staat der EU beitreten kann. Die Konsequenzen des EU-Beitritts für die österreichische Neutralität werden detailliert analysiert, inklusive der Frage einer "Neutralität light".
5. Perspektiven österreichischer Neutralität: Dieses Kapitel befasst sich mit den Perspektiven der österreichischen Neutralität nach dem EU-Beitritt. Es analysiert die Positionen und den Positionswandel der verschiedenen österreichischen Parteien zum Thema Neutralität und erörtert die Frage nach der Beibehaltung des Status quo. Die Zukunft der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Kontext der österreichischen Neutralität wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Österreichische Neutralität, EU-Beitritt, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Völkerrecht, Neutralitätsgesetz, Positionswandel der Parteien, Identität, internationale Organisationen, Perspektiven, Vereinbarkeit von Neutralität und EU-Mitgliedschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wandel der österreichischen Neutralität seit 1955
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Wandel der österreichischen Neutralität seit 1955, insbesondere im Kontext des EU-Beitritts und der damit verbundenen Einbindung in die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Es werden die Konsequenzen dieser Entwicklung für den Neutralitätsstatus Österreichs untersucht und zukünftige Perspektiven erörtert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Wandel der österreichischen Neutralität seit 1955; Konsequenzen des EU-Beitritts für die österreichische Neutralität; Vereinbarkeit von Neutralität und GASP; Positionen der österreichischen Parteien zur Neutralität; Zukünftige Perspektiven der österreichischen Neutralität; Begriffsbestimmung der Neutralität im Völkerrecht, inklusive Rechte und Pflichten eines neutralen Staates; historische Entwicklung der österreichischen Neutralität (1955-1990); Prozess des EU-Beitritts und dessen Auswirkungen auf die Neutralität; Analyse einer möglichen „Neutralität light“.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit formuliert zentrale Fragen zum Wandel der österreichischen Neutralität seit 1955, zur Vereinbarkeit von Neutralität und EU-Mitgliedschaft (insbesondere im Hinblick auf die GASP) und zu den zukünftigen Perspektiven der österreichischen Neutralität. Die Arbeit prüft zwei Hypothesen: 1. Die österreichische Neutralität hat ihre Funktion mit dem EU-Beitritt verloren. 2. Keine österreichische Partei wird sich aufgrund der hohen Akzeptanz in der Bevölkerung gegen die Beibehaltung der Neutralität aussprechen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung (Einführung, Fragestellungen, Aufbau); 2. Neutralität als Konzept (Begriffsbestimmung, Rechte und Pflichten, Vereinbarkeit scheinbarer Gegensätze); 3. Neutralität Österreichs (1955-1990, Entwicklung des Neutralitätsgesetzes, Rolle in internationalen Organisationen); 4. Der Beitritt zur Europäischen Union (Beitrittsverhandlungen, Konsequenzen der Mitgliedschaft, „Neutralität light“); 5. Perspektiven österreichischer Neutralität (Positionen der Parteien, Beibehaltung des Status Quo, Zukunft der GASP).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Österreichische Neutralität, EU-Beitritt, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Völkerrecht, Neutralitätsgesetz, Positionswandel der Parteien, Identität, internationale Organisationen, Perspektiven, Vereinbarkeit von Neutralität und EU-Mitgliedschaft.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für jedes der fünf Kapitel, die die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die Argumentation und die wichtigsten Schlussfolgerungen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser bestimmt, die sich wissenschaftlich mit der österreichischen Neutralität, dem EU-Beitritt und der Europäischen Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Sie eignet sich besonders für akademische Zwecke, z.B. im Rahmen von Studienarbeiten.
- Citation du texte
- BA Bakk.Komm. Heidi Huber (Auteur), 2007, Österreichs Neutralität im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151106