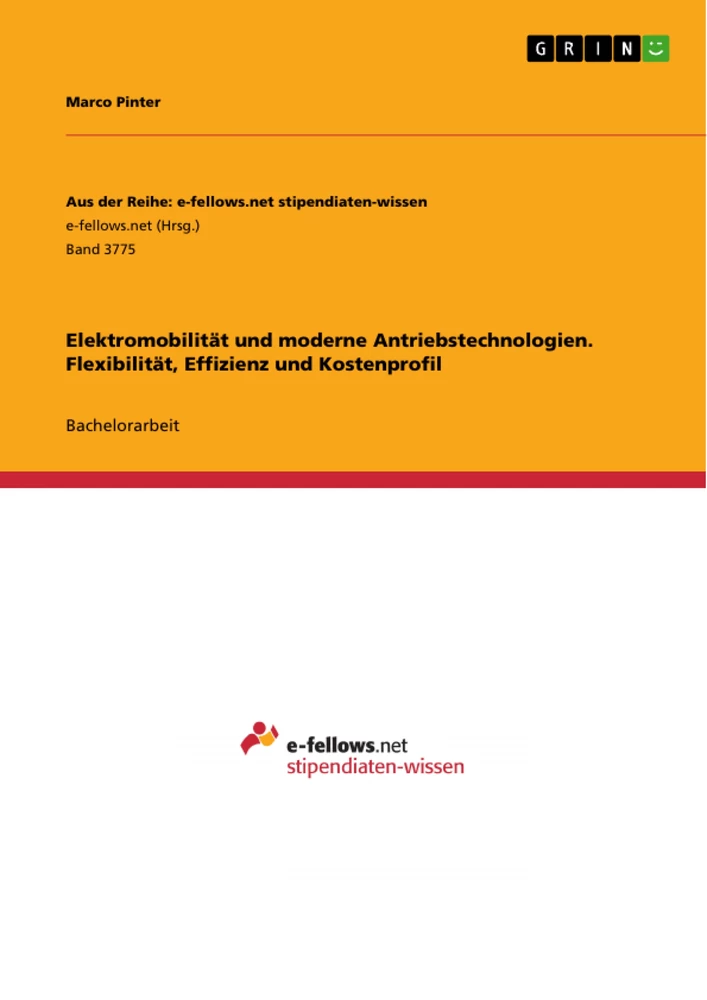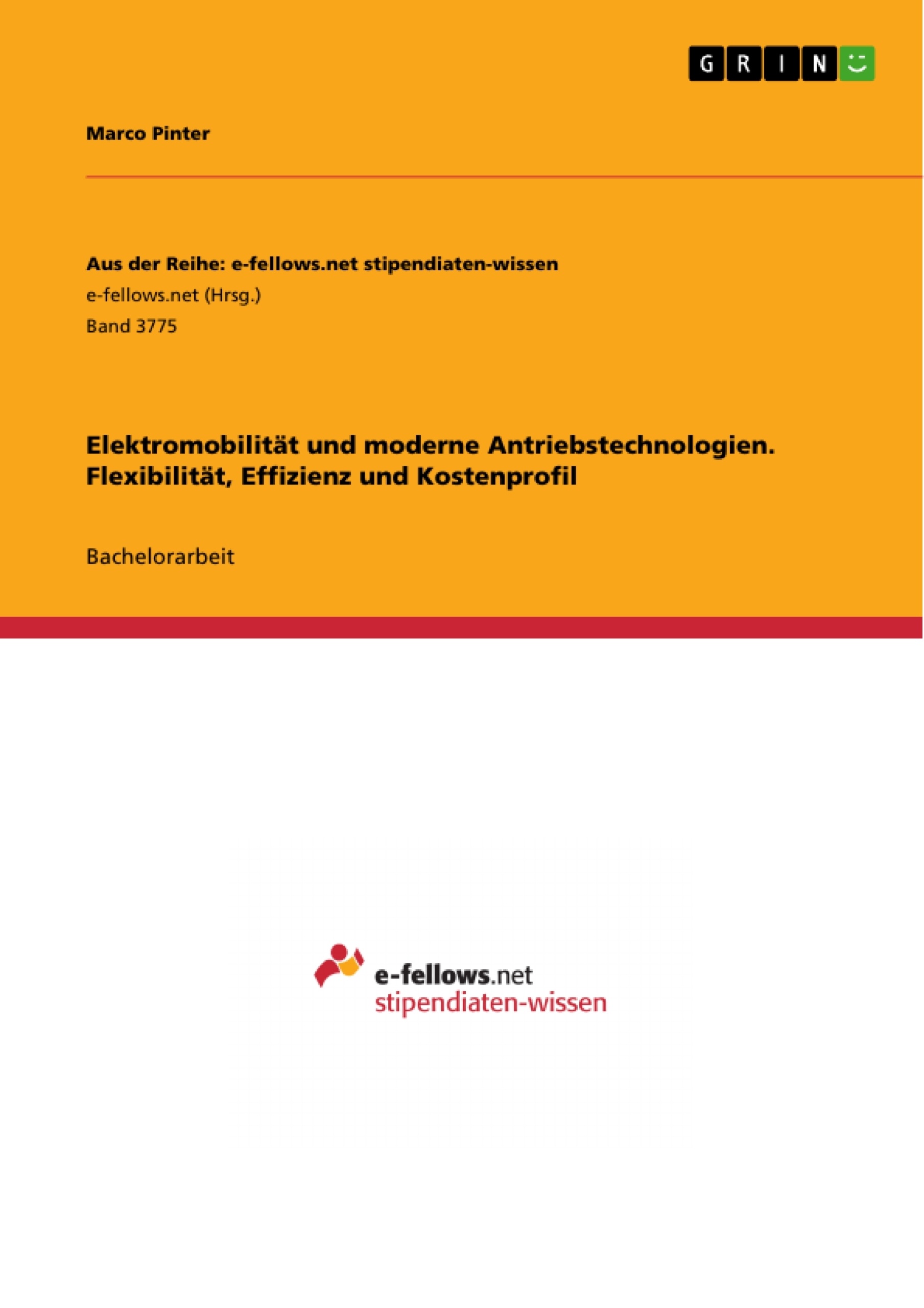Diese Bachelorarbeit versucht einen fundierten Ausblick für die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien der Elektromobilität und der damit einhergehenden energiewirtschaftlichen Auswirkungen zu ermöglichen. Folglich wird diese Entwicklung, unter Beachtung der Effizienz und dem damit verbundenen Flexibilitätspotential für das Energiesystem, dargestellt.
Die Energiewende in Deutschland geht mit einem erheblichen Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung einher. Gleichzeitig ist der Einsatz regenerativer Energien für eine umfassende Dekarbonisierung der Bedarfssektoren notwendig, neben einer verstärkten Anstrengung zur Reduktion und Flexibilisierung der Energieverbräuche.
Dies gilt besonders in den verbrauchsintensiven Teilsystemen Wärme und Mobilität, die aktuell stark abhängig von fossilen Energieträgern sind. Die Kopplung der Sektoren stellt hierbei eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration erneuerbaren Stroms (ES) und, der damit verbundenen, technisch und ökonomisch optimierten Energiewende dar. Die Dekarbonisierung ist jedoch, selbst bei sehr effizienter und flexibler Energieerzeugung und -nutzung, mit einem stark zunehmenden Strombedarf verbunden, der ebenfalls durch erneuerbare Energien (EE) gedeckt werden muss.
Besonders im Verkehrssektor dominiert der Einsatz fossiler Energieträger, weshalb innovative und klimaneutrale Anwendungen für den zunehmenden Einsatz von ES realisiert werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung zum Thema
- Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Die Kopplung des Strom- und Verkehrssektors
- Interaktion von Strom und Verkehr
- Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs
- Flexibilität und Effizienz
- Methodik
- Kriterien zur Auswahl der Studien
- Vorgehen der Metaanalyse
- Analyse
- Effizienz der Antriebstechnologien
- Energieverbrauch
- Reichweite und Batteriekapazität
- Wirkungsgrad
- Flexibilität der Elektromobilität
- Lastmanagement batterieelektrischer Fahrzeuge
- Strombasierte Kraftstoffe
- Marktausbreitung der Elektromobilität
- Kostenprofil der Antriebstechnologien
- Investitions- und Herstellungskosten
- Betriebskosten
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassung und Diskussion zentraler Erkenntnisse
- Limitationen und weiterer Forschungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die technologische Entwicklung alternativer Antriebstechnologien für den motorisierten Individualverkehr bis 2050 im Hinblick auf Effizienzsteigerung und Flexibilitätspotenzial für das Energiesystem. Dabei wird auch das Kostenprofil berücksichtigt. Die Analyse erfolgt mittels einer Metaanalyse, die den bundesdeutschen Sektor betrachtet.
- Effizienzsteigerung alternativer Antriebstechnologien
- Flexibilitätspotenzial der Elektromobilität für das Energiesystem
- Kostenentwicklung alternativer Antriebstechnologien
- Analyse des Energieverbrauchs im motorisierten Individualverkehr
- Bewertung des Lastmanagements von batterieelektrischen Fahrzeugen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Dekarbonisierung des motorisierten Individualverkehrs ein und begründet die Notwendigkeit der Untersuchung alternativer Antriebstechnologien. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und den Aufbau der folgenden Kapitel.
Die Kopplung des Strom- und Verkehrssektors: Dieses Kapitel beleuchtet die Interaktion zwischen Strom- und Verkehrssektor, fokussiert auf die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen bezüglich Flexibilität und Effizienz. Es stellt die grundlegende Beziehung zwischen der steigenden Elektromobilität und dem erhöhten Strombedarf heraus und diskutiert die Möglichkeiten, diese Herausforderungen durch verbesserte Effizienz und Flexibilität zu meistern.
Methodik: Das Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten Metaanalyse. Es erläutert die Kriterien für die Auswahl der Studien und das Vorgehen bei der Datenanalyse, um die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Die ausgewählten Kriterien definieren den Umfang und die Reichweite der Untersuchung und sichern die methodische Stringenz der Arbeit.
Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Metaanalyse, gegliedert in die Effizienz der Antriebstechnologien (Energieverbrauch, Reichweite, Wirkungsgrad), die Flexibilität der Elektromobilität (Lastmanagement, strombasierte Kraftstoffe, Marktausbreitung) und das Kostenprofil der Antriebstechnologien (Investitions- und Betriebskosten). Die detaillierte Analyse der einzelnen Aspekte liefert einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Technologie und deren zukünftige Entwicklung.
Schlüsselwörter
Elektromobilität, Metaanalyse, Effizienz, Flexibilität, Energiesystem, motorisierter Individualverkehr, Antriebstechnologien, Kosten, Lastmanagement, Dekarbonisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Metaanalyse: Alternativen Antriebstechnologien für den motorisierten Individualverkehr bis 2050
Was ist der Gegenstand dieser Metaanalyse?
Die Metaanalyse untersucht die technologische Entwicklung alternativer Antriebstechnologien für den motorisierten Individualverkehr bis 2050. Der Fokus liegt auf Effizienzsteigerung, Flexibilitätspotenzial für das Energiesystem und den Kosten dieser Technologien. Die Analyse beschränkt sich auf den bundesdeutschen Sektor.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Effizienzsteigerung und das Flexibilitätspotenzial alternativer Antriebstechnologien, sowie deren Kostenentwicklung. Sie analysiert den Energieverbrauch im motorisierten Individualverkehr und bewertet das Lastmanagement batterieelektrischer Fahrzeuge.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Effizienzsteigerung alternativer Antriebstechnologien, das Flexibilitätspotenzial der Elektromobilität für das Energiesystem, die Kostenentwicklung, der Energieverbrauch im motorisierten Individualverkehr und das Lastmanagement von batterieelektrischen Fahrzeugen.
Welche Methodik wurde angewendet?
Es wurde eine Metaanalyse durchgeführt. Das Kapitel "Methodik" beschreibt detailliert die Kriterien zur Auswahl der Studien und das Vorgehen bei der Datenanalyse, um Transparenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche Aspekte der Effizienz werden analysiert?
Die Analyse der Effizienz umfasst den Energieverbrauch, die Reichweite und Batteriekapazität sowie den Wirkungsgrad verschiedener Antriebstechnologien.
Welche Aspekte der Flexibilität werden betrachtet?
Die Analyse der Flexibilität beinhaltet das Lastmanagement batterieelektrischer Fahrzeuge, strombasierte Kraftstoffe und die Marktausbreitung der Elektromobilität.
Wie wird das Kostenprofil der Antriebstechnologien untersucht?
Das Kostenprofil wird anhand von Investitions- und Herstellungskosten sowie Betriebskosten analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Kopplung des Strom- und Verkehrssektors, ein Kapitel zur Methodik, ein Kapitel zur Analyse und eine Schlussbetrachtung mit Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick auf zukünftigen Forschungsbedarf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Elektromobilität, Metaanalyse, Effizienz, Flexibilität, Energiesystem, motorisierter Individualverkehr, Antriebstechnologien, Kosten, Lastmanagement und Dekarbonisierung.
Wie wird die Kopplung von Strom- und Verkehrssektor dargestellt?
Das Kapitel "Kopplung des Strom- und Verkehrssektors" beleuchtet die Interaktion zwischen beiden Sektoren, insbesondere die Elektrifizierung des Individualverkehrs und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen hinsichtlich Flexibilität und Effizienz.
Welche Limitationen werden in der Schlussbetrachtung angesprochen?
Die Schlussbetrachtung beinhaltet eine Diskussion der Limitationen der Studie und benennt weiteren Forschungsbedarf.
- Quote paper
- Marco Pinter (Author), 2018, Elektromobilität und moderne Antriebstechnologien. Flexibilität, Effizienz und Kostenprofil, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995412