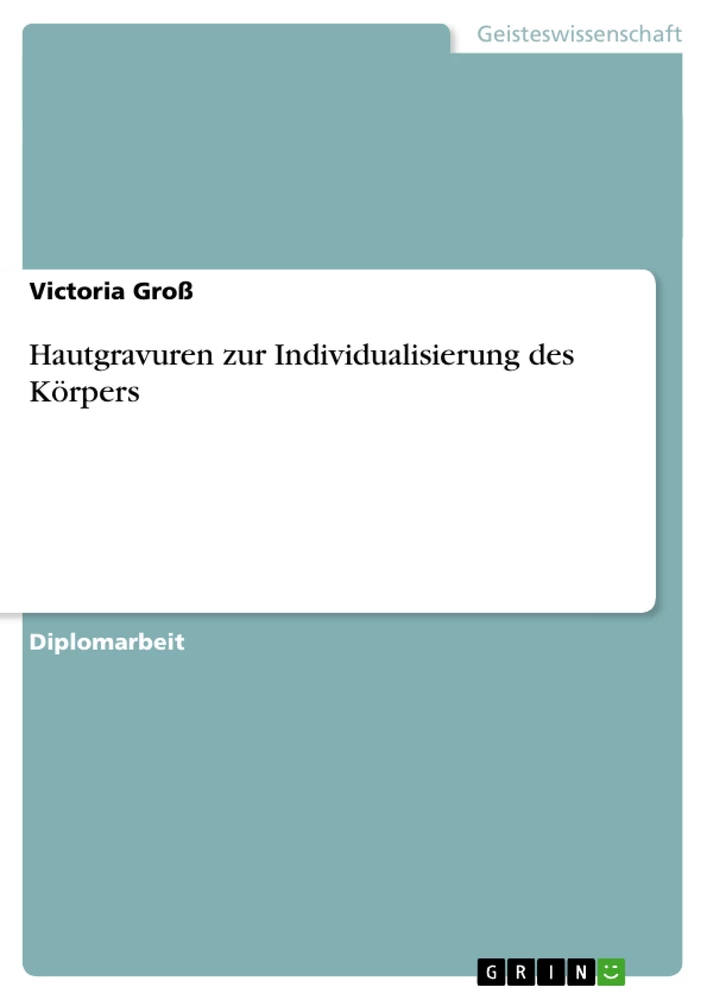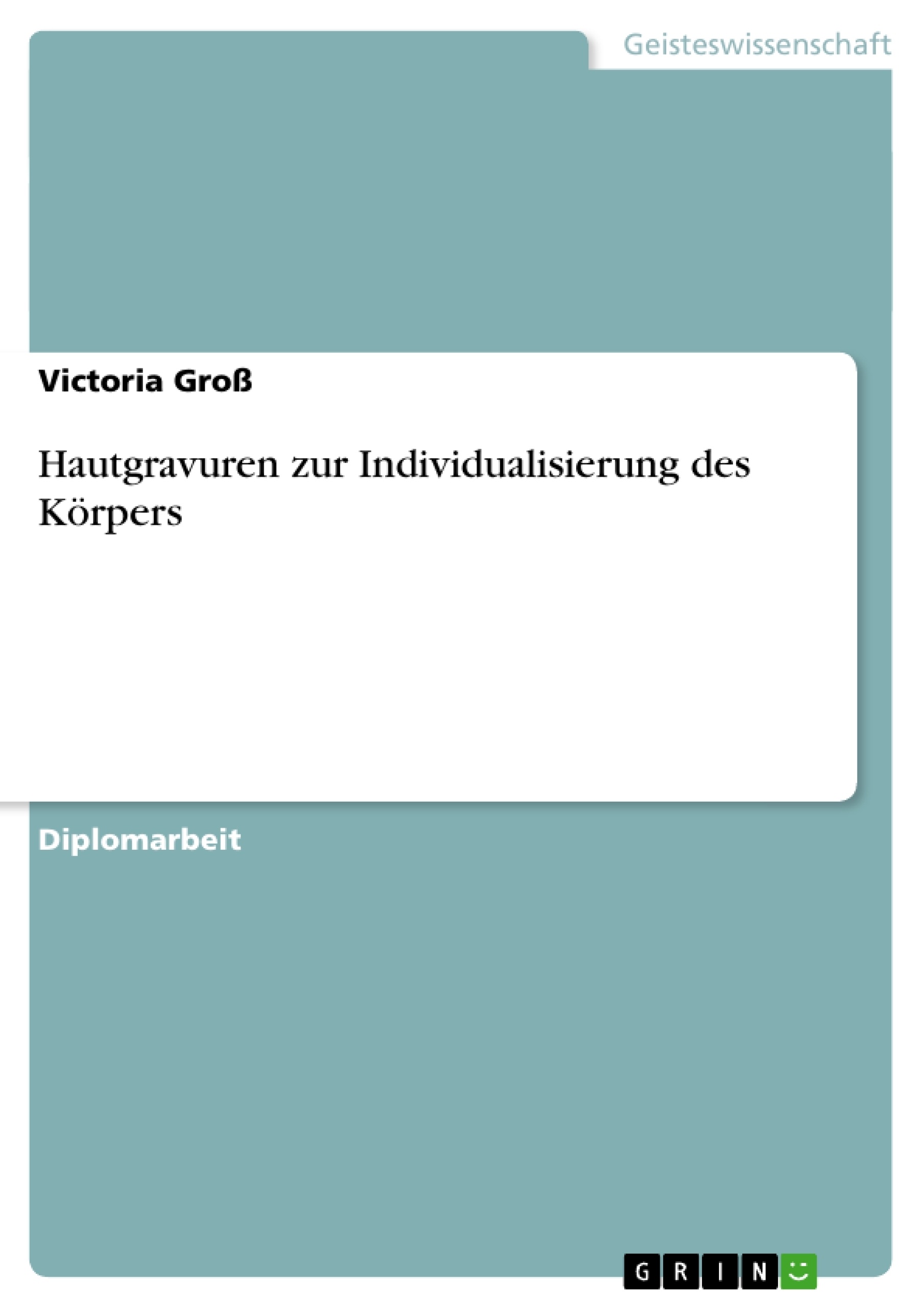Eine Tätowierung ist ein mit Farbpigmenten in die Haut gearbeitetes Bild oder Text. „Tätowierung“ - so lautet die Definition des Lexikons der Psychologie (5 Bände, 2000 - 2003) - (ist) die „Gestaltung des Körpers durch Symbole und Ornamente (...). In westlichen Kulturkreisen ist seit Mitte der 80er Jahre eine Zunahme an Tätowierungen zu beobachten, die sich in den 90er Jahren nochmals verstärkt hat: Tätowierungen als Modeerscheinung und/oder Ausdruck eines bestimmten Lebensstils.“
Die Etymologie des Wortes „Tätowierung“ oder „Tattoo“ wird auf das tahitianische Wort „Tatau“ zurückgeführt. Dieses bedeute etwa „Wunden schlagen“ und erinnere an die Geräusche, die während des Tätowierens durch die Schläge auf den Tätowierkamm, dessen Zacken die Farbe unter die Haut brächten, verursacht würden, so Oettermann (1995, 121). Er führt weiter aus, dass sich das Wort „Tatau“ gerade im Englischen durchsetzen konnte, da es in England seit 1644 die gleichlautende Vokabel „Tattoo“ mit ähnlicher Bedeutung gegeben habe. „Tattoo“ finde seinen englischen Ursprung in dem Satz „Doe den taptoe“ und bedeute, was das Schlagen eines bestimmten militärischen Trommelwirbels beschreibe (Oettermann, 1995, 121).
Medizinisch ähneln Tätowierungen leichten Schürfwunden, wobei die Intensität des Schmerzes und der Heilungsprozess mit denen eines Sonnenbrands verglichen werden. Bei großflächigen Tattoos ist es deshalb von Nöten, eine Abheilung der Hautpartien abzuwarten, ehe die Arbeit fertig gestellt werden kann. Die Tätowierung wird mit dem Zeichnen der Umrisse begonnen, um dann später mögliche Farben und Schattierungen aufzufüllen. Das Ergebnis dieser Prozedur macht die nun tätowierte Person zu der Gruppe der Tätowierten zugehörig.
Die Verbreitung von Tätowierungen hat in den letzten 20 Jahren stark zugenommen, und immer mehr Menschen verändern ihr Aussehen durch Tätowierungen dauerhaft, was diese Thematik für die psychologische und soziologische Forschung interessant macht. Allein in Berlin gibt es, laut
Internetauskunft der Gelben Seiten vom 31. August 2005, 42 Tätowierstudios.
Die genaue Zahl tätowierter Menschen in Deutschland ist nicht bekannt, doch meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (2003, Nr. 178/320 D), die Zahl der Tattoo-Träger in Deutschland habe sich seit Mitte der neunziger Jahre verdoppelt. Diese Schätzung stimmt zumindest in der berichteten Tendenz mit den Angaben des Lexikons der Psychologie überein. Etwa 4,2 Millionen Deutsche seien im Jahr 2003 tätowiert gewesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tätowierung - Eine soziologische und sozialpsychologische Einordnung
- Die Funktionen der Haut
- Das Prozedere der Tätowierung
- Tätowierung als „Impression Management“ und Kommunikationsmittel – eine sozialpsychologisch-soziologische Sicht
- Tätowierungen als Gegenstand der Literatur
- Tätowierung als Untersuchungsgegenstand in der bisherigen Forschung
- Lynne Caroll, Roxanne Andersen und Aldis Putnins (2002)
- Douglas Degelman und Nicole Deann Price (2002)
- Andrés Martin (1997)
- Aglaja Stirn (2004)
- Gordon B. Forbes (2001)
- Katherine Irwin (2001)
- Entwicklung der Fragestellung
- Erläuterung der Interviewfragen
- Der,,Interviewrahmen”
- Tabellarische Übersicht der Interviewfragen
- Untersuchungsmethodik
- Interviewteilnehmer
- Der Interviewablauf
- Der Untersuchungsplan
- Auswertung der narrativen Interviews
- Persönliche Anmerkungen und Gedächtnisprotokolle zu den Interviews
- Der erste Auswertungsschritt: Die Inhaltskategorien der Antworten
- Identität als überragendes Thema
- Vorbilder und Identifikation
- Die Tätowierung als Ankerfunktion an einen bestimmten ideologischen Ort
- Die Ablösung von den Eltern - die Mama Kategorie
- Schutz vor anderen - auch als Botschaft an andere und vor dem Altern
- Empfundener Schmerz während der Tätowierung
- Das Tätowiertwerden hat etwas Symbolisches, das es zu einem ,,Ritual“ macht
- Der Aspekt der Gruppenzugehörigkeit
- Persönliche Atmosphäre
- Emotionale Nähe zur Tätowierung
- Zusammenfassung
- Die Experten Kategorie Auftrag
- Der zweite Auswertungsschritt: Die fragezentrierte Analyse der Antworten
- Angaben zur ersten Tätowierung
- Die Eigenständigkeit der Entscheidung sich tätowieren zu lassen und die Reaktion der näheren Umwelt
- Zusammenfassung
- Die positive Veränderung des Selbstbildes durch die Tätowierung
- Zusammenfassung
- Die Wirkung der Tätowierung auf die eigene Körperlichkeit
- Zusammenfassung
- Ergebnisse der Expertenfragen
- Zusammenfassung
- Vergleich der Ergebnisse der inhaltsanalytischen Auswertungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Tätowierung als Ausdruck der Individualisierung des Körpers. Ziel der Arbeit ist es, die Beweggründe, die Bedeutung und die Auswirkungen von Tätowierungen auf die Identität und das Selbstbild der Träger zu untersuchen. Die Arbeit basiert auf narrativen Interviews mit tätowierten Personen.
- Bedeutung und Funktion von Tätowierungen für die individuelle Identität
- Soziale und psychologische Auswirkungen von Tätowierungen
- Zusammenhang zwischen Tätowierung, Körperlichkeit und Selbstbild
- Tätowierung als Ausdruck von Rebellion und Zugehörigkeit
- Die Rolle von Tätowierungen in der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer umfassenden Einleitung, die das Thema Tätowierung einführt und die Relevanz der Thematik für die Soziologie und Sozialpsychologie erläutert. In Kapitel 2 werden die Funktionen der Haut, das Prozedere der Tätowierung sowie die sozialpsychologische und soziologische Sicht auf Tätowierung als Ausdruck von „Impression Management“ und Kommunikationsmittel beleuchtet. Kapitel 3 bietet einen Überblick über bisherige Forschungsergebnisse zum Thema Tätowierung, wobei die Arbeiten verschiedener Autoren vorgestellt und analysiert werden. In Kapitel 4 werden die Fragestellungen und die Interviewfragen der vorliegenden Arbeit erläutert, während Kapitel 5 die Methodik und die Durchführung der narrativen Interviews detailliert beschreibt. Kapitel 6 widmet sich der Auswertung der narrativen Interviews und präsentiert die Ergebnisse der inhaltsanalytischen Auswertung, wobei verschiedene Kategorien und Themen identifiziert werden. Kapitel 7 vergleicht die Ergebnisse der unterschiedlichen Auswertungsansätze.
Schlüsselwörter
Tätowierung, Körpermodifikation, Individualisierung, Identität, Selbstbild, Narratives Interview, Inhaltsanalyse, Sozialpsychologie, Soziologie, Gruppenzugehörigkeit, Rebellion, ästhetische Bedürfnisse, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was motiviert Menschen dazu, sich tätowieren zu lassen?
Zentrale Motive sind die Individualisierung des Körpers, die Stärkung der Identität, die Abgrenzung von den Eltern sowie die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen.
Hat sich die Anzahl der Tätowierten in Deutschland verändert?
Ja, die Zahl der Tattoo-Träger hat sich seit Mitte der 90er Jahre massiv erhöht; im Jahr 2003 waren schätzungsweise 4,2 Millionen Deutsche tätowiert.
Was bedeutet "Impression Management" bei Tattoos?
Tätowierungen dienen als Kommunikationsmittel, um ein bestimmtes Bild von sich selbst nach außen zu tragen und den Lebensstil zu unterstreichen.
Wie beeinflusst eine Tätowierung das Selbstbild?
Die Untersuchung zeigt, dass viele Träger eine positive Veränderung ihres Selbstbildes und ein gesteigertes Bewusstsein für ihre eigene Körperlichkeit empfinden.
Welche Rolle spielt Schmerz beim Tätowieren?
Der empfundene Schmerz wird oft als Teil eines "Rituals" wahrgenommen, das der Tätowierung eine tiefere symbolische Bedeutung verleiht.
- Quote paper
- Victoria Groß (Author), 2006, Hautgravuren zur Individualisierung des Körpers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65197