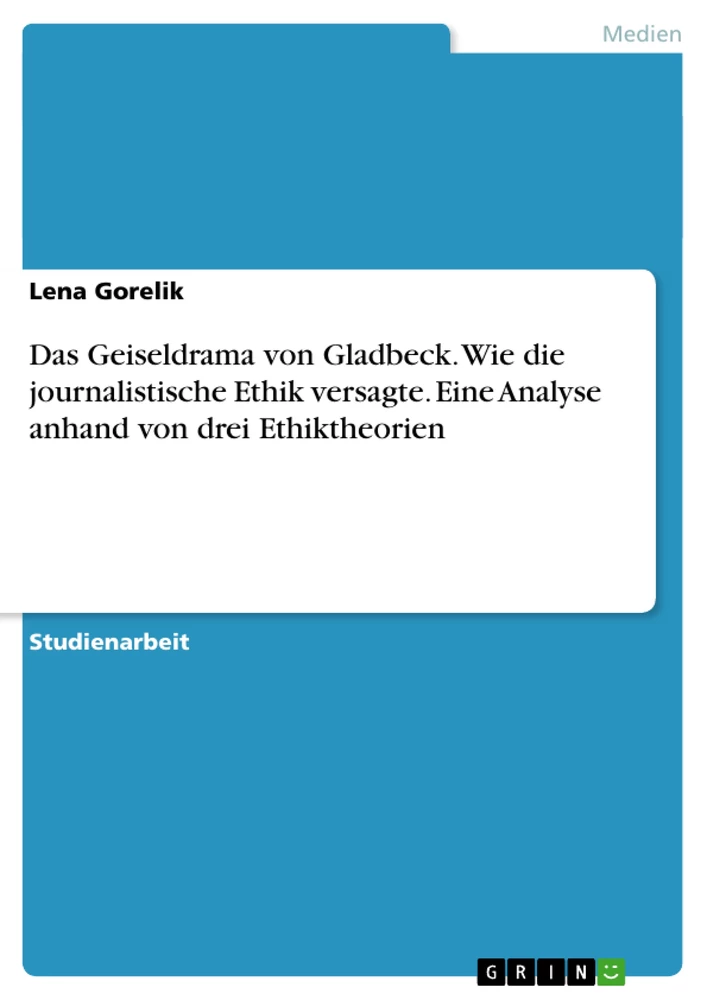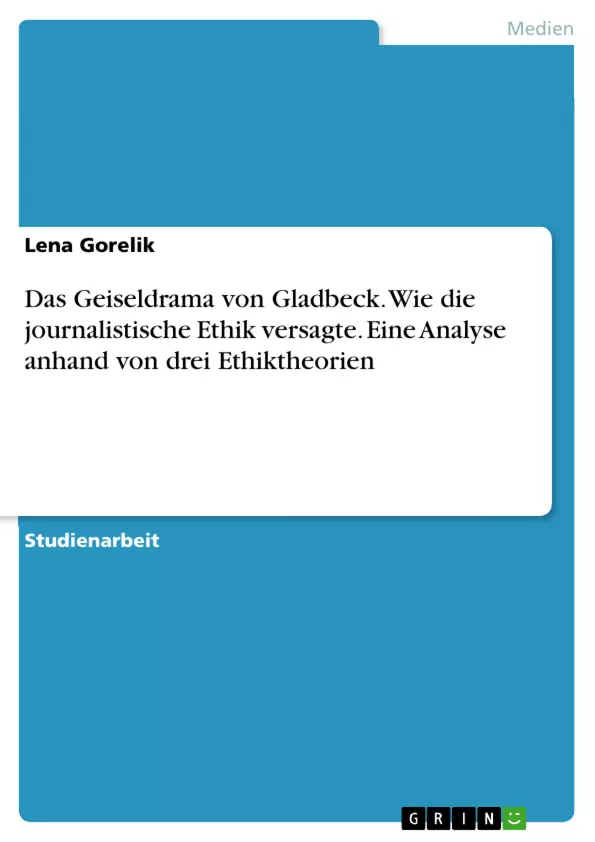"Das Geiseldrama von Gladbeck" ist zu einem wichtigen Begriff in der Kommunikationsgeschichte geworden. Als Journalist erinnert man sich etwas beschämt, vor allem aber immer fragend und ungläubig daran. Drei Tage lang sorgten zwei Verbrecher für Schlagzeilen in Deutschland: sie überfielen eine Bank, nahmen Menschen als Geiseln und töteten sogar einige von ihnen, bis sie endlich von der Polizei fest genommen wurden. Die deutsche Bevölkerung wusste bestens über die Verfolgungsjagd und die Vorgänge Bescheid - die Journalisten sorgten durch aktuelle Bilder und Interviews Tag und Nacht dafür, dass die Zuschauer und Zeitungsleser über alle Einzelheiten informiert waren. Einige von ihnen nahmen diese Berichterstattungspflicht zu genau.
Drei Tage lang schienen manche Journalisten das Denken und Hinterfragen ausgeschaltet zu haben. Es ging nur noch um Bilder und O-Töne, um Aktualität und Sensation. Und so wurde Opfern die Würde genommen, Geiselnehmer entwickelten sich zu begehrten Gesprächspartnern, und der Polizei war es unmöglich, ihre Arbeit zu machen, weil Reporter überall im Weg waren. Mit anderen Worten, Journalisten haben die Berufsethik komplett ignoriert.
Im Rahmen dieser Arbeit werde ich versuchen, die Ereignisse und Fehlhandlungen von Gladbeck zu analysieren. Ich werde, nach einer Definition der Begriffe "Ethik" und "Moral" im Journalismus, drei gängige Ethiktheorien der Kommunikationswissenschaften vorstellen und anschließend versuchen, mithilfe dieser die Gründe für die Eskalation in Gladbeck zu untersuchen. Im Anschluss werde ich aufzeigen, welche Lehren aus den Fehlern von 1988 gezogen wurden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ablauf der Geiselnahme von Gladbeck
- Drei Ansätze der Medienethik
- Wichtige Definitionen im Zusammenhang mit der Medienethik
- Die Individualethik
- Die Mediensystem-Ethik
- Die Publikumsethik
- Versagen der Ethik in Gladbeck
- Fehler in der Arbeit der einzelnen Journalisten
- Journalisten behindern die Polizei
- Missverständnis der Aktualitätspflicht
- Der Journalist als Akteur
- Journalisten als Handlanger der Geiselnehmer
- Mediensystematische Gründe für die Eskalation
- Ökonomisierung des Mediensystems
- Technische Entwicklung
- Das journalistische Berufsverständnis und die Rolle der Redaktionen
- Besondere Umstände in Gladbeck
- Das gierige Publikum
- Fehler in der Arbeit der einzelnen Journalisten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Geiseldrama von Gladbeck und untersucht das Versagen journalistischer Ethik während der Ereignisse. Die Analyse stützt sich auf drei gängige Ethiktheorien der Kommunikationswissenschaften, um die Gründe für die Eskalation zu ergründen und die Rolle der Medien zu beleuchten.
- Analyse des Ablaufs des Geiseldramas von Gladbeck
- Anwendung von drei Ethiktheorien (Individualethik, Mediensystem-Ethik, Publikumsethik) auf das Geschehen
- Identifizierung von Fehlern im Handeln einzelner Journalisten
- Untersuchung mediensystematischer Gründe für die Eskalation
- Bewertung der Rolle des Publikums
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt das Geiseldrama von Gladbeck als wichtigen Bezugspunkt in der Kommunikationsgeschichte. Sie hebt das problematische Verhalten einiger Journalisten hervor, die die Aktualitätspflicht über die ethischen Grundsätze stellten. Die Arbeit kündigt die Analyse der Ereignisse und Fehlhandlungen an, wobei drei gängige Ethiktheorien der Kommunikationswissenschaften angewendet werden, um die Gründe für die Eskalation zu untersuchen und Lehren aus den Fehlern von 1988 aufzuzeigen.
Der Ablauf der Geiselnahme von Gladbeck: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Ablauf des Geiseldramas von Gladbeck vom 16. August 1988. Es schildert die Überfälle, die Geiselnahmen, die Forderungen der Täter, und die Verfolgungsjagd über mehrere Tage hinweg. Der Fokus liegt auf den Ereignissen, den Reaktionen der Polizei und der zunehmenden Beteiligung der Medien an der Eskalation der Situation, einschließlich der Bereitstellung von Fluchtwagen und der Interviews mit den Tätern.
Drei Ansätze der Medienethik: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe der Medienethik wie „Ethik“ und „Moral“ im Journalismus und stellt drei relevante Ethiktheorien vor: die Individualethik, die Mediensystem-Ethik und die Publikumsethik. Es legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse des Geiseldramas und liefert ein Rahmenwerk, um das Handeln der beteiligten Journalisten zu bewerten.
Versagen der Ethik in Gladbeck: Dieses Kapitel analysiert das Versagen der journalistischen Ethik während des Geiseldramas. Es untersucht Fehler im Handeln einzelner Journalisten, wie das Behindern der Polizei und das Missverständnis der Aktualitätspflicht. Weiterhin werden mediensystematische Gründe für die Eskalation beleuchtet, z.B. die Ökonomisierung des Mediensystems, technische Entwicklungen und das journalistische Berufsverständnis. Die Rolle des Publikums und seine Gier nach Sensation werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Geiseldrama von Gladbeck, Journalistische Ethik, Medienethik, Individualethik, Mediensystem-Ethik, Publikumsethik, Aktualitätspflicht, Medienberichterstattung, Eskalation, Sensationsgier, Polizei, Geiselnehmer, Opfer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Geiseldrama von Gladbeck und dem Versagen journalistischer Ethik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Geiseldrama von Gladbeck (16. August 1988) und untersucht das Versagen journalistischer Ethik während der Ereignisse. Sie beleuchtet die Rolle der Medien bei der Eskalation der Situation und bewertet das Handeln der beteiligten Journalisten vor dem Hintergrund dreier gängiger Ethiktheorien der Kommunikationswissenschaften.
Welche drei Ethiktheorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Individualethik, die Mediensystem-Ethik und die Publikumsethik, um das Geschehen zu analysieren und die Gründe für die Eskalation zu ergründen.
Welche Aspekte des Geiseldramas werden untersucht?
Die Analyse umfasst den detaillierten Ablauf des Geiseldramas, das Fehlverhalten einzelner Journalisten (z.B. Behinderung der Polizei, Missverständnis der Aktualitätspflicht, aktive Beteiligung an der Eskalation), mediensystematische Faktoren (Ökonomisierung, technische Entwicklungen, journalistisches Berufsverständnis), und die Rolle des Publikums und seiner Sensationsgier.
Welche Fehler im Handeln einzelner Journalisten werden identifiziert?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Fehler, darunter das Behindern der Polizei durch Journalisten, ein Missverständnis der Aktualitätspflicht, die aktive Rolle der Journalisten als Akteure im Geschehen, und sogar Fälle, in denen Journalisten als Handlanger der Geiselnehmer agierten.
Welche mediensystematischen Gründe für die Eskalation werden genannt?
Die Analyse benennt die Ökonomisierung des Mediensystems, die technischen Entwicklungen (die eine schnelle und umfassende Berichterstattung ermöglichten), das journalistische Berufsverständnis und die Rolle der Redaktionen sowie besondere Umstände in Gladbeck als wichtige Faktoren für die Eskalation.
Welche Rolle spielt das Publikum?
Die Arbeit kritisiert die "Sensationsgier" des Publikums als einen Faktor, der zur Eskalation beitrug und die Medien in ihrem Handeln beeinflusste.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Ablauf des Geiseldramas, ein Kapitel zu den drei Ansätzen der Medienethik, und ein Kapitel zum Versagen der Ethik in Gladbeck. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, Angaben zur Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den Fehlern von 1988 und zeigt auf, wie die Anwendung der drei Ethiktheorien helfen kann, zukünftige ähnliche Situationen besser zu bewältigen und ethisch verantwortungsvoller zu handeln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geiseldrama von Gladbeck, Journalistische Ethik, Medienethik, Individualethik, Mediensystem-Ethik, Publikumsethik, Aktualitätspflicht, Medienberichterstattung, Eskalation, Sensationsgier, Polizei, Geiselnehmer, Opfer.
- Citar trabajo
- Lena Gorelik (Autor), 2002, Das Geiseldrama von Gladbeck. Wie die journalistische Ethik versagte. Eine Analyse anhand von drei Ethiktheorien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6474