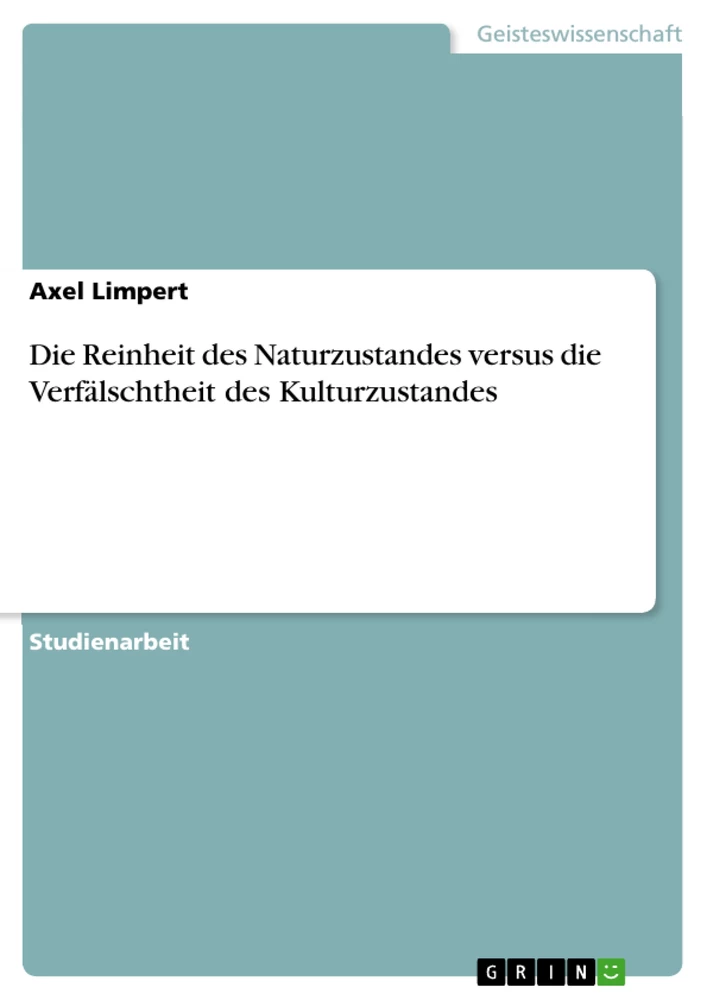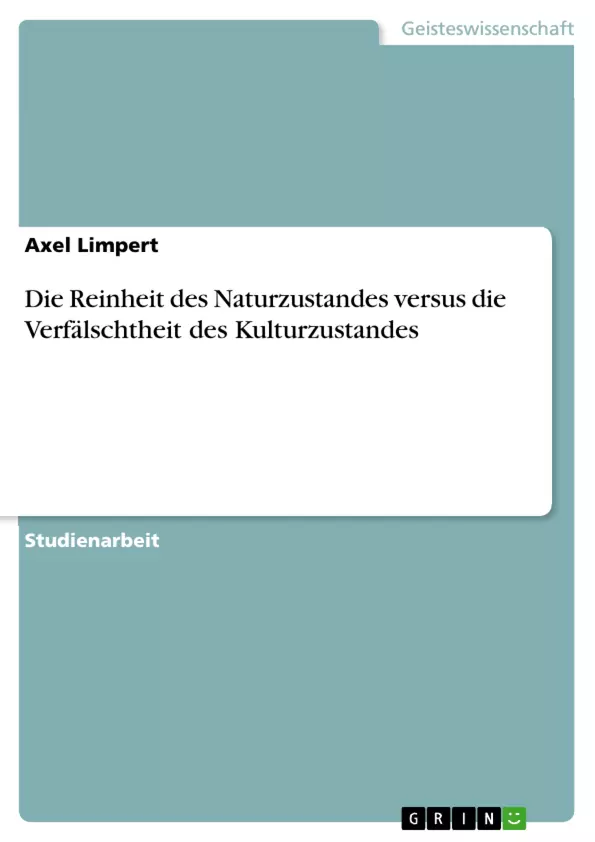Die Gestalt des „edlen Wilden“ fungiert Erdheim zur Folge als eine leitende Idee, „mit deren Hilfe die Vielfalt der Informationen über die eigene und die fremden Kulturen in je verschiedene strukturierte Zusammenhänge gebracht werden können“ und insofern immer in enger Wechselbeziehung zur Selbstreflexion steht: Einerseits können anhand dieser Idee die eigenen Werte und Normen in Frage gestellt werden und andererseits ist sie Grund, die diese Infragestellung erst möglich macht.
Diese Grundannahmen können als „roter Faden“ jener Autoren gelten, mit denen sich diese Arbeit auseinander zu setzten hat, denn diese reflektieren den als verfälscht angesehen Zustand der eigenen Kultur anhand der angeblich sorgenfreien Lebensweise der indianischen Völker. In seinem um 1580 entstandenen Essay „Von den Cannibalen“ versucht Michel de Montaigne, durch die Idealisierung der indianischen Lebensweise die eigene kulturelle Position in Frage zu stellen. Montaigne vertritt im Wesentlichen die These, dass die kindliche Unschuld der Eingeborenen den Keim einer unverdorbenen Vitalität in sich birgt und das sich die Europäer von den Ursprüngen reinen Menschentums entfernen. Anders als Montaigne, der nie die „neue Welt“ betreten hat, kann die umfangreiche Aufzeichnung „Neueste Reisen nach dem mitternächtlichen Amerika“ des Barons Louis- Armand de Lahontan aus dem Jahr 1705 als weitgehend authentisches Zeitzeugnis gelten, denn der Autor selbst hat mehrere Jahre mit kanadischen Einheimischen Kontakt gehabt. Lahontan nutzt diese Erfahrungen, um die eigene Gesellschaft umso heftiger zu kritisieren. In seinen fiktiven Dialog „Gespräche mit einem Wilden“ schlüpft Lahontan in die Rolle eines Verteidigers der europäischen Kultur, während sein Gegenspieler, der Hurone Adario die europäische Zivilisation als unbegreifliche Verirrung empfindet.
Die Konfrontation zwischen dem Eingeborenen und dem Zivilisierten findet seinen Höhepunkt in Jean- Jacques Rousseaus „Diskurs über die Ungleichheit“ aus dem Jahr 1754. Was dieses Buch so interessant macht ist die Vorstellung Rousseaus eines selbst unter Indianern längst verlorenen Naturzustandes, welcher sich dadurch auszeichnet, dass die Menschen ohne die Kenntnis von Gut und Böse eine sorglose Existenz führen. Erst mit dem Eintritt des Menschen in die Gesellschaft gewinnt das Problem der sozialen Ungleichheit an Schärfe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- 1. Kleine Kulturgeschichte des „edlen Wilden“
- 2. Die Exotisierung des „edlen Wilden“ bei Montaigne
- 3. Die Ethnographie und Zivilisationskritik des Barons Lahontan
- 4. Das hypothetische Modell des „,homme naturel“ bei Rousseau
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Darstellung des „edlen Wilden“ bei Montaigne, Lahontan und Rousseau und analysiert, wie diese Autoren die vermeintliche Reinheit des Naturzustandes gegenüber der Verfälschtheit des Kulturzustandes darstellen. Sie zeigt auf, wie diese Konzepte zur Reflexion über die eigene Kultur und ihre Werte dienen.
- Die Entstehung des „edlen Wilden“-Konzepts als Reaktion auf die europäische Kolonialisierung
- Die Rolle des „edlen Wilden“ in der Selbstreflexion der europäischen Kultur
- Die Kritik an der europäischen Zivilisation und die Idealisierung des Naturzustands
- Die Bedeutung von Ethnographie und anthropologischen Studien in der Konstruktion des „edlen Wilden“
- Der Einfluss des „edlen Wilden“-Konzepts auf die Entwicklung politischer und philosophischer Ideen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die zentrale Rolle des „edlen Wilden“ als Leitbild für die Reflexion über Kultur und Zivilisation. Sie beleuchtet die Grundannahmen der Arbeit, die sich mit der Kritik an der eigenen Kultur anhand der angeblich sorgenfreien Lebensweise indigener Völker befassen. Die Einleitung stellt die drei behandelten Autoren, Montaigne, Lahontan und Rousseau, vor und skizziert deren Ansätze zum Thema „edler Wilder“.
Kapitel 1 bietet einen historischen Überblick über das Konzept des „edlen Wilden“ und untersucht seine Entwicklung vom abwertenden „Barbaren“ hin zum idealisierten Naturmenschen. Es analysiert die Beweggründe für die Entstehung und Verbreitung dieses Stereotyps im Kontext des europäischen Kulturbewusstseins.
Kapitel 2 konzentriert sich auf die Exotisierung des „edlen Wilden“ bei Montaigne. Es analysiert seinen Essay „Von den Cannibalen“ und zeigt auf, wie Montaigne die vermeintliche Tugendhaftigkeit und Unschuld der Indianer nutzt, um die europäische Kultur zu kritisieren. Das Kapitel beleuchtet Montaignes Beitrag zur Relativierung des europäischen Selbstbildes und zur Entstehung eines neuen Bewusstseins für die Diversität der Kulturen.
Kapitel 3 analysiert Lahontans Ethnographie und Zivilisationskritik. Es untersucht seine Reiseberichte und sein fiktives Dialog „Gespräche mit einem Wilden“, um die Begegnung zwischen europäischer Kultur und indianischen Lebensweisen zu beleuchten. Das Kapitel untersucht, wie Lahontans Erfahrungen in Nordamerika seine Kritik an der europäischen Zivilisation verstärken und seine Sicht auf den „edlen Wilden“ prägen.
Schlüsselwörter
„Edler Wilder“, Naturzustand, Kulturzustand, Zivilisationskritik, Ethnographie, Exotisierung, Kolonialismus, Selbstreflexion, Montaigne, Lahontan, Rousseau, Anthropologie, Indianer, Amerika.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept des „edlen Wilden“?
Es ist eine Leitidee, die die vermeintlich reine und unverdorbene Lebensweise indigener Völker nutzt, um die Verfälschtheit und die Missstände der eigenen europäischen Zivilisation zu kritisieren.
Wie nutzt Michel de Montaigne die Figur des Wilden?
In seinem Essay „Von den Cannibalen“ idealisiert Montaigne die indianische Lebensweise als Ausdruck einer unverdorbenen Vitalität, um die moralische Position Europas in Frage zu stellen.
Was unterscheidet Lahontans Ansatz von dem Montaignes?
Im Gegensatz zu Montaigne hatte Baron Lahontan tatsächlich jahrelangen Kontakt zu kanadischen Ureinwohnern, was seinen fiktiven Dialogen eine authentischere ethnographische Basis verleiht.
Welche Rolle spielt der Naturzustand bei Jean-Jacques Rousseau?
Rousseau entwirft ein hypothetisches Modell eines verlorenen Naturzustandes, in dem Menschen ohne Kenntnis von Gut und Böse sorglos leben, bevor soziale Ungleichheit durch den Eintritt in die Gesellschaft entsteht.
Wer ist Adario in Lahontans Werk?
Adario ist ein Hurone, der in Lahontans fiktivem Dialog die europäische Zivilisation als eine unbegreifliche Verirrung darstellt und kritisiert.
- Quote paper
- Axel Limpert (Author), 2005, Die Reinheit des Naturzustandes versus die Verfälschtheit des Kulturzustandes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64664