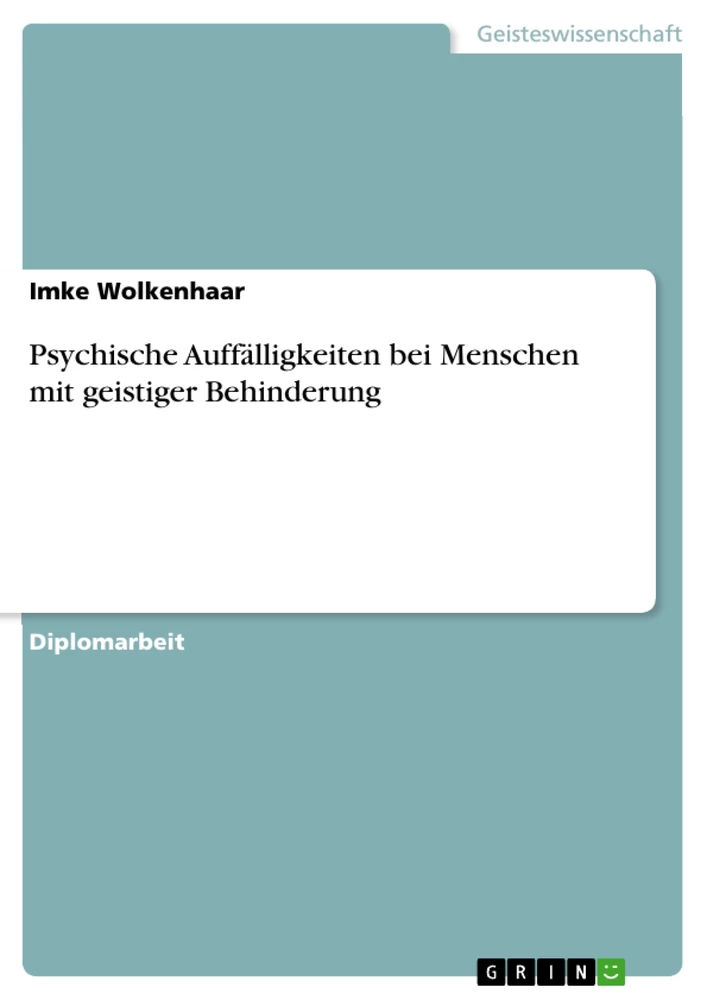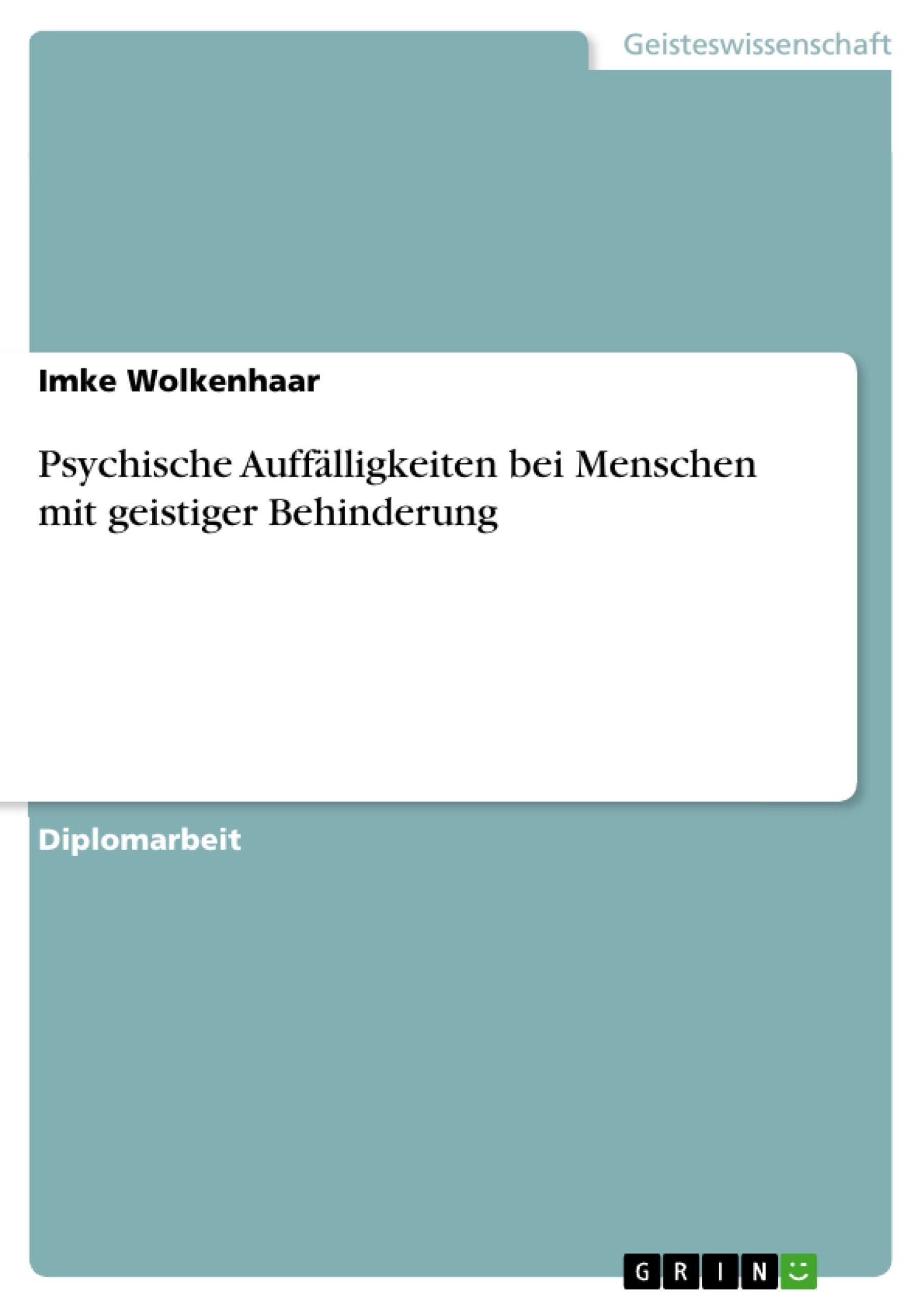In der Fachwelt ist mittlerweile unumstritten, dass auch Menschen mit einer geistigen Behinderung Verhaltensauffälligkeiten entwickeln oder psychisch erkranken können (vgl. LINGG/THEUNISSEN 2000, S. 11). Bisher fehlte jedoch ein interdisziplinärer Diskurs. Viele der früheren Arbeiten widmeten sich diesem Thema entweder aus einem klinisch-psychologischen Interesse oder aus einer rein behindertenpädagogischen Perspektive (vgl. LINGG/THEUNISSEN 2000, S. 9). Eine monokausale Sichtweise wird der Komplexität der Thematik nicht gerecht. Die exemplarischen Fallbeispiele dieser Arbeit beziehen sich auf erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung, die in einer stationären Wohngruppe leben. Das Interesse an dieser Thematik resultiert aus der langjährigen Arbeit mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung und durch die in der täglichen Praxis immer wieder auftretenden Fragen zu dieser aktuellen Problematik. Ist das Verhalten des Bewohners „verhaltensauffällig“ oder ist es „psychisch gestört“? Warum bekommen Bewohner seit langer Zeit Psychopharmaka? Welche sozialpädagogischen Herausforderungen ergeben sich aus dieser Problematik? Was ist zu tun bzw. wie ist der pädagogische Alltag zu verändern, um diesem Personenkreis adäquat begegnen zu können? Zu Beginn der Arbeit werden definitorische Bestimmungen vorgenommen. Die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Auffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung, für deren Erklärung das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (vgl. 2.4.3) herangezogen werden kann, werden in Kapitel 2 aufgezeigt. Nach der Darstellung theoriegeleiteter Modelle, wird in Kapitel 3 auf die Diagnostik psychischer Auffälligkeiten mit ihren Grundlagen und Besonderheiten bei Menschen mit geistiger Behinderung eingegangen. In Kapitel 4 werden einige wichtige psychiatrische Störungsbilder nach ICD-10 zunächst allgemein skizziert, um dann in ihrer Gültigkeit speziell für Menschen mit geistiger Behinderung überprüft zu werden. Eine Behandlungsmöglichkeit psychischer Auffälligkeiten ist die Gabe von Psychopharmaka, deren Wirkungen, Nebenwirkungen und Besonderheiten bei diesem Personenkreis in Kapitel 5 erläutert wird. In Kapitel 6 wird anhand eines Fallbeispiels aus der Praxis der Einsatz von Psychopharmaka dokumentiert. Lebensweltorientierung und Empowerment werden in Kapitel 7 exemplarisch als sozialpädagogische Konzepte dargestellt. Die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen bilden den Abschluss der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 BEGRIFFSBESTIMMUNG
- 2.1 Behinderung
- 2.1.1 WHO-Definition
- 2.1.2 Sozialrechtliche Definition
- 2.2 Geistige Behinderung
- 2.3 Psychische Gesundheit
- 2.4 Psychische Auffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 2.4.1 Prävalenz
- 2.4.2 Ätiologie
- 2.4.3 Vulnerabilitäts-Stress-Modell
- 3 DIAGNOSTIK
- 3.1 Psychiatrische Untersuchung
- 3.2 Besonderheiten der psychiatrischen Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 3.2.1 Verstehende Diagnostik
- 4 SPEZIELLE AUFFÄLLIGKEITEN
- 4.1 Schizophrenie bzw. Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis
- 4.1.1 Definition
- 4.1.2 Symptome und Diagnostik
- 4.1.3 Schizophrenie und geistige Behinderung
- 4.2 Affektive Psychosen
- 4.2.1 Definition
- 4.2.2 Ätiologie
- 4.2.3 Diagnose
- 4.2.4 Affektive Psychosen und geistige Behinderung
- 4.3 Demenz
- 4.3.1 Definition
- 4.3.2 Symptome und Diagnostik
- 4.3.3 Demenz und geistige Behinderung
- 5 PSYCHOPHARMAKA
- 5.1 Grundlagen
- 5.2 Einteilung der Psychopharmaka
- 5.2.1 Neuroleptika
- 5.2.2 Tranquilizer
- 5.2.3 Antidepressiva
- 5.3 Umgang mit Psychopharmaka
- 5.4 Psychopharmaka bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.4.1 Grundlagen
- 5.4.2 Besonderheiten
- 5.4.3 Multidimensionaler Ansatz
- 5.4.4 Rechtliche Aspekte
- 6 FALLBEISPIEL
- 7 SOZIALPÄDAGOGISCHE KONZEPTE
- 7.1 Einleitung
- 7.1.1 Strukturorientierter und sozialökologischer Ansatz
- 7.1.2 Prozess- und kommunikationsorientierter systemischer Ansatz
- 7.1.3 Konstruktivistischer systemischer Ansatz
- 7.2 Sozialpädagogische Interventionen
- 7.3 Lebensweltorientierung
- 7.3.1 Theoretische Grundlagen
- 7.3.2 Lebensweltorientierte Behindertenarbeit
- 7.3.3 Biographiearbeit mit geistig behinderten Menschen
- 7.4 Empowerment
- 7.4.1 Dialogisches Prinzip
- 8 SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht psychische Auffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Problematik zu entwickeln, diagnostische und therapeutische Ansätze zu beleuchten und sozialpädagogische Konzepte zur Unterstützung dieser Personengruppe zu präsentieren.
- Definition und Abgrenzung geistiger Behinderung und psychischer Auffälligkeiten
- Diagnostik von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Spezifische psychische Erkrankungen (Schizophrenie, affektive Psychosen, Demenz) im Kontext geistiger Behinderung
- Pharmakologische Behandlungsansätze und deren Besonderheiten
- Sozialpädagogische Interventionen und Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
2 BEGRIFFSBESTIMMUNG: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Arbeit, indem es die Begriffe "Behinderung", "geistige Behinderung" und "psychische Gesundheit" präzisiert und definiert. Es werden sowohl die WHO-Definition von Behinderung als auch sozialrechtliche Definitionen erläutert. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung und dem komplexen Zusammenspiel zwischen geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen, um ein klares Verständnis des Forschungsgegenstandes zu schaffen. Die genaue Definition dieser Begriffe ist essenziell für die weitere Analyse und Interpretation von psychischen Auffälligkeiten bei dieser Personengruppe. Die Kapitelteil "Psychische Auffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung" gibt einen ersten Überblick über die Prävalenz, Ätiologie und das Vulnerabilitäts-Stress-Modell dieser komplexen Problematik.
3 DIAGNOSTIK: Das Kapitel beschreibt die Besonderheiten der psychiatrischen Untersuchung und Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Es hebt die Herausforderungen hervor, die sich aus den kognitiven und kommunikativen Einschränkungen dieser Personengruppe ergeben und betont die Bedeutung einer verstehenden Diagnostik, die die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Betroffenen berücksichtigt. Der Fokus liegt darauf, wie man trotz dieser Herausforderungen eine valide und zuverlässige Diagnose erstellen kann, die eine Grundlage für eine adäquate Therapie bildet. Das Kapitel unterscheidet sich somit grundlegend von der Standarddiagnostik bei Menschen ohne geistige Behinderung.
4 SPEZIELLE AUFFÄLLIGKEITEN: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf drei spezifische psychische Erkrankungen – Schizophrenie, affektive Psychosen und Demenz – im Kontext geistiger Behinderung. Für jede Erkrankung werden Definition, Symptome, Diagnostik und der besondere Aspekt im Zusammenhang mit einer geistigen Behinderung detailliert erläutert. Die Kapitel betonen die Herausforderungen bei der Diagnose und Behandlung dieser Erkrankungen bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen, da die Symptomatik oft anders als bei Menschen ohne geistige Behinderung präsentiert wird. Es werden die spezifischen Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von Symptomen einer psychischen Erkrankung und Verhaltensweisen, die durch die geistige Behinderung selbst verursacht werden, aufgezeigt.
5 PSYCHOPHARMAKA: Dieses Kapitel befasst sich mit der medikamentösen Behandlung von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Es beschreibt die Grundlagen der Psychopharmakologie, die Einteilung der relevanten Medikamentengruppen (Neuroleptika, Tranquilizer, Antidepressiva) und deren Anwendung. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf den Besonderheiten der medikamentösen Therapie bei dieser Personengruppe, einschließlich der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und der Berücksichtigung individueller Faktoren. Der Umgang mit Psychopharmaka und die rechtlichen Aspekte werden ebenfalls thematisiert, um einen ganzheitlichen Überblick zu bieten.
7 SOZIALPÄDAGOGISCHE KONZEPTE: Das Kapitel befasst sich mit verschiedenen sozialpädagogischen Ansätzen und Interventionen für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen psychischen Auffälligkeiten. Es werden strukturorientierte, sozialökologische, prozess- und kommunikationsorientierte systemische und konstruktivistische systemische Ansätze erläutert und ihre Anwendbarkeit in der Praxis diskutiert. Besonderes Augenmerk wird auf die Lebensweltorientierung und Empowerment gelegt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung einer ganzheitlichen und personenzentrierten Betreuung, die die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der Betroffenen berücksichtigt und sie zu einer aktiven Gestaltung ihres Lebens befähigt.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, psychische Auffälligkeiten, Doppeldiagnose, Diagnostik, Psychiatrie, Psychopharmaka, Neuroleptika, Antidepressiva, Sozialpädagogik, Lebensweltorientierung, Empowerment, Vulnerabilitäts-Stress-Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychische Auffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit befasst sich umfassend mit psychischen Auffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung. Sie definiert die relevanten Begriffe, beleuchtet diagnostische und therapeutische Ansätze, insbesondere die pharmakologische Behandlung mit Psychopharmaka, und präsentiert sozialpädagogische Konzepte zur Unterstützung dieser Personengruppe. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und abschließende Schlüsselwörter.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie "Behinderung" (inkl. WHO- und sozialrechtlicher Definition), "geistige Behinderung" und "psychische Gesundheit". Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung und dem komplexen Zusammenspiel zwischen geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen.
Wie wird die Diagnostik von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Besonderheiten der psychiatrischen Untersuchung und Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Sie hebt die Herausforderungen aufgrund kognitiver und kommunikativer Einschränkungen hervor und betont die Bedeutung der verstehenden Diagnostik, um eine valide und zuverlässige Diagnose zu gewährleisten.
Welche spezifischen psychischen Erkrankungen werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Schizophrenie, affektive Psychosen und Demenz im Kontext geistiger Behinderung. Für jede Erkrankung werden Definition, Symptome, Diagnostik und die spezifischen Herausforderungen bei der Diagnose und Behandlung im Zusammenhang mit einer geistigen Behinderung detailliert erläutert.
Wie wird die pharmakologische Behandlung dargestellt?
Das Kapitel über Psychopharmaka beschreibt die Grundlagen der Psychopharmakologie, die Einteilung relevanter Medikamentengruppen (Neuroleptika, Tranquilizer, Antidepressiva) und deren Anwendung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Besonderheiten der medikamentösen Therapie, Vorsichtsmaßnahmen, individuelle Faktoren, der Umgang mit Psychopharmaka und rechtliche Aspekte werden ebenfalls thematisiert.
Welche sozialpädagogischen Konzepte werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene sozialpädagogische Ansätze und Interventionen. Es werden strukturorientierte, sozialökologische, prozess- und kommunikationsorientierte systemische und konstruktivistische systemische Ansätze erläutert. Besonderes Augenmerk liegt auf Lebensweltorientierung und Empowerment, mit dem Ziel einer ganzheitlichen und personenzentrierten Betreuung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, psychische Auffälligkeiten, Doppeldiagnose, Diagnostik, Psychiatrie, Psychopharmaka, Neuroleptika, Antidepressiva, Sozialpädagogik, Lebensweltorientierung, Empowerment, Vulnerabilitäts-Stress-Modell.
Gibt es ein Fallbeispiel?
Ja, die Arbeit enthält ein Fallbeispiel zur Veranschaulichung der behandelten Thematik.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Bereich der Psychiatrie, Sozialpädagogik, Pflege und Therapie, die mit Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen psychischen Erkrankungen arbeiten. Sie dient auch als Informationsquelle für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit diesem Themengebiet befassen.
- Quote paper
- Imke Wolkenhaar (Author), 2005, Psychische Auffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57490