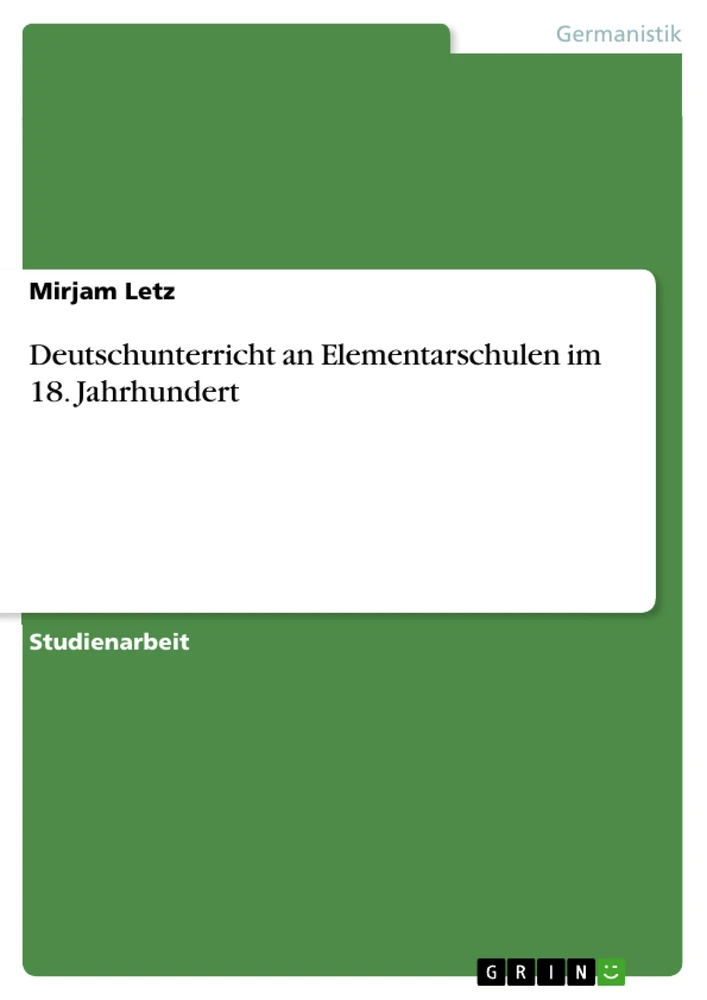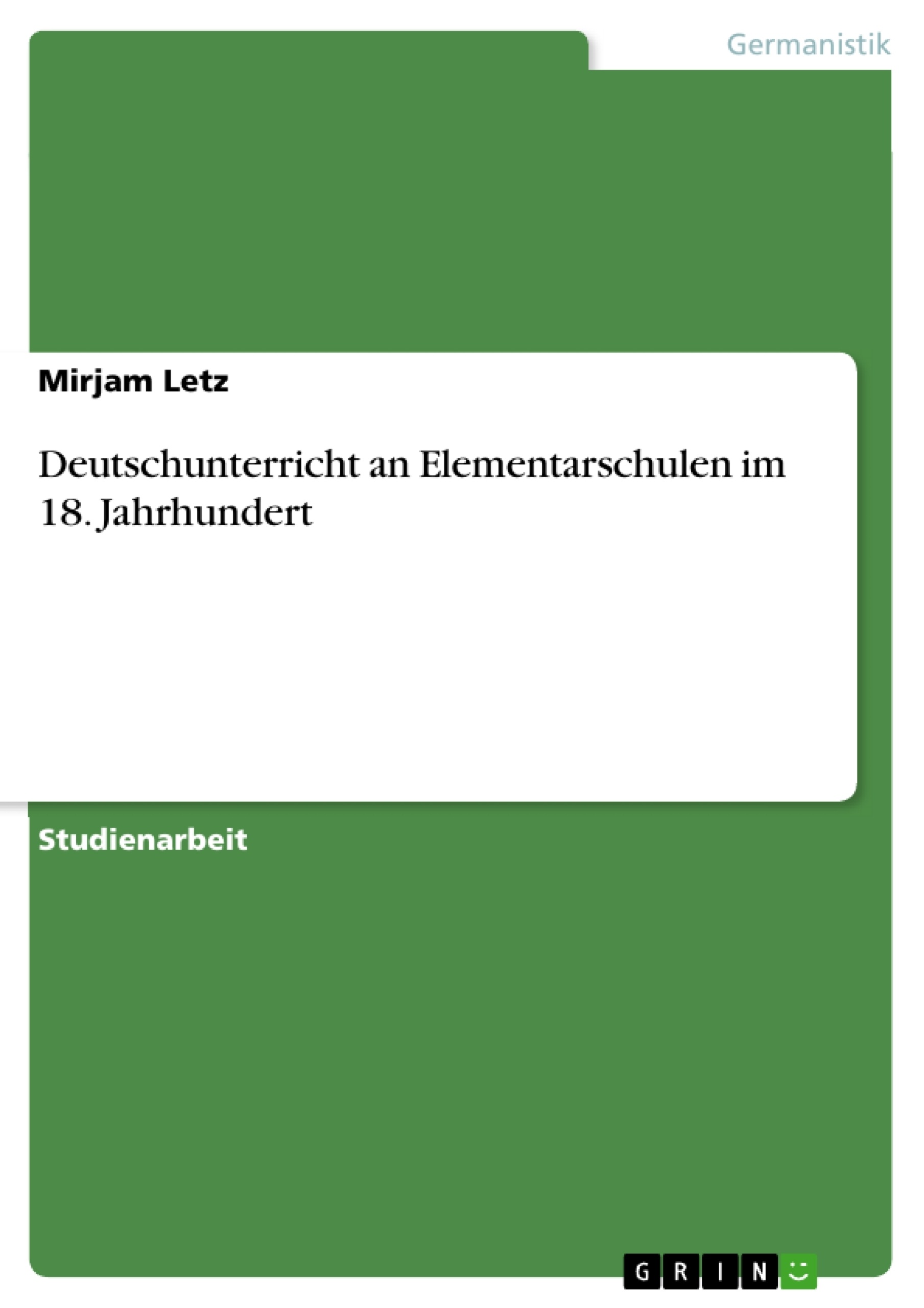„Was nützliches lernen schadet niemals, und kann oft viel helfen.“( Friedrich Eberhard von Rochow )
Seit je her wird das Sprichwort „Wissen ist Macht“ mit Gelehrsamkeit in Verbindung gebracht. Jahrhunderte lang galt Wissen als Privileg der Reichen und Mächtigen und war demnach nur einem geringen Bevölkerungsteil zugänglich. Aber nichts unterliegt mehr den gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten als Bildung und Erziehung. Bis zur Verstaatlichung des Schulsystems und somit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht durchliefen die deutsche Gesellschaft, das Schulwesen, aber auch die deutsche Sprache, verschiedene Stadien der Entwicklung.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, Schwerpunkte der Entwicklung des elementaren Lese- und Schreibunterrichts bis hin zum elementaren Deutschunterricht im 18. Jahrhundert herauszuarbeiten und unter historischen, politischen, aber auch sozialen Gesichtspunkten zu betrachten.
Da regulärer Deutschunterricht an Schulen das Resultat eines langen Entwicklungsprozesses darstellt, werde ich zunächst auf die Anfänge des Lese-und Schreibunterrichts zurückblicken und dabei didaktische Besonderheiten hervorheben. Im Anschluss daran folgen einige Erläuterungen hinsichtlich der Methodik und des Wesens des Katechismusunterrichts. Des Weiteren gehe ich auf die zunehmende Bedeutung der deutschen Sprache als Nationalsprache im 18. Jahrhundert ein, da das Zeitalter der Aufklärung zu Reformen anregte und maßgeblich zur Entwicklung des Deutschunterrichts beitrug. Bezüglich der Reformierung des Elementarschulwesens beziehe ich mich anschließend auf das preußische Generallandschulreglement von 1763 und werde die Schulsituation vor und nach dem Erlass vergleichend darstellen. Während der Bewegung des Philanthropinismus` kennzeichneten Moral und Vernunft die weitere Entwicklung des Deutschunterrichts im 18. Jahrhundert. Zur Erläuterung dieses Sachverhaltes bediene ich mich des Volkslesebuches „Der Kinderfreund“ von F. E. v. ROCHOW und werde an einem ausgewählten Textbeispiel die Grundsätze der neuen moralischen Erziehung verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Entwicklung des elementaren Lese- und Schreibunterrichts
- II.1. Die Verbreitung der deutschen Schriftsprache und die Entstehung von Schreibschulen
- II.2. Der Katechismusunterricht - Die deutsche Sprache im Dienst der Glaubens- und Sittenlehre
- II.3. Die zunehmende Bedeutung der deutschen Volkssprache als Nationalsprache im 17. und 18. Jahrhundert
- III. Die Reformierung des Schulsystems
- III.1. Das Elementarschulwesen vor und nach dem preußischen Generallandschulreglement vom 12. August 1763
- IV. Friedrich Eberhard von Rochows „Der Kinderfreund“ – Neue Aspekte der Erziehung
- IV.1. Strukturelle und inhaltliche Schwerpunkte des Buches
- IV.2. Die Verbreitung und Wirkung des Volkslesebuches „Der Kinderfreund“
- IV.3. Aufklärung und moralische Erziehung - Erläuterung neuer Lehrmethoden an einem ausgewählten Beispiel
- IV.4. Die Umsetzung der Neuerungen an der Reckahnschule
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung des elementaren Lese- und Schreibunterrichts bis hin zum elementaren Deutschunterricht im 18. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert die historischen, politischen und sozialen Aspekte dieser Entwicklung, indem sie die Anfänge des Lese- und Schreibunterrichts beleuchtet, die Besonderheiten des Katechismusunterrichts erklärt und die zunehmende Bedeutung der deutschen Sprache als Nationalsprache im 18. Jahrhundert untersucht. Außerdem betrachtet die Arbeit die Reformierung des Elementarschulwesens im Kontext des preußischen Generallandschulreglements von 1763 und beleuchtet die Schulsituation vor und nach dessen Erlass. Schließlich widmet sich die Arbeit dem Einfluss des Volkslesebuches "Der Kinderfreund" von F. E. v. Rochow und erläutert an einem ausgewählten Beispiel die Grundsätze der neuen moralischen Erziehung, die die Entwicklung des Deutschunterrichts im 18. Jahrhundert prägten.
- Die Entwicklung des Lese- und Schreibunterrichts im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten
- Die Rolle des Katechismusunterrichts in der Vermittlung von Sprache und Religion
- Die zunehmende Bedeutung der deutschen Sprache als Nationalsprache im 18. Jahrhundert
- Die Reformierung des Elementarschulwesens im 18. Jahrhundert
- Die Bedeutung der Aufklärung und moralischen Erziehung für die Entwicklung des Deutschunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Zielsetzung. Sie befasst sich mit der Bedeutung von Wissen und Bildung in der Geschichte und zeichnet die Entwicklung des deutschen Schulwesens und der Sprache im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen nach.
Kapitel II. behandelt die Entwicklung des elementaren Lese- und Schreibunterrichts. Dabei wird die Verbreitung der deutschen Schriftsprache und die Entstehung von Schreibschulen im Mittelalter beleuchtet. Das Kapitel analysiert die Rolle des Katechismusunterrichts in der Vermittlung von Sprache und Religion und untersucht die zunehmende Bedeutung der deutschen Volkssprache als Nationalsprache im 17. und 18. Jahrhundert.
Kapitel III. widmet sich der Reformierung des Schulsystems im 18. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf dem preußischen Generallandschulreglement von 1763 und der vergleichenden Darstellung der Schulsituation vor und nach dessen Erlass.
Kapitel IV. behandelt die neuen Aspekte der Erziehung, die im Zeitalter der Aufklärung aufkamen. Das Kapitel analysiert die Struktur und den Inhalt des Volkslesebuches "Der Kinderfreund" von F. E. v. Rochow und erläutert an einem ausgewählten Beispiel die Grundsätze der neuen moralischen Erziehung. Darüber hinaus wird die Umsetzung der Neuerungen an der Reckahnschule beleuchtet.
Schlüsselwörter
Deutschunterricht, Elementarschulwesen, Schreibschulen, Katechismusunterricht, Nationalsprache, Aufklärung, moralische Erziehung, "Der Kinderfreund", F. E. v. Rochow, Generallandschulreglement, Philanthropinismus.
- Citar trabajo
- Mirjam Letz (Autor), 2006, Deutschunterricht an Elementarschulen im 18. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56126