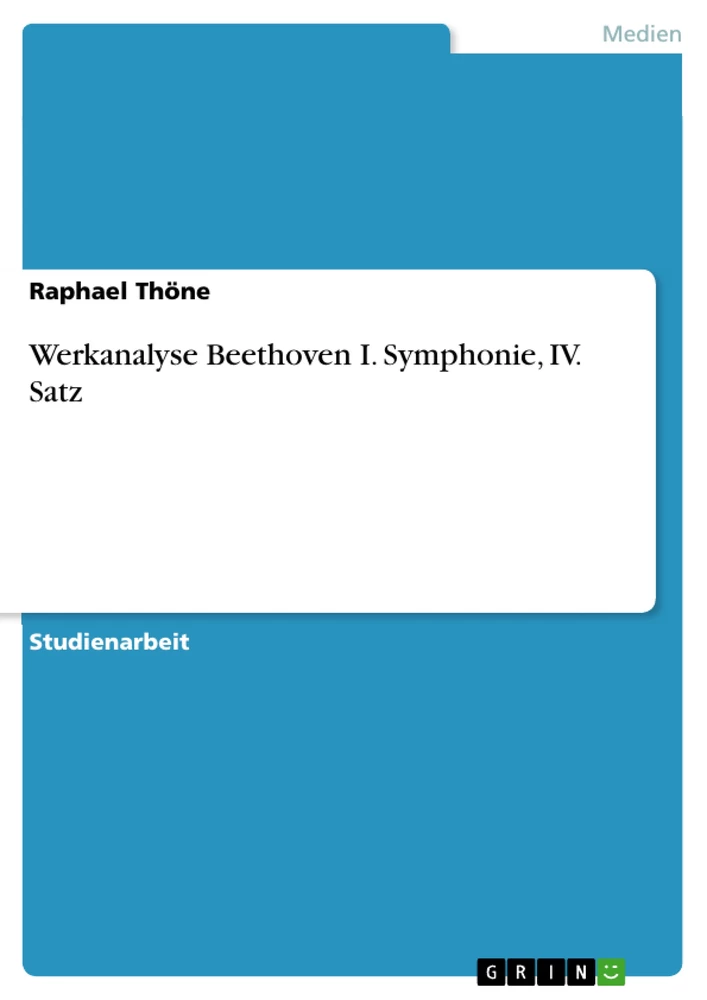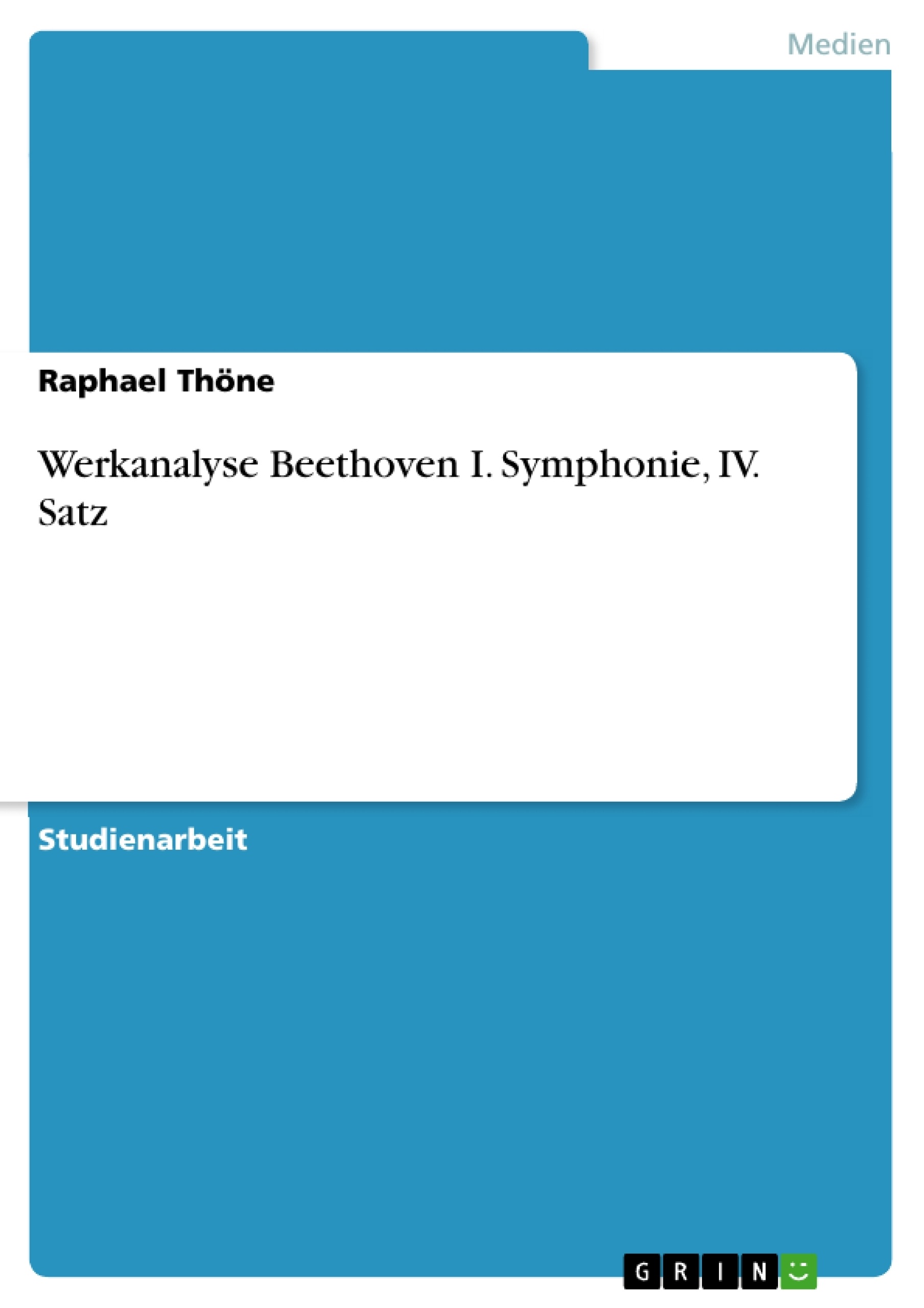Ludwig van Beethovens I. Symphonie in C-Dur ist während der Jahre 1799/1800 komponiert worden, ihre Uraufführung fand am 2. April 1800 im K. K. National Hoftheater in Wien statt. Bis zu diesem Zeitpunkt finden sich im Beethovenschen Oeuvre vor allem neben den Klaviersonaten (Op. 2, Op. 6, Op. 7, Op. 10, 13, 14) zahlreiche kammermusikalische Werke für unterschiedliche Besetzungen (z. B. Trio: Op. 1, Op. 3, Op. 11; Quintette: z. B. Quintett Es-Dur für Klavier und Bläser Op. 16, Streichquartette: 6 Streichquartette op. 18). Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass die beiden Klavierkonzerte C-Dur (Op. 15) und B-Dur (Op. 19) bereits komponiert waren, somit eine Erfahrung mit dem symphonischen Satz für Beethoven schon vor der Komposition seiner I. Symphonie vorhanden war. Im Hinblick auf die Opusfolge ist zudem interessant, dass sich Beethoven vor der Komposition seiner I. Symphonie intensivst mit der Behandlung des Streichapparates auseinander setzte. Die bereits oben erwähnten 6 Streichquartette Op. 18 zeigen vor allem seine meisterhafte Technik, kleinstmotivisch mit den Hauptthemen zu arbeiten und trotz homophoneren Satzstrukturen dennoch kontrapunktisch zu arbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung/Genesis des Werkes
- Werkanalyse
- Der 4. Satz
- Einleitung
- 1. Thema
- Überleitungsteil
- 2. Thema
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Werkanalyse befasst sich mit dem 4. Satz der I. Symphonie in C-Dur von Ludwig van Beethoven. Sie beleuchtet die Entstehung des Werkes im Kontext der musikalischen Entwicklung Beethovens sowie die Besonderheiten der verwendeten Kompositionstechniken und Instrumentation. Der Fokus liegt auf der detaillierten Analyse der beiden Hauptthemen, des Überleitungsteils und des Schluss-Tutti-Abschnitts.
- Analyse der Kompositionstechniken und Instrumentation im 4. Satz
- Untersuchung der beiden Hauptthemen und ihrer charakteristischen Merkmale
- Darstellung der thematischen Entwicklung und der musikalischen Gestaltung des Überleitungsteils
- Analyse des Schluss-Tutti-Abschnitts und seiner Verbindung zur Exposition
- Bedeutung der instrumentatorischen Kontraste und ihrer Rolle in der Spannungssteigerung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung/Genesis des Werkes
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Entstehungszeit und die Uraufführung der I. Symphonie von Beethoven. Sie beleuchtet Beethovens Schaffen bis zum Zeitpunkt der Komposition des Werkes und zeigt die Relevanz der Streichquartette für seine spätere symphonische Arbeit auf. Die Instrumentation wird im Hinblick auf die Klassik und die typische Orchesterbesetzung der damaligen Zeit erläutert.
Der 4. Satz
Einleitung
Die Einleitung des 4. Satzes beginnt in der Dominantregion mit einem langsamen Adagio, das mit einem fortefortissimo-G-Durklang des gesamten Orchesters einsetzt. Die I. Violinen spielen eine G-Skala im Rahmen eines Dominantspetakkords, wobei der punktierte Rhythmus und die Pausen einen Verzögerungseffekt erzeugen.
1. Thema
Das 1. Thema in C-Dur beginnt im Takt 7 mit den I. Violinen und ist formal als eine geschlossene Periode aus zwei achttaktigen Phrasen zu bezeichnen. Es zeichnet sich durch die Dreiklangsbrechung, das spielerische Umspielen einzelner Töne und die aufwärts durchschrittene G-Skala aus der Einleitung aus. Der Nachsatz wird durch Tonrepetition und ein „Seufzer-Motiv“ geprägt, welches durch die nach unten auflösende Quartdissonanz entsteht.
Überleitungsteil
Der Überleitungsteil führt vom 1. Thema zum 2. Thema in G-Dur und kann in drei Abschnitte unterteilt werden. Im ersten Abschnitt wird die Haupttonart C-Dur durch Hörner und Streicher bestätigt, im zweiten Abschnitt variieren die I. Violinen ihr vorheriges Tonleitermotiv, und im dritten Abschnitt wird die Dominante G-Dur durch eine Bassfigur vorbereitet.
2. Thema
Das 2. Thema in G-Dur basiert auf einem charakteristischen rhythmischen Grundmuster, welches sich dreimal wiederholt. Es wird durch einen „Seufzer-Motiv“ und eine Akkordbrechung eines D-Dur-Dominantseptakkordes geprägt. Der instrumentatorische Kontrast zwischen Holzbläsern und Blechbläsern spielt in diesem Abschnitt eine wichtige Rolle in der Spannungssteigerung.
Schlüsselwörter
Beethoven, Symphonie, C-Dur, 4. Satz, Adagio, Allegro molto e vivace, Kompositionstechniken, Instrumentation, Hauptthemen, Überleitungsteil, Schluss-Tutti-Abschnitt, Spannungssteigerung, Instrumentatorische Kontraste
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde Beethovens 1. Symphonie uraufgeführt?
Die Uraufführung fand am 2. April 1800 im K. K. National Hoftheater in Wien statt.
Was ist das Besondere an der Einleitung zum 4. Satz?
Der Satz beginnt mit einem langsamen Adagio, in dem die Violinen schrittweise eine G-Skala aufbauen, was einen verzögernden Effekt erzeugt.
Welche musikalischen Merkmale hat das 1. Thema des 4. Satzes?
Es ist in C-Dur verfasst, zeichnet sich durch Dreiklangsbrechungen und ein spielerisches Umspielen von Tönen aus.
Wie ist das Orchester in dieser Symphonie besetzt?
Die Besetzung entspricht dem klassischen Standard der Zeit, wobei Beethoven jedoch bereits seine meisterhafte Technik im Umgang mit dem Streichapparat zeigt.
Was versteht man unter dem "Seufzer-Motiv" im 2. Thema?
Es handelt sich um eine musikalische Figur, die durch eine nach unten auflösende Quartdissonanz Spannung und Entspannung erzeugt.
- Quote paper
- Dr. Raphael Thöne (Author), 2002, Werkanalyse Beethoven I. Symphonie, IV. Satz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52064