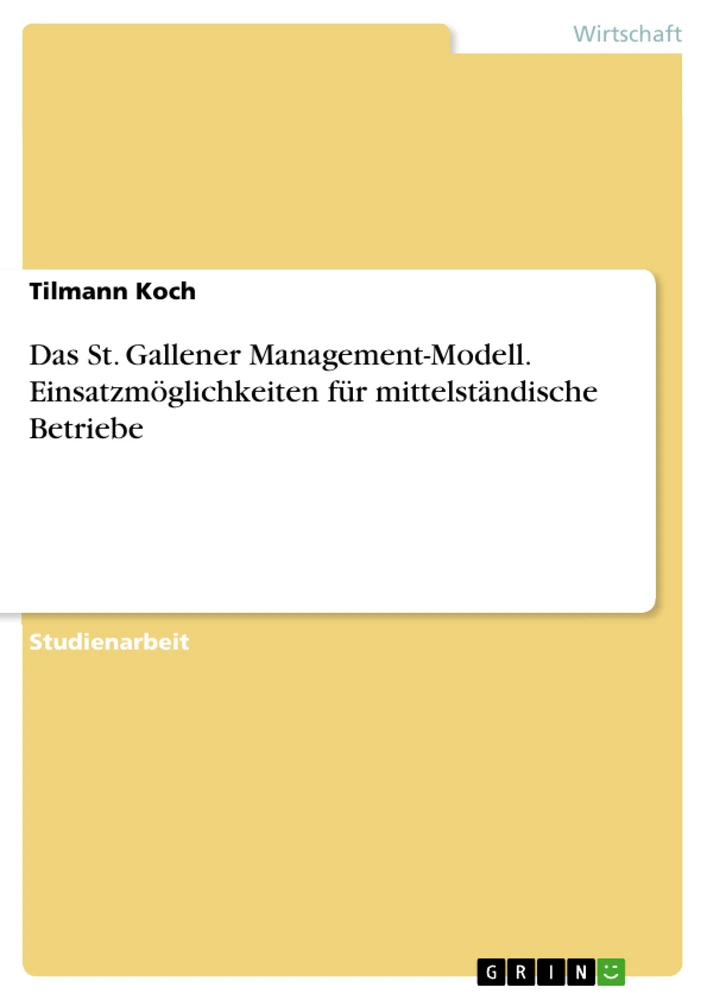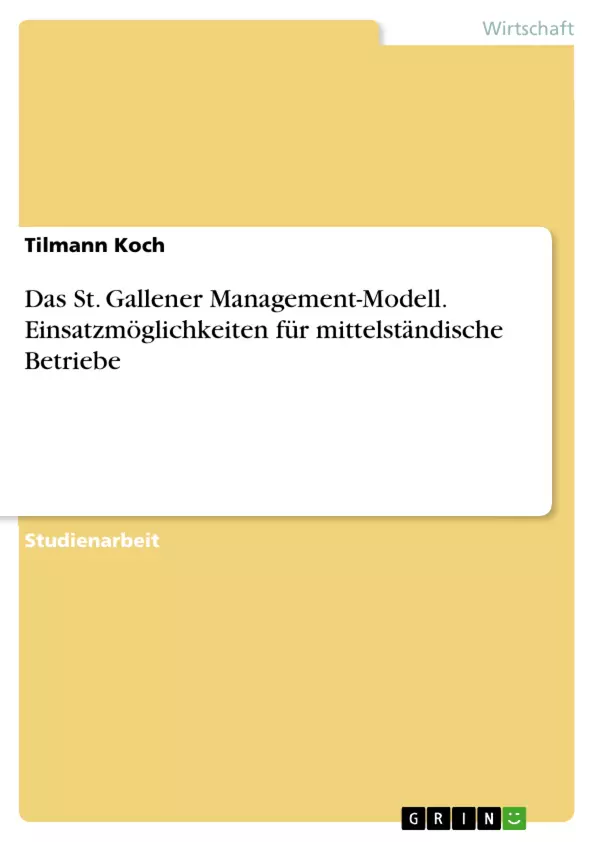Die rapide Zunahme der Komplexität von Führungsaufgaben in den letzten Jahrzenten ist auch empirisch erwiesen. Um diesen neuen Ansprüchen gerecht zu werden sind Führungsansätze notwendig, die neben ökonomischen auch soziale, ökologische und technologische Aspekte berücksichtigen. Es ist daher ein höchst aktuelles Anliegen ein Management-Konzept zu entwickeln, das all diese Aspekte, die Unternehmen als soziale Systeme betreffen, durch ganzheitliches Denken integriert.
Das St. Galler Management-Konzept (SGMM) stellt diesbezüglich einen vielversprechenden Ansatz dar. Die Vorstellung dieses Konzepts und vor allem die Verdeutlichung seiner Potenziale für den Einsatz in mittelständischen Betrieben ist das Ziel dieser Arbeit.
Das Verständnis von Wissenschaft ist historisch von einer kausalen Denkweise und der Suche nach Ursache-Wirkungsbeziehungen geprägt. Dementsprechend beruht auch das klassische Managementverständnis auf der Annahme, dass eine zielgerichtete Maßnahme auch das intendierte Ergebnis herbeiführen wird . Trends wie die rasante Globalisierung und technischer Fortschritt, schwerwiegende demographische Veränderungen, gesellschaftlicher Wertewandel, abrupter Wechsel von starken Wachstumsimpulsen und Rezessionen sowie der steigende Stellenwert des Umweltschutzes führen dazu, dass simples Kausalitätsdenken der komplizierten Realität nicht mehr gerecht wird.
Die heutige Unternehmenswelt ist dafür zu dynamisch und komplex. „Bewährte“ klassische Konzepte tendieren zur Reduktion dieser Komplexität durch vereinfachende Annahmen oder die Betrachtung lediglich eines Teilausschnitts der relevanten Realität. Mit diesem Vorgehen kann sich die Führungskraft weiterhin der Illusion hingeben, ihre Umwelt nach wie vor verstehen und nach ihren Vorstellungen beeinflussen zu können.
Die jüngeren globalen Wirtschaftskrisen bisher ungekannten Ausmaßes, unkontrollierte globale Erwärmung und eine historisch hohe Anzahl bewaffneter Konflikte sind traurige Indizien dafür, dass die gängigen Annahmen zur Beherrschbarkeit von Entwicklungen durch menschliche Intervention überholt sind und dringend durch realistischere Ansätze ersetzt werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation und Ziel der Arbeit
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Hauptteil
- 2.1 Theoretische Grundlagen und Einflüsse
- 2.1.1 Wissenschaftstheoretische Position
- 2.1.2 Rahmentheoretische Grundlagen und Konzepte
- 2.2 Das St. Galler Management-Modell
- 2.2.1 Entstehung und Zielsetzung
- 2.2.2 Das erste SGMM
- 2.2.3 Das zweite SGMM
- 2.2.4 Das dritte SGMM
- 2.2.5 Das vierte SGMM
- 2.2.6 Besonderheiten der Arbeit mit dem SGMM
- 2.3 Einsatzmöglichkeiten des SGMM für mittelständische Betriebe
- 2.3.1 Der mittelständische Betrieb und seine Bedeutung
- 2.3.2 Besonderheiten mittelständischer Betriebe
- 2.3.3 Das SGMM als Reflexionssprache und Arbeitsinstrument für den Mittelstand
- 3 Schluss
- 3.1 Fazit
- 3.2 Kritische Würdigung und Ausblick auf zukünftige Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das St. Galler Management-Modell (SGMM) und seine Anwendbarkeit in mittelständischen Betrieben. Ziel ist es, das Modell vorzustellen und sein Potenzial für den Mittelstand aufzuzeigen. Die Arbeit berücksichtigt die Entwicklung des SGMM über vier Generationen und analysiert dessen Eignung als Reflexions- und Arbeitsinstrument.
- Entwicklung des St. Galler Management-Modells über vier Generationen
- Theoretische Grundlagen des SGMM (Konstruktivismus, Kybernetik zweiter Ordnung)
- Charakteristika mittelständischer Betriebe und deren Herausforderungen
- Anwendbarkeit des SGMM als Reflexions- und Arbeitsinstrument im Mittelstand
- Vorteile und Limitationen des SGMM im Kontext des Mittelstands
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung begründet die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Managementansatzes angesichts zunehmender Komplexität in der Wirtschaft. Sie stellt das St. Galler Management-Modell (SGMM) als vielversprechende Lösung vor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die theoretischen Grundlagen, die Entwicklung des SGMM und dessen Anwendung im Mittelstand umfasst.
2 Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in die Erläuterung der theoretischen Grundlagen des SGMM, die Darstellung der vier Generationen des Modells und die Diskussion der Einsatzmöglichkeiten für mittelständische Betriebe. Zunächst wird die wissenschaftstheoretische Position des Konstruktivismus und die damit verbundenen Konzepte der Kybernetik zweiter Ordnung und der Selbstreferenz erläutert. Anschließend wird die historische Entwicklung des SGMM über vier Generationen detailliert beschrieben, wobei die jeweiligen Besonderheiten und Weiterentwicklungen hervorgehoben werden. Der letzte Abschnitt analysiert den Mittelstandsbegriff, seine Charakteristika und die Herausforderungen für mittelständische Unternehmen im Kontext von Management und Führung. Hier wird die Eignung des SGMM als Reflexions- und Arbeitsinstrument für mittelständische Unternehmen im Detail untersucht.
3 Schluss: [Dieser Abschnitt wird gemäß den Vorgaben ausgelassen]
Schlüsselwörter
St. Galler Management-Modell (SGMM), Mittelstand, KMU, Konstruktivismus, Kybernetik zweiter Ordnung, Selbstreferenz, ganzheitliches Denken, integrative Managementlehre, Reflexionssprache, Arbeitsinstrument, Unternehmensführung, Komplexität, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen zum St. Galler Management-Modell im Mittelstand
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das St. Galler Management-Modell (SGMM) und seine Anwendbarkeit in mittelständischen Betrieben. Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit theoretischen Grundlagen, der Entwicklung des SGMM über vier Generationen und der Analyse seiner Eignung für mittelständische Unternehmen, sowie einen Schluss mit Fazit und Ausblick. Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick, inklusive Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Welche Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil behandelt die theoretischen Grundlagen des SGMM (Konstruktivismus, Kybernetik zweiter Ordnung), die detaillierte Darstellung der vier Generationen des Modells mit ihren jeweiligen Besonderheiten, und eine eingehende Analyse der Einsatzmöglichkeiten des SGMM für mittelständische Betriebe. Dabei werden die Charakteristika mittelständischer Unternehmen und deren Herausforderungen im Kontext von Management und Führung beleuchtet.
Welche theoretischen Grundlagen werden im SGMM verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die wissenschaftstheoretische Position des Konstruktivismus und die damit verbundenen Konzepte der Kybernetik zweiter Ordnung und der Selbstreferenz als Grundlage für das Verständnis des SGMM.
Wie viele Generationen des SGMM werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des St. Galler Management-Modells über vier Generationen und beschreibt die Besonderheiten und Weiterentwicklungen jeder Generation.
Für wen ist das SGMM relevant?
Der Fokus der Arbeit liegt auf der Anwendbarkeit des SGMM in mittelständischen Betrieben (KMU). Die Arbeit untersucht, wie das Modell als Reflexions- und Arbeitsinstrument im Mittelstand eingesetzt werden kann und welche Vorteile und Limitationen es in diesem Kontext aufweist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: St. Galler Management-Modell (SGMM), Mittelstand, KMU, Konstruktivismus, Kybernetik zweiter Ordnung, Selbstreferenz, ganzheitliches Denken, integrative Managementlehre, Reflexionssprache, Arbeitsinstrument, Unternehmensführung, Komplexität, Nachhaltigkeit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, das St. Galler Management-Modell vorzustellen und sein Potenzial für den Mittelstand aufzuzeigen. Es soll analysiert werden, ob und wie das SGMM als Reflexions- und Arbeitsinstrument in mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden kann.
Was wird im Schlussteil der Arbeit behandelt?
Der Schlussteil der Arbeit (hier ausgelassen) würde üblicherweise ein Fazit ziehen und einen Ausblick auf zukünftige Forschung geben.
- Citation du texte
- Tilmann Koch (Auteur), 2018, Das St. Gallener Management-Modell. Einsatzmöglichkeiten für mittelständische Betriebe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507091