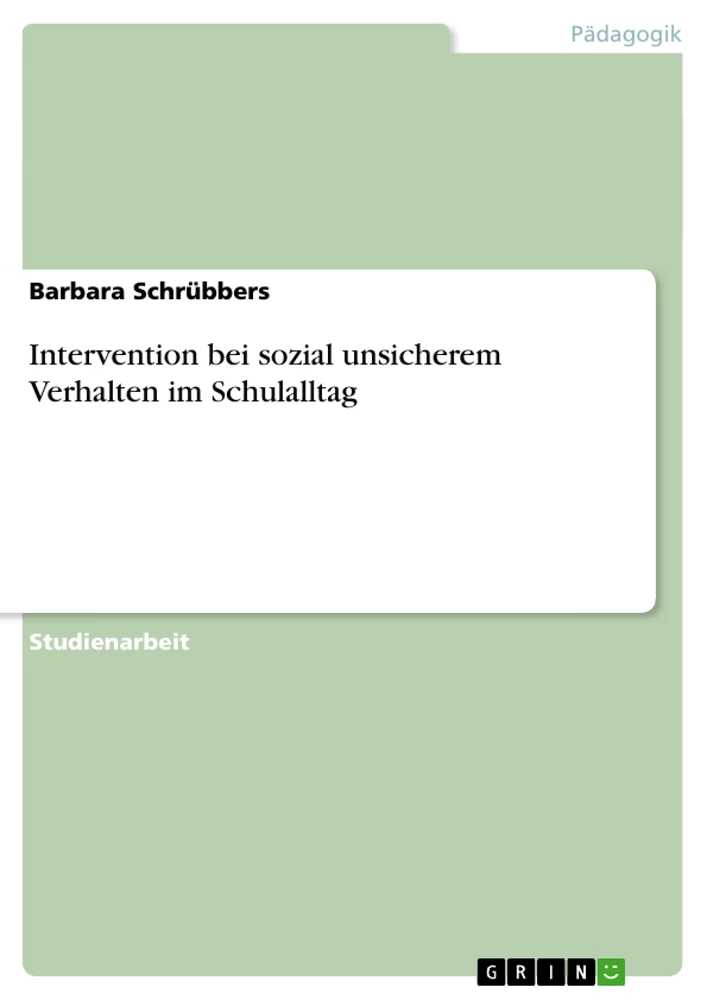Julia ist Schülerin einer 6. Klasse einer Realschule, wirkt sehr schüchtern, nervös und ist gehemmt, etwas frei zu erzählen. Thomas besucht die zweite Klasse einer Grundschule, weint häufig, versteckt sich oft unter seinem Tisch und spricht nur sehr leise und undeutlich. Jan ist bereits 17 Jahre alt und Schüler eines Gymnasiums. Er steht in den Pausen meistens abseits und alleine, ist bei Kurstreffen oder anderen außerschulischen Veranstaltungen nur selten anwesend und in der mündlichen Mitarbeit mangelhaft. Susanne besucht die 8. Klasse einer Hauptschule, hat kaum Freunde, scheut jeglichen Blickkontakt und spricht, wenn überhaupt, mit zittriger Stimme. Schon häufig ist sie unentschuldigt nicht zum Unterricht erschienen.
Alle diese vier Kinder beziehungsweise Jugendliche zeigen Verhaltensweisen, die für soziale Unsicherheit typisch sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass jeder Lehrer schon einmal einen sozial unsicheren Schüler unterrichtet hat, unabhängig von Schulform und Altersstufe. Denn soziale Unsicherheit und Ängste sind bei Kindern und Jugendlichen weit verbreitet (vgl. Petermann 1996, S. 11). Allerdings beschäftigen Pädagogen und Psychologen sich erst seit wenigen Jahrzehnten mit diesem Problem. Schüchternes und zurückgezogenes Sozialverhalten wurde zuvor als Übergangsform innerhalb einer normalen Entwicklung angesehen (vgl. Petermann 1987a, S. 230). Hinzu kommt, dass soziale Angst, soziale Unsicherheit und depressives Verhalten aufgrund ihres internalisierenden (nach innen gerichteten) Charakters Eltern und Lehrern oft nicht auffallen. Im Gegensatz zu Kindern mit externalisierenden Störungsbildern wie Hyperaktivität und Aggression, die mit ihrem Verhalten nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Umfeld schaden, verhalten sich sozial unsichere Kinder und Jugendliche angepasst und eher passiv (vgl. Gössinger 2002). Dass die Defizite dieses Verhaltens im Vergleich zu beispielsweise aggressiven Kindern nicht so offensichtlich sind und sozial unsicheres Verhalten das Familienleben sowie den Schulunterricht nicht zu beeinträchtigen scheint, können demnach weitere Gründe für die unzureichende Beachtung dieser Verhaltensauffälligkeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1) Einleitung: Soziale Unsicherheit als Verhaltensauffälligkeit bei Schülern
- 2) Begriff des sozial unsicheren Verhaltens und Erklärungsansätze
- 2.1) Begriffsklärung
- 2.2) Lerntheoretische Erklärungsansätze
- 2.2.1) Modelllernen
- 2.2.2) Verstärkungslernen
- 2.2.3) Klassisches Konditionieren
- 2.2.4) Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit
- 2.2.4.1) Unkontrollierbarkeit und Hilflosigkeitsentwicklung
- 2.2.4.2) Unvorhersagbarkeit und die Sicherheitssignalhypothese
- 2.2.4.3) Hilflosigkeitsverhalten
- 2.3) Erziehungsprozesse als Ursache sozialer Unsicherheit
- 3) Intervention bei sozialer Unsicherheit in der Schule
- 3.1) Ziele der Intervention
- 3.2) Abbau von sozial unsicherem Verhalten
- 3.3) Unterrichtsmaßnahmen
- 3.3.1) Unterrichtsstil
- 3.3.2) Lehrerverhalten
- 3.3.3) Leistungsbemessung
- 3.3.4) Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Beratungsstelle
- 4) Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung von Möglichkeiten, sozial unsicheren Schülern im regulären Schulunterricht zu helfen und ängstliches Verhalten abzubauen. Die Arbeit basiert auf theoretischen Annahmen über sozial unsicheres Verhalten. Zuerst werden soziale Unsicherheit definiert und mögliche Erklärungsansätze erläutert. Anschließend werden Interventionen im schulischen Kontext behandelt.
- Definition und Begriffsklärung sozial unsicheren Verhaltens
- Lerntheoretische Erklärungsansätze für soziale Unsicherheit
- Der Einfluss von Erziehungsprozessen auf die Entwicklung sozialer Unsicherheit
- Interventionen und Strategien zur Unterstützung sozial unsicherer Schüler im Unterricht
- Möglichkeiten des Abbaus von sozial unsicherem Verhalten im Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
1) Einleitung: Soziale Unsicherheit als Verhaltensauffälligkeit bei Schülern: Die Einleitung präsentiert Fallbeispiele sozial unsicherer Schüler, um das Problem zu veranschaulichen. Sie betont die Häufigkeit sozialer Unsicherheit bei Kindern und Jugendlichen und den Mangel an Interventionen im regulären Unterricht. Es wird auf die oft fehlende Wahrnehmung dieses Problems durch Eltern und Lehrer hingewiesen, da sozial unsicheres Verhalten im Gegensatz zu externalisierendem Verhalten eher passiv und angepasst ist. Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Notwendigkeit der Arbeit.
2) Begriff des sozial unsicheren Verhaltens und Erklärungsansätze: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von sozial unsicherem Verhalten und liefert verschiedene Erklärungsansätze. Es differenziert zwischen verschiedenen Ausprägungen der Unsicherheit, die sich in Sprachverhalten, Gefühlsausdruck, Mimik/Gestik, nicht-personengebundenen Tätigkeiten und Sozialkontakten zeigen können. Soziale Angst wird als ein wichtiger Motivator für zurückgezogenes Verhalten identifiziert, wobei die Angst vor Kritik, Ablehnung und Misserfolg im Mittelpunkt steht. Lerntheoretische Ansätze, wie Modelllernen, Verstärkungslernen und die Theorie der erlernten Hilflosigkeit, werden als mögliche Ursachen diskutiert.
3) Intervention bei sozialer Unsicherheit in der Schule: Das Kapitel konzentriert sich auf Interventionen zur Unterstützung sozial unsicherer Schüler im Schulalltag. Es werden verschiedene Strategien und Unterrichtsmaßnahmen erörtert, die darauf abzielen, sozial unsicheres Verhalten abzubauen. Hierbei werden der Unterrichtsstil, das Lehrerverhalten, die Leistungsbemessung sowie die Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Beratungsstellen als wichtige Einflussfaktoren betrachtet. Das Kapitel liefert konkrete Handlungsempfehlungen für den Unterricht und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren.
Schlüsselwörter
Soziale Unsicherheit, Schüchternheit, Angst, Schulalltag, Intervention, Lerntheorie, Erziehungsprozesse, Unterrichtsstil, Lehrerverhalten, Leistungsbemessung, Sozialkompetenz, Verhaltensauffälligkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziale Unsicherheit als Verhaltensauffälligkeit bei Schülern
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit behandelt das Thema soziale Unsicherheit bei Schülern. Sie definiert den Begriff, untersucht mögliche Ursachen aus lerntheoretischer Sicht (Modelllernen, Verstärkungslernen, klassische Konditionierung, erlernte Hilflosigkeit) und dem Einfluss von Erziehungsprozessen. Ein Schwerpunkt liegt auf Interventionen und Strategien zur Unterstützung betroffener Schüler im regulären Schulunterricht, inklusive konkreter Handlungsempfehlungen für Lehrer, Eltern und Beratungsstellen.
Welche Lerntheorien werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene lerntheoretische Erklärungsansätze für soziale Unsicherheit, darunter Modelllernen, Verstärkungslernen, klassisches Konditionieren und die Theorie der erlernten Hilflosigkeit (inklusive Unkontrollierbarkeit, Unvorhersagbarkeit und Hilflosigkeitsverhalten). Diese Theorien werden genutzt, um die Entwicklung und Aufrechterhaltung sozial unsicheren Verhaltens zu verstehen.
Wie wird soziale Unsicherheit definiert?
Soziale Unsicherheit wird in der Arbeit umfassend definiert und von anderen Verhaltensauffälligkeiten abgegrenzt. Es wird auf verschiedene Ausprägungen eingegangen, die sich in Sprachverhalten, Gefühlsausdruck, Mimik/Gestik, Aktivitäten und Sozialkontakten zeigen können. Soziale Angst als zentraler Motivator für zurückgezogenes Verhalten und die Angst vor Kritik, Ablehnung und Misserfolg werden hervorgehoben.
Welche Interventionsmöglichkeiten im Schulkontext werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Interventionsmöglichkeiten im Schulkontext, um sozial unsicherem Verhalten entgegenzuwirken. Es werden Strategien und Unterrichtsmaßnahmen erörtert, die den Unterrichtsstil, das Lehrerverhalten, die Leistungsbemessung und die Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Beratungsstellen betreffen. Konkrete Handlungsempfehlungen für den Schulalltag werden gegeben.
Welche Rolle spielen Erziehungsprozesse?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Erziehungsprozessen auf die Entwicklung sozialer Unsicherheit. Es wird analysiert, wie erzieherische Maßnahmen und Interaktionen die Entstehung und Verstärkung sozial unsicherem Verhaltens beeinflussen können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Unsicherheit, Schüchternheit, Angst, Schulalltag, Intervention, Lerntheorie, Erziehungsprozesse, Unterrichtsstil, Lehrerverhalten, Leistungsbemessung, Sozialkompetenz, Verhaltensauffälligkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriff des sozial unsicheren Verhaltens und Erklärungsansätze, Intervention bei sozialer Unsicherheit in der Schule und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas und baut aufeinander auf.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sozial unsicheren Schülern im regulären Schulunterricht geholfen und ängstliches Verhalten abgebaut werden kann. Sie will theoretische Grundlagen vermitteln und praktische Handlungsempfehlungen geben.
- Quote paper
- Barbara Schrübbers (Author), 2004, Intervention bei sozial unsicherem Verhalten im Schulalltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49796