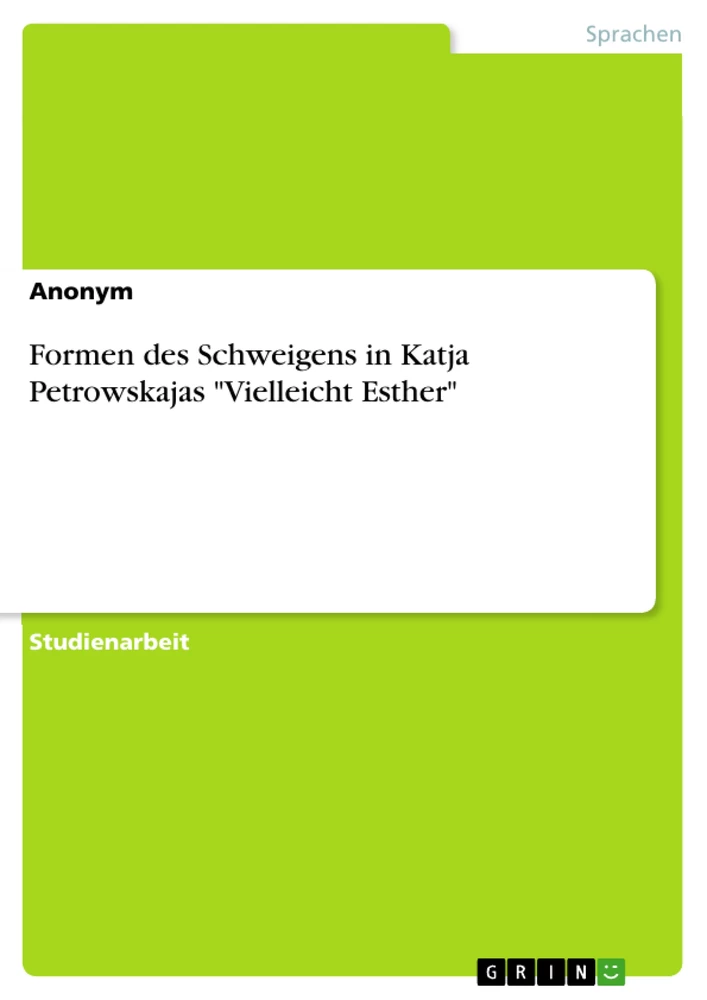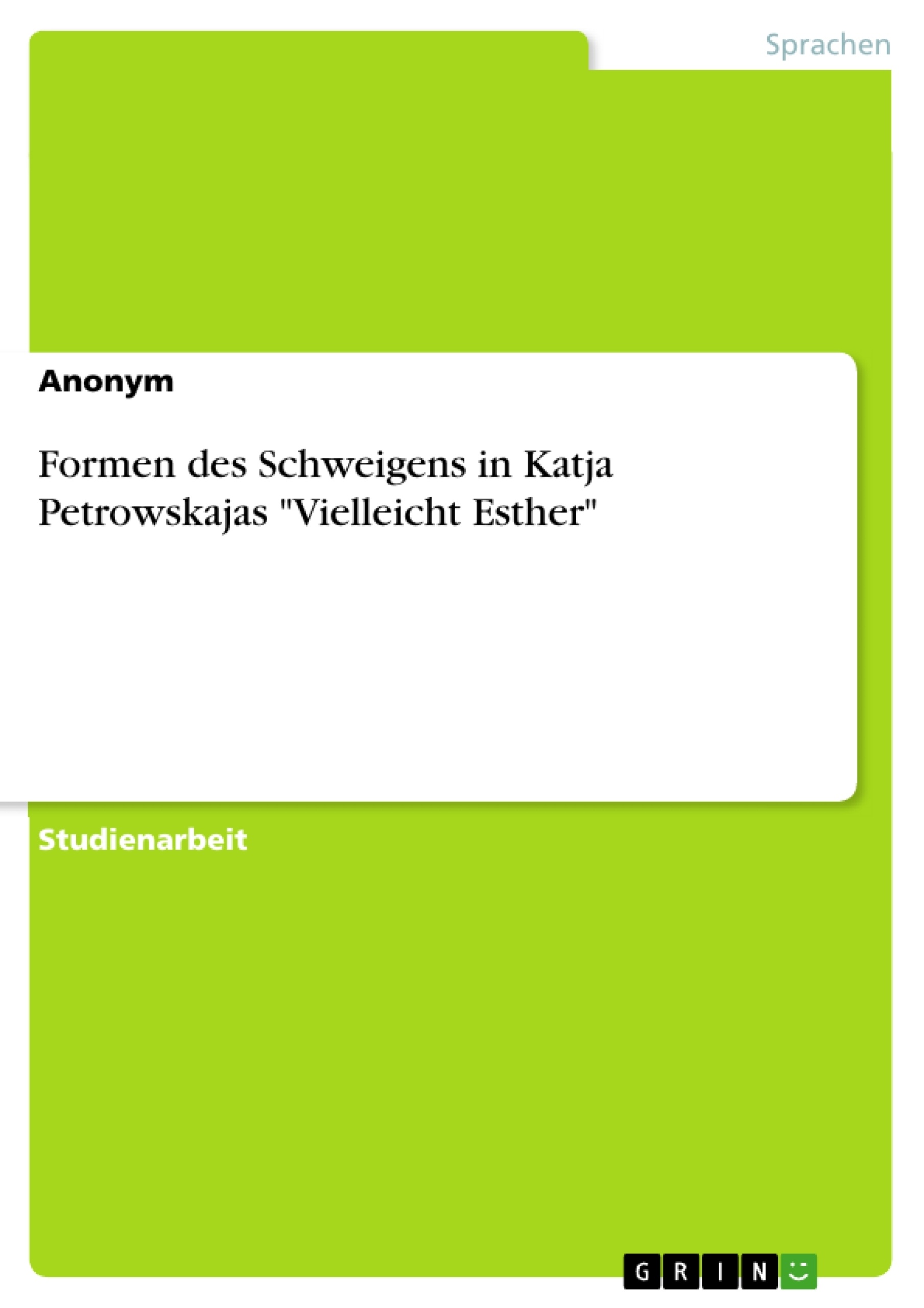„Es wäre mir lieber, ich müsste meine Reisen nicht hier beginnen, in der Ödnis um den Bahnhof“ lautet der erste Satz der Protagonistin in Katja Petrowskajas Roman „Vielleicht Esther“, welcher 2015 erschienen ist. Als hätte sie antizipiert, dass unendlich viele Stationen verschiedenster Arten folgen würden. Und wie vermutet, ist der Berliner Bahnhof nicht die letzte Station auf ihrer langen Reise. In Petrowskajas Roman gibt es viele Stationen. Viele Stationen und lange Reisen finden sich in den Geschichten jedes Einzelnen ihrer Vorfahren und viele musste die Erzählerin selber durchlaufen auf der Suche nach ihrer Vergangenheit. Auch die Stationen des Romans, dargestellt in vielen kleinen Kapiteln, müssen vom Leser durchlaufen werden. So individuell jeder einzelne Vorfahre und Verwandte der Erzählerin bestimmte Stationen im Laufe der Geschichte durchleben und durchleiden musste und so unterschiedlich und anders dazu die Erzählerin ihre Stationen der Suche und Recherche durchläuft im ja, Laufe der Geschichte, der Erzählung, so verbindet doch alle die – über die erzählt wird und die, die erzählt – das zentrale Thema des Erzählens, des Erzähltwerdens, des Sprechens und des Schweigens. So wie sich die Stationen kontinuierlich durch das Leben Petrowskajas und ihrer Vorfahren ziehen, so zieht sich auch insbesondere das Schweigen durch all diese Generationen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen des Schweigens in „Vielleicht Esther“
- Die Protagonistin
- Lida
- Rosa und die Stummen
- Das Schweigen um Babij Jar
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit den verschiedenen Formen des Schweigens im Roman „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja. Die Autorin erforscht, wie dieses Schweigen, das sich über mehrere Generationen erstreckt, die Protagonistin und ihre Nachfolgegeneration beeinflusst.
- Die Auswirkungen des Schweigens nach dem Holocaust auf die Überlebenden und ihre Nachkommen
- Die Suche nach der Vergangenheit und die Schwierigkeiten, über die eigenen Erfahrungen und die Geschichte der Familie zu sprechen
- Die Rolle des Schweigens als Form der Verarbeitung und Bewältigung von Trauma
- Die verschiedenen Arten des Schweigens, z. B. das familiäre Schweigen, das öffentliche Schweigen und das Schweigen der eigenen Person
- Die literarische Umsetzung des Schweigens im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik des Romans ein und stellt die Protagonistin, ihre Familiengeschichte und die Bedeutung des Schweigens im Kontext des Holocaust dar.
Das zweite Kapitel analysiert verschiedene Formen des Schweigens im Roman. Es untersucht das Schweigen der Protagonistin, ihrer Tante Lida, ihrer Großmutter Rosa, die Schule der Taubstummen und das Schweigen um die Massenermordung von Babij Jar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen des Schweigens, des Holocaust, der Familiengeschichte, der Traumaverarbeitung, der Erinnerungskultur und der literarischen Umsetzung des Schweigens im Roman „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja. Die Analyse umfasst verschiedene Arten des Schweigens, wie das familiäre Schweigen, das öffentliche Schweigen und das Schweigen der eigenen Person.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Formen des Schweigens in Katja Petrowskajas "Vielleicht Esther", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443930