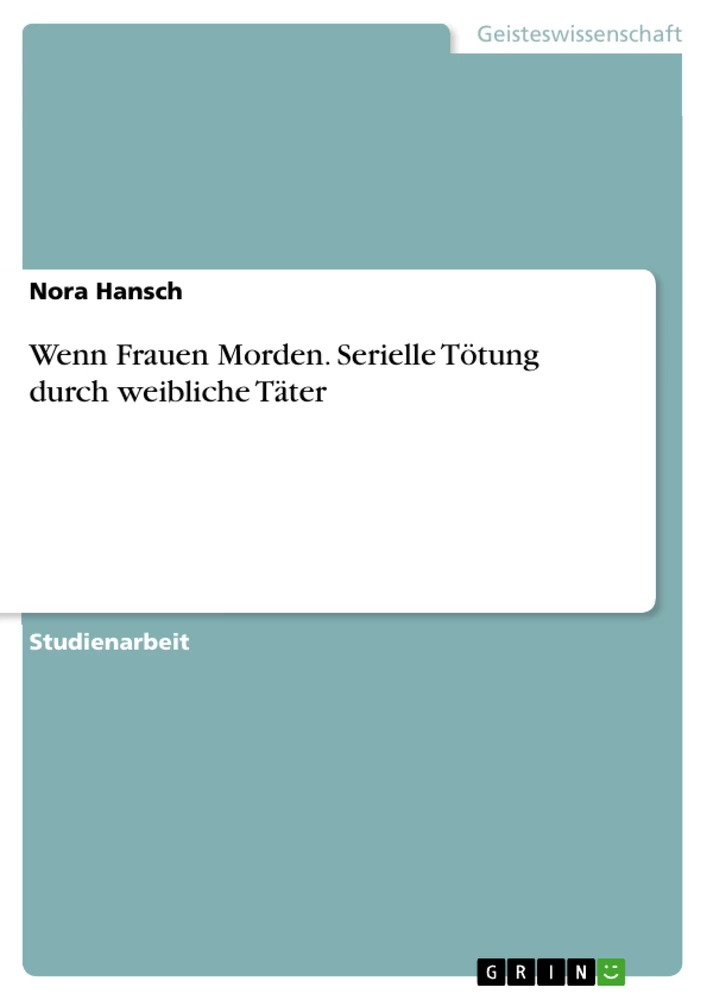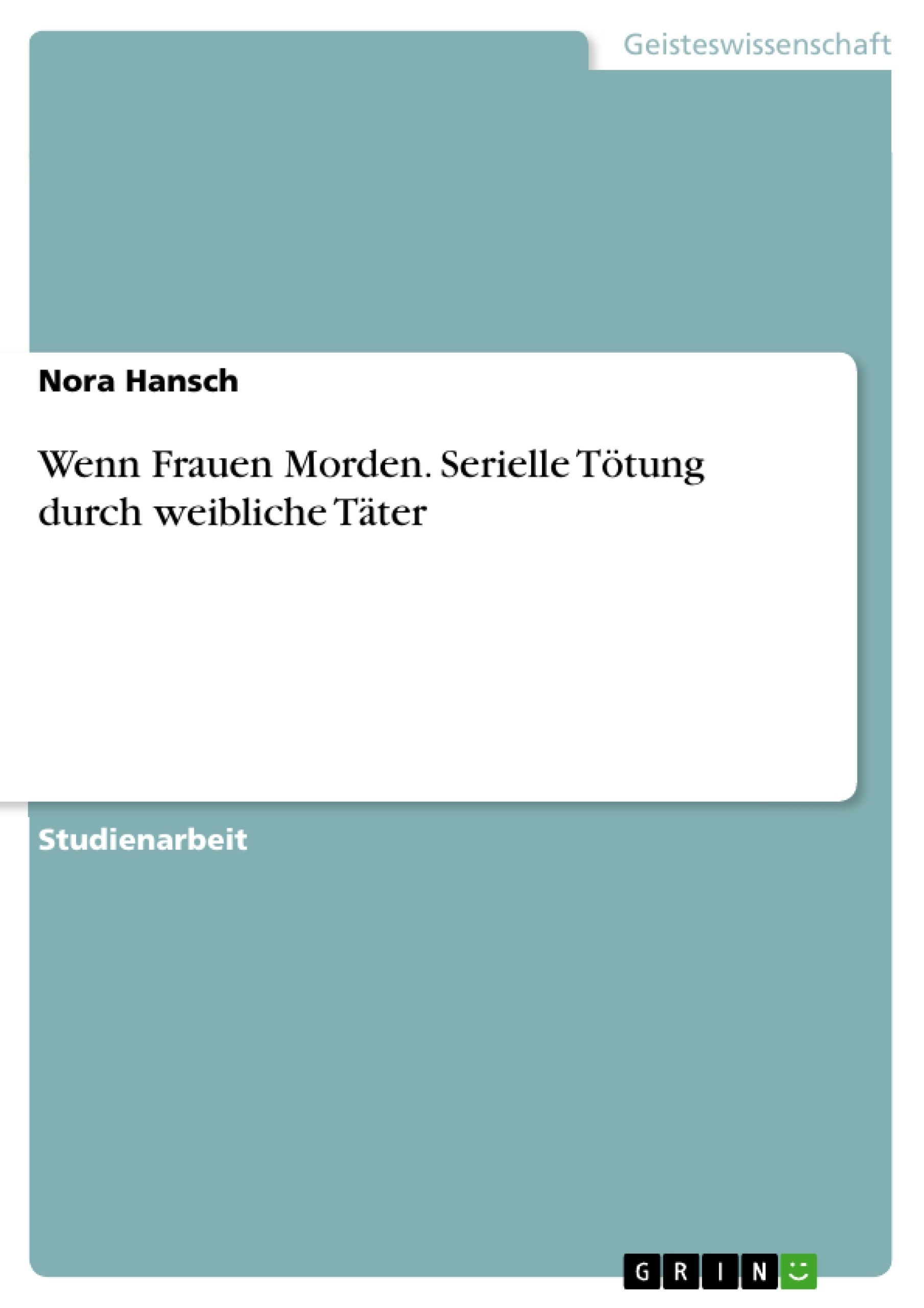Nachdem Aileen Wuornos 1990 verhaftet wurde, sprachen die Medien von der ersten Serienmörderin. Bis zu diesem Zeitpunkt galt Serienmord als männliches Phänomen. Jedoch zeigen die ersten Aufzeichnungen über Serienmorde, dass der erste bekannte Serienmörder eine Frau war – Locusta, die Giftmörderin, welche unter anderem Kaiser Claudius ermordete. Mordende Frauen sind innerhalb der Gesellschaft immer noch ein Tabu Thema, da die allgemeine Annahme weiterhin davon ausgeht, dass Frauen nicht fähig sind zu töten. Da erscheint eine Serienmörderin besonders abwegig.
Die Arbeit untersucht das Phänomen der weiblichen Serienmörderin, indem verschiedene Fälle des Mordens und der Vorghehensweise untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Serienmord
- 3. Typisierung
- 3.1 Schwarze Witwe
- 3.2 Todesengel
- 3.3 Engelmacherin/Babyfarming
- 3.4 Sonderformen
- 4. Mörder Paare
- 5. Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Mördern
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen weiblicher Serienmörderinnen. Ziel ist es, die Motivlagen und Vorgehensweisen weiblicher Serienmörderinnen zu beleuchten und diese mit denen männlicher Serienmörder zu vergleichen. Die Arbeit analysiert den Forschungsstand und die Herausforderungen bei der Definition von Serienmord im Kontext weiblicher Täterinnen.
- Definition und Herausforderungen der Klassifizierung von Serienmord
- Typisierung weiblicher Serienmörderinnen
- Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Serienmördern
- Der geringe Forschungsstand zu weiblichen Serienmördern
- Soziokulturelle Aspekte und gesellschaftliche Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Serienmord trotz der medialen Aufmerksamkeit auf Aileen Wuornos als ein männliches Phänomen betrachtet wird. Sie kritisiert den Mangel an Forschung zu weiblichen Tötungsdelikten in der Fachliteratur und weist darauf hin, dass bestehende Klassifizierungen von Tötungsdelikten weibliche Täterinnen oft ausblenden oder deren Taten unter den Aspekt männlicher Kriminalität subsumieren. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage nach den Motiven und Vorgehensweisen weiblicher Serienmörderinnen und deren Unterschiede zu männlichen Serienmördern.
2. Definition Serienmord: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition für Serienmord zu finden. Es analysiert verschiedene Definitionen aus dem Duden, dem FBI-Handbuch und dem National Institute of Justice, zeigt deren Schwächen auf und diskutiert die Problematik der Abgrenzung von Serienmord zu anderen Formen von Mehrfachmorden. Besonders kritisch wird die Einbeziehung von versuchten Tötungen und die Rolle der Schuldunfähigkeit in der Definition von Serienmord erörtert. Die Kapitel verdeutlicht den komplexen und noch nicht vollständig geklärten Forschungsstand zu diesem Thema.
3. Typisierung: Das Kapitel gibt einen Überblick über die im englischsprachigen Raum verbreitete Typologie von Holmes, die Serienmörder nach Motiven in verschiedene Typen einteilt. Es beschreibt den "visionary killer", der aufgrund von Wahnvorstellungen tötet und den "missionary killer", der aus Hass auf eine bestimmte soziale Gruppe mordet. Die Autorin weist darauf hin, dass diese Typologien auch an ihre Grenzen stoßen, da nicht alle Fälle klar in eine Kategorie einzuordnen sind.
Schlüsselwörter
Serienmord, weibliche Serienmörderinnen, Tötungsdelikte, Kriminalität, Typologie, Motiv, Vergleich, Geschlechterunterschiede, Forschungsstand, Definition, Abgrenzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse weiblicher Serienmörderinnen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen weiblicher Serienmörderinnen. Sie beleuchtet deren Motivlagen und Vorgehensweisen und vergleicht diese mit denen männlicher Serienmörder. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen bei der Definition von Serienmord im Kontext weiblicher Täterinnen und dem geringen Forschungsstand zu diesem Thema.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition Serienmord, Typisierung (inkl. Unterkapitel zu verschiedenen Typen weiblicher Serienmörderinnen), Mörderpaare, Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Mördern und Fazit. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Motivlagen und Vorgehensweisen weiblicher Serienmörderinnen zu analysieren und mit denen männlicher Serienmörder zu vergleichen. Sie untersucht den Forschungsstand und die Schwierigkeiten bei der Definition und Klassifizierung von Serienmord im Hinblick auf weibliche Täterinnen. Soziokulturelle Aspekte und die gesellschaftliche Wahrnehmung werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und die Herausforderungen der Klassifizierung von Serienmord, die Typisierung weiblicher Serienmörderinnen, den Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Serienmördern, den geringen Forschungsstand zu weiblichen Serienmördern und soziokulturelle Aspekte sowie die gesellschaftliche Wahrnehmung.
Wie wird Serienmord definiert?
Das Kapitel "Definition Serienmord" beleuchtet die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition für Serienmord zu finden. Es analysiert verschiedene Definitionen und deren Schwächen, diskutiert die Abgrenzung zu anderen Mehrfachmorden und die Problematik der Einbeziehung von versuchten Tötungen und der Rolle der Schuldunfähigkeit.
Welche Typologien weiblicher Serienmörderinnen werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt die im englischsprachigen Raum verbreitete Typologie von Holmes, welche Serienmörder nach Motiven einteilt (z.B. "visionary killer", "missionary killer"). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Typologien ihre Grenzen haben und nicht alle Fälle eindeutig zuzuordnen sind.
Wie werden weibliche und männliche Serienmörder verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Motivlagen und Vorgehensweisen weiblicher und männlicher Serienmörder. Der Vergleich dient dazu, Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und den Forschungsstand zu diesem Thema zu erweitern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Serienmord, weibliche Serienmörderinnen, Tötungsdelikte, Kriminalität, Typologie, Motiv, Vergleich, Geschlechterunterschiede, Forschungsstand, Definition, Abgrenzung.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen. Die Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt und die Argumentationslinie jedes Kapitels.
- Citar trabajo
- Nora Hansch (Autor), 2017, Wenn Frauen Morden. Serielle Tötung durch weibliche Täter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387168