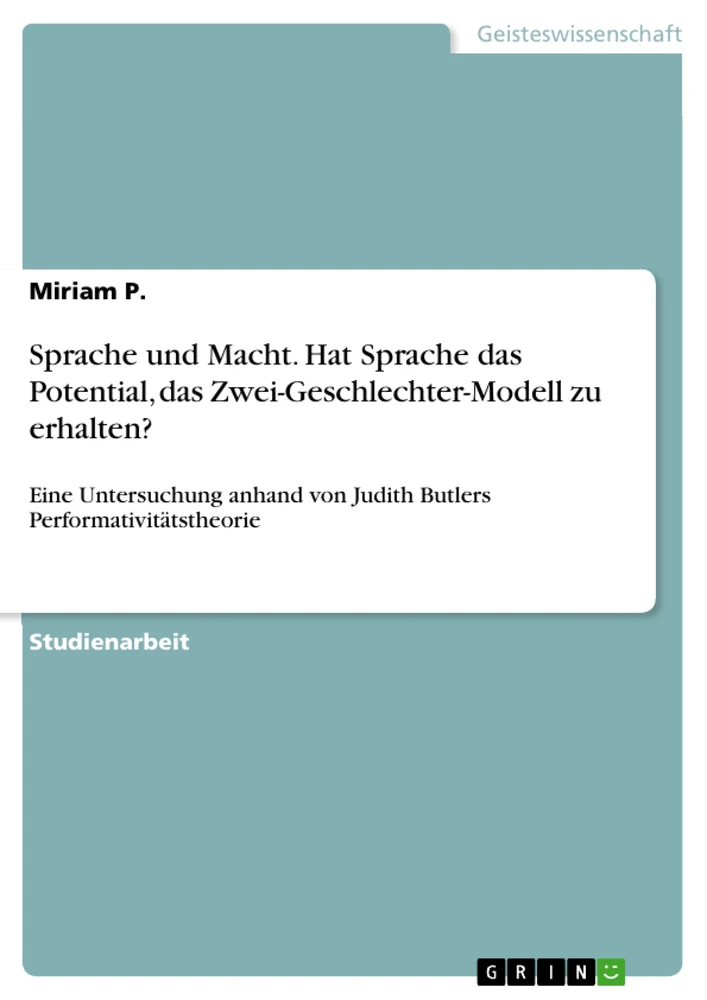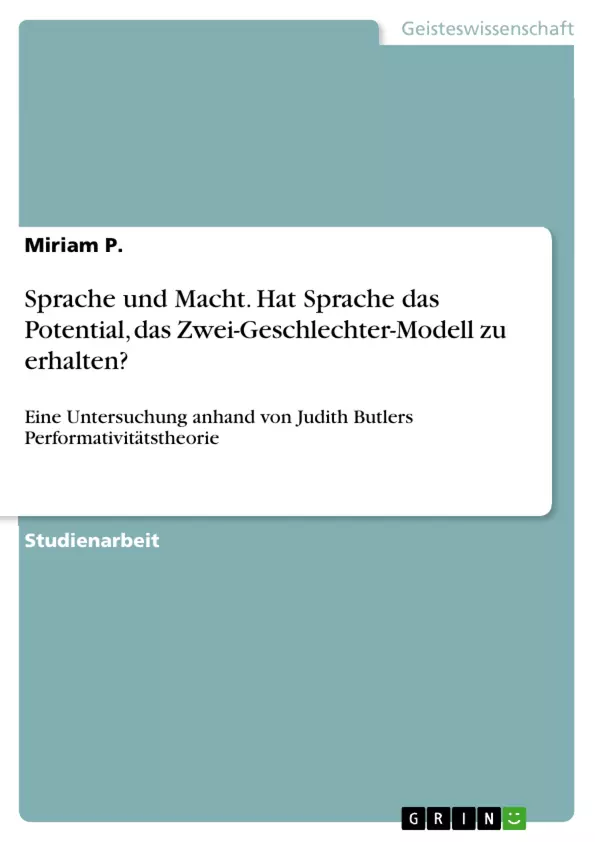Die Hausarbeit untersucht aktuelle Diskurse zum Thema gendergerechter Sprache und diskutiert die verschiedenen Modelle derselben. Die Leitfrage ist dabei, welche Rolle die Sprache in Bezug auf die binäre Geschlechterordnung spielt. Die Arbeit soll demnach zur Klärung der Frage beitragen, ob Sprache ein entscheidender Faktor bei der Konstruktion und Aufrechterhaltung des Zwei-Geschlechter-Modells ist.
Um diese Frage zu klären, sollen zunächst theoretische Ansätze Judith Butlers in Betracht gezogen werden, die sich mit dem Verhältnis von Sprache und Geschlecht befassen. Davon Ausgehend wird die Feministische Linguistik dargelegt und auf ihre Grenzen zur Gendergerechtigkeit hin untersucht.
Den Bogen von der Theorie zur Praxis schlägt die Diskussion möglicher Ansätze gendergerechter Sprechweisen. Zwei konkrete praktische Ansätze gendergerechter Sprache erfuhren in jüngster Vergangenheit mediale Aufmerksamkeit und eröffneten gesellschaftliche Kontroversen. Der Vorschlag von Professx Lann Hornscheidt sowie die Verwendung der femininen Form in einem Dokument der Uni Leipzig sollen deshalb abschließend diskutiert werden. Im Fazit werden die Ergebnisse der Arbeit dargelegt und die anfangs aufgestellte These geklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Konzepte Judith Butlers
- Sprechakttheorie und Performativität
- Körper-Materialität als Effekt Sprachlicher Konstitution von Subjekten
- Geschlecht als performativ hervorgebrachte Subjektkategorie
- Das Subjekt feministischer Theorie: die Kategorie „Frauen“
- Feministische Linguistik im deutschsprachigen Raum
- Grenzen feministischer Linguistik und Ansätze Queerer Linguistik
- Gendergerechte Sprechweisen
- Gendergerechte Sprechweisen, welche die Sichtbarkeit von Frauen zum Ziel haben
- Das generische Femininum
- Binnen-I, Benennung der weiblichen sowie männlichen Form, abwechselnde Benutzung der weiblichen und männlichen Form
- Gendergerechte Sprechweisen, welche die sprachliche Sichtbarmachung von vielfältigen Geschlechtsidentitäten zum Ziel haben
- Sternchen-Form; Unterstrich-Form („Gender-Gap“)
- Dynamischer Unterstrich
- Weitere in Leitfäden vorgeschlagene Formen
- Partizipialformen und neutrale Bezeichnungen
- Schrägstrich; Klammern
- Aktuelle Kontroversen
- Lann Hornscheidts Vorschlag: die „x-Form“
- Das generische Femininum in der Grundordnung der Universität Leipzig
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Sprache im Bezug auf die binäre Geschlechterordnung. Sie untersucht, inwiefern Sprache an der Konstruktion und Aufrechterhaltung des Zwei-Geschlechter-Modells beteiligt ist und wie sie dazu beitragen kann, Geschlechtsidentitäten außerhalb der Binarität sichtbar zu machen.
- Die Relevanz der Sprach- und Gendertheorien Judith Butlers für die Analyse der binären Grammatik der Sprache
- Die Grenzen der feministischen Linguistik und die Notwendigkeit queerer Ansätze zur Entwicklung einer inklusiven Sprache
- Die Möglichkeiten und Herausforderungen der Gendergerechten Sprache im Hinblick auf die Sichtbarkeit von Frauen und vielfältigen Geschlechtsidentitäten
- Die aktuelle Debatte um gendergerechte Sprechweisen und die Kontroversen um Ansätze wie die „x-Form“ und das generische Femininum
- Der Einfluss von Sprache auf die Konstruktion von Geschlecht und die Möglichkeit, Diskriminierung durch sprachliche Veränderung zu bekämpfen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Leitfrage der Arbeit vor. Dabei wird das Beispiel der Begrüßungsformel „Sehr geehrte Damen und Herren“ als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Diskriminierung durch die Nicht-Benennung von Trans* und Inter*-Identitäten herangezogen. Es werden die zentralen Annahmen der Arbeit formuliert, die im Folgenden weiter untersucht werden.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Konzepten Judith Butlers, die für die Arbeit relevant sind. Es werden die Sprechakttheorie und die Performativität der Sprache beleuchtet, sowie Butlers Ansatz der Körper-Materialität als Effekt sprachlicher Konstitution von Subjekten. Schließlich wird Butlers Theorie der Geschlechterkategorien als performativ hervorgebrachte Subjektkategorie erläutert.
Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über die feministische Linguistik im deutschsprachigen Raum. Es werden die wichtigsten Ansätze und Erkenntnisse der feministischen Linguistik vorgestellt und die Grenzen der bisherigen Bemühungen um Gendergerechtigkeit aufgezeigt. Die Diskussion über queer-feministische Ansätze, die die Sichtbarkeit von vielfältigen Geschlechtsidentitäten zum Ziel haben, eröffnet neue Perspektiven.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Thema der gendergerechten Sprechweisen. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die die Sichtbarkeit von Frauen und vielfältigen Geschlechtsidentitäten zum Ziel haben. Dabei werden auch die jeweiligen Vor- und Nachteile und die aktuellen Kontroversen um diese Ansätze beleuchtet.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit zwei konkreten Beispielen für gendergerechte Sprache: Lann Hornscheidts Vorschlag der „x-Form“ und die Verwendung der femininen Form in einem Dokument der Universität Leipzig. Die jeweiligen Argumente und Kontroversen werden diskutiert und kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Sprache, Geschlecht, Gender, Performativität, feministische Linguistik, queere Linguistik, gendergerechte Sprache, Diskriminierung, Trans* und Inter*identitäten, Judith Butler, Sprechakttheorie.
- Quote paper
- Miriam P. (Author), 2016, Sprache und Macht. Hat Sprache das Potential, das Zwei-Geschlechter-Modell zu erhalten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354423