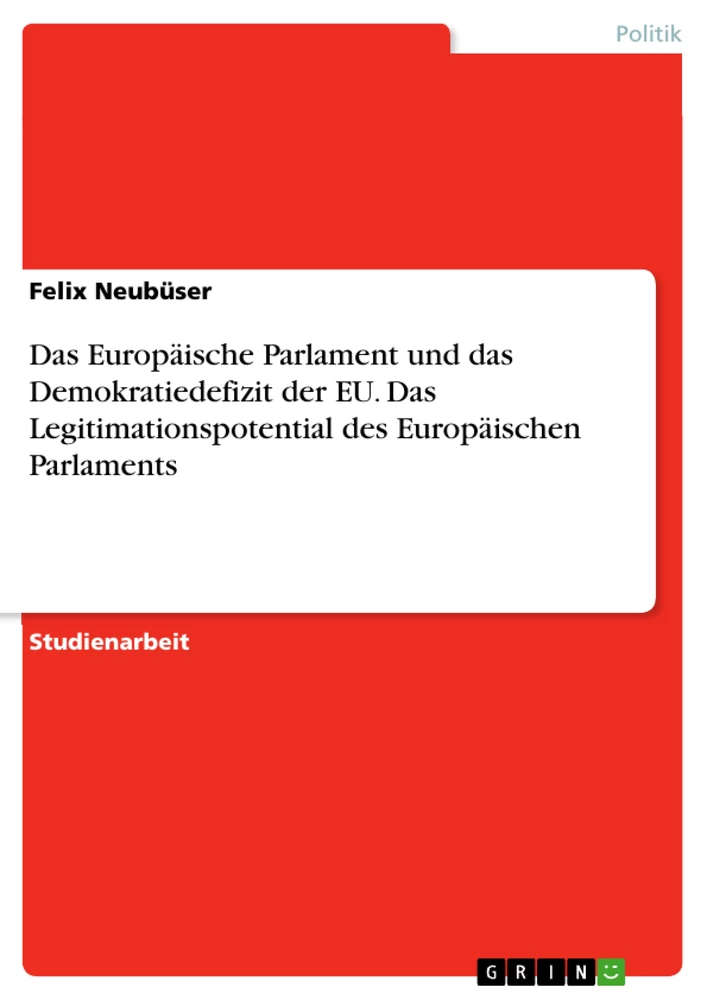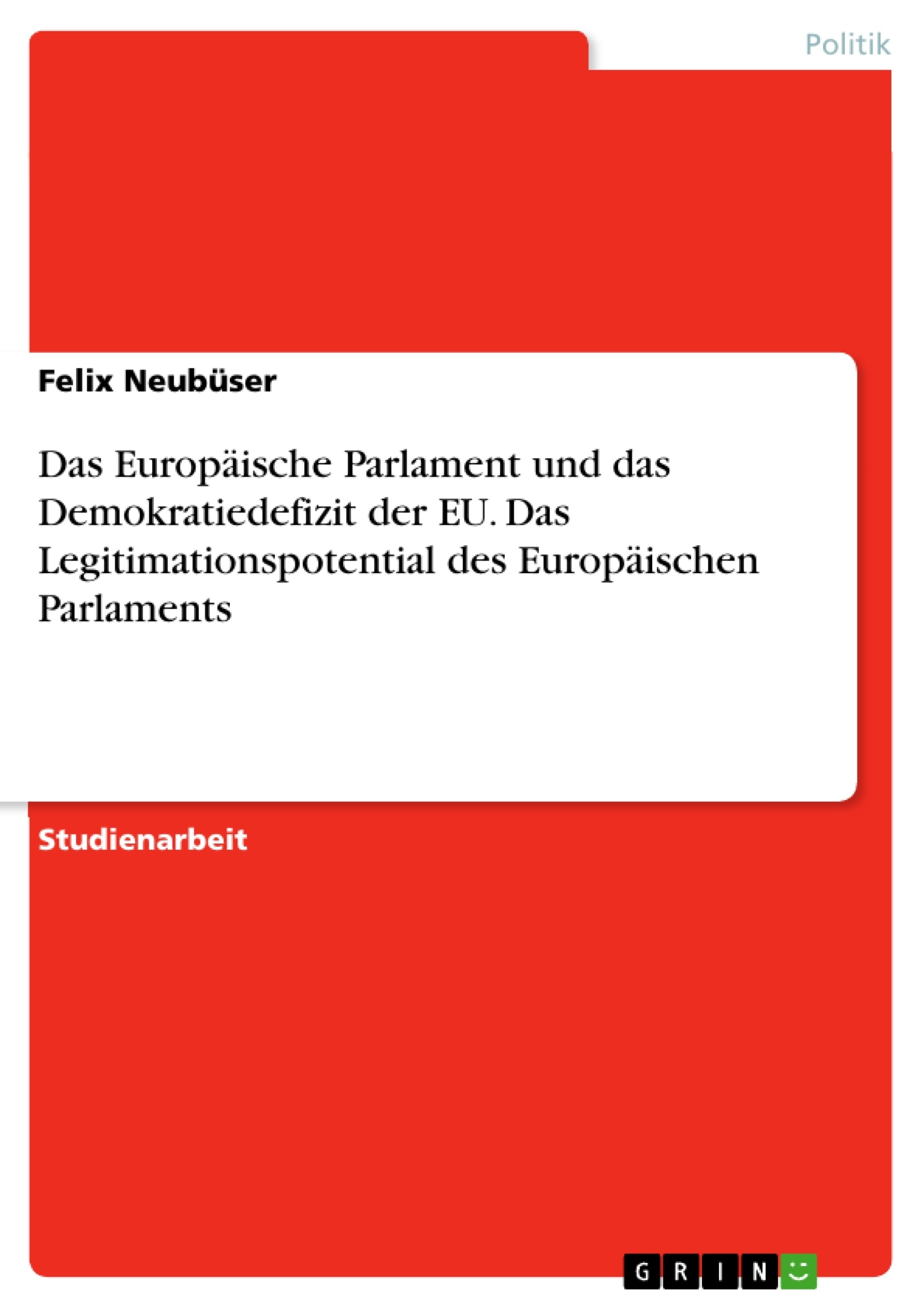Insbesondere in Hinblick auf die fortschreitende europäische Integration kann und muss sich die Europäische Union (EU) dieser Frage nach ihrer demokratischen Legitimität stellen. Denn: Europa rückt zusammen. Immer öfter bekommt der Bürger den langen Arm Brüssels zu spüren. Bestes Beispiel: Die Einführung der einheitlichen Währung, des Euros. Rund 80 Prozent aller auf den Binnenmarkt bezogenen Entscheidungen sind einigen Schätzungen nach mittlerweile in EU bzw. EG-Recht übergegangen.
Ein weiteres Exempel sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofes: Sie sind für die Mitgliedsstaaten bindend und müssen national umgesetzt werden. Ein prominentes Beispiel etwa die Entscheidung zur Gleichstellung von Frauen und Männern beim Zugang zum Dienst in den Streitkräften. In einer Pressemitteilung des EUGH vom 7. Januar 2000 heißt es dazu wörtlich: „Die deutschen Rechtsvorschriften, die Frauen vollständig vom Dienst mit der Waffe ausschließen, verstoßen gegen den gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Gleichheit von Männern und Frauen.“ (EU Homepage 2002) Europäisches Recht bricht nationales Recht, die Bundesrepublik Deutschland musste sich der europäischen Rechtsprechung fügen. In den Mitgliedstaaten steht das Parlament als ein Repräsentationsorgan des Volkes im Mittelpunkt des Legitimationsprozesses von Regierungsgewalt. Es läge also eigentlich nah, dem Europäischen Parlament als einzigem, unmittelbar durch Wahlen vom europäischen Volk direkt legitimierten Organ diese Rolle auf europäischer Ebene zu unterstellen.
Anscheinend nicht, denn nicht nur in der politikwissenschaftlichen Fachliteratur wird zumindest mit Fragezeichen versehen über das sogenannte „Demokratiedefizit der Europäischen Union“ diskutiert (vgl. z.B. Pfetsch 1997, Lord 1998 oder Schmidt 2000). Doch auch in den Medien und nicht zuletzt im Hinblick auf die aktuelle Verfassungsdebatte wird dieses Thema immer wieder kontrovers diskutiert.
Die Legitimation einer zunehmenden Anhäufung von Rechtsetzungsbefugnissen zu Gunsten der EU, (und damit gleichzeitig zu Lasten der nationalen Parlamenten), ist gemessen an den, in den Mitgliedstaaten üblichen demokratiepolitischen Standards, also zumindest streitbar.
In dieser Hausarbeit werde ich mich daher mit folgenden Fragen beschäftigen: Gibt es ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union? Und in diesem Zusammenhang: Welches Legitimationspotential bietet das Europäische Parlament?
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG / FORSCHUNGSFRAGE
- 2. DAS DEMOKRATIEDEFIZIT DER EUROPÄISCHEN UNION
- 2.1. DIE DEMOKRATIETHESE
- 2.2. DIE THESE VOM „DEMOKRATIEDEFIZIT“
- 2.3. FAZIT
- 3. DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT
- 3.1. DIE WAHL DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
- 3.2. KOMPETENZEN IM INSTITUTIONENGEFLECHT UND DEREN GRENZEN
- 3.2.1. KONTROLLFUNKTION
- 3.2.2. GESETZGEBUNGSFUNKTION
- 3.2.2.1. KOMPETENZ BEI DER VERABSCHIEDUNG DES HAUSHALTES
- 3.2.3. WAHLFUNKTION
- 3.2.4. ARTIKULATIONSFUNKTION
- 3.2.5. KOMMUNIKATIONSFUNKTION
- 3.3. FAZIT
- 4. DAS EU-REFORMKONVENT
- 4.1. HINTERGRUND
- 4.2. DIE DEBATTE UM DIE VERFASSUNG DER EU
- 5. DAS LEGITIMATIONSPOTENTIAL DES EP
- 5.1. DERZEITIGES UND ZUKÜNFTIGE LEGITIMATIONSPOTENTIAL
- 5.2. EIGENE STELLUNGNAHME
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Demokratiedefizit der Europäischen Union und das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments. Sie beleuchtet die zunehmende Rechtssetzungsmacht der EU und die damit verbundenen Fragen der demokratischen Legitimität. Die Arbeit analysiert die Kompetenzen des Europäischen Parlaments und dessen Rolle im demokratischen Prozess der EU.
- Das Demokratiedefizit der EU
- Die Wahl und Kompetenzen des Europäischen Parlaments
- Das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments
- Das EU-Reformkonvent und die europäische Verfassung
- Die demokratische Legitimität der EU-Rechtssetzung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung / Forschungsfrage: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der demokratischen Legitimität der EU angesichts ihrer wachsenden Rechtssetzungsmacht. Sie verweist auf die zunehmende Einflussnahme der EU auf das Leben der Bürger, beispielsweise durch die Einführung des Euro und die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes, und hinterfragt die Rolle des Europäischen Parlaments als demokratisch legitimiertes Organ. Die Arbeit skizziert den Forschungsansatz, der sich mit dem Vorwurf eines Demokratiedefizits und dem Legitimationspotential des EP auseinandersetzen wird.
2. Das Demokratiedefizit der Europäischen Union: Dieses Kapitel befasst sich mit dem viel diskutierten „Demokratiedefizit“ der EU. Es analysiert die unterschiedlichen Perspektiven auf die demokratische Legitimität der Union, beleuchtet die Kritik an mangelnder Transparenz und direkter demokratischer Beteiligung und diskutiert die Frage, ob diese Kritik berechtigt ist. Der Fokus liegt auf der Definition und Bewertung des Demokratiedefizits im Kontext der europäischen Integration.
3. Das Europäische Parlament: Dieses Kapitel beschreibt das Europäische Parlament, seine Wahl und seine Kompetenzen im institutionellen Gefüge der EU. Es analysiert die Kontroll-, Gesetzgebungs-, Wahl-, Artikulations- und Kommunikationsfunktionen des Parlaments und deren Grenzen, um seine Rolle im demokratischen Prozess der EU zu verdeutlichen. Die verschiedenen Kompetenzen werden detailliert erklärt und ihre Bedeutung für die Legitimität der EU-Entscheidungen hervorgehoben.
4. Das EU-Reformkonvent: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Hintergrund und die Debatte um das EU-Reformkonvent. Es beleuchtet die Bestrebungen zur Neugestaltung der EU und der möglichen Einführung einer europäischen Verfassung. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Konvents für die Stärkung der demokratischen Legitimität und die Überwindung des vermeintlichen Demokratiedefizits.
5. Das Legitimationspotential des EP: Dieses Kapitel analysiert das gegenwärtige und zukünftige Legitimationspotential des Europäischen Parlaments. Es diskutiert, inwieweit das EP im derzeitigen System als demokratisch legitimiertes Organ angesehen werden kann und wie sein Legitimationspotential gestärkt werden könnte. Hier wird die Frage nach der ausreichenden demokratischen Legitimation und der Rolle des EP als demokratische Kontrollinstanz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Europäisches Parlament, Demokratiedefizit, Europäische Union, Legitimation, Rechtssetzungsmacht, Integration, Reformkonvent, EU-Verfassung, demokratische Legitimität, Kompetenzen, Kontrollfunktion, Gesetzgebung, Wahl, Artikulation, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Demokratiedefizit der EU und das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Demokratiedefizit der Europäischen Union und das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments. Sie analysiert die zunehmende Rechtssetzungsmacht der EU und die damit verbundenen Fragen der demokratischen Legitimität, insbesondere die Rolle des Europäischen Parlaments im demokratischen Prozess der EU.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Demokratiedefizit der EU, die Wahl und Kompetenzen des Europäischen Parlaments, dessen Legitimationspotential, das EU-Reformkonvent und die europäische Verfassung sowie die demokratische Legitimität der EU-Rechtssetzung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung mit Forschungsfrage, Analyse des Demokratiedefizits der EU, Beschreibung des Europäischen Parlaments und seiner Kompetenzen, ein Überblick über das EU-Reformkonvent, eine Analyse des Legitimationspotentials des EP und eine abschließende Zusammenfassung.
Was wird im Kapitel zum Demokratiedefizit der EU untersucht?
Dieses Kapitel analysiert unterschiedliche Perspektiven auf die demokratische Legitimität der EU, beleuchtet Kritik an mangelnder Transparenz und direkter demokratischer Beteiligung und diskutiert die Berechtigung dieser Kritik im Kontext der europäischen Integration.
Welche Aspekte des Europäischen Parlaments werden behandelt?
Das Kapitel zum Europäischen Parlament beschreibt dessen Wahl, seine Kompetenzen (Kontroll-, Gesetzgebungs-, Wahl-, Artikulations- und Kommunikationsfunktionen) im institutionellen Gefüge der EU und deren Grenzen. Es verdeutlicht die Rolle des Parlaments im demokratischen Prozess der EU.
Was ist der Fokus des Kapitels zum EU-Reformkonvent?
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Hintergrund und die Debatte um das EU-Reformkonvent, beleuchtet Bestrebungen zur Neugestaltung der EU und die mögliche Einführung einer europäischen Verfassung und deren Bedeutung für die Stärkung der demokratischen Legitimität.
Wie wird das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments analysiert?
Das Kapitel analysiert das gegenwärtige und zukünftige Legitimationspotential des EP. Es diskutiert, inwieweit das EP als demokratisch legitimiertes Organ angesehen werden kann und wie sein Legitimationspotential gestärkt werden könnte, sowie die Frage nach ausreichender demokratischer Legitimation und der Rolle des EP als demokratische Kontrollinstanz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäisches Parlament, Demokratiedefizit, Europäische Union, Legitimation, Rechtssetzungsmacht, Integration, Reformkonvent, EU-Verfassung, demokratische Legitimität, Kompetenzen, Kontrollfunktion, Gesetzgebung, Wahl, Artikulation, Kommunikation.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie lässt sich die demokratische Legitimität der EU angesichts ihrer wachsenden Rechtssetzungsmacht beurteilen, insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Europäischen Parlaments?
- Citar trabajo
- Felix Neubüser (Autor), 2002, Das Europäische Parlament und das Demokratiedefizit der EU. Das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3470