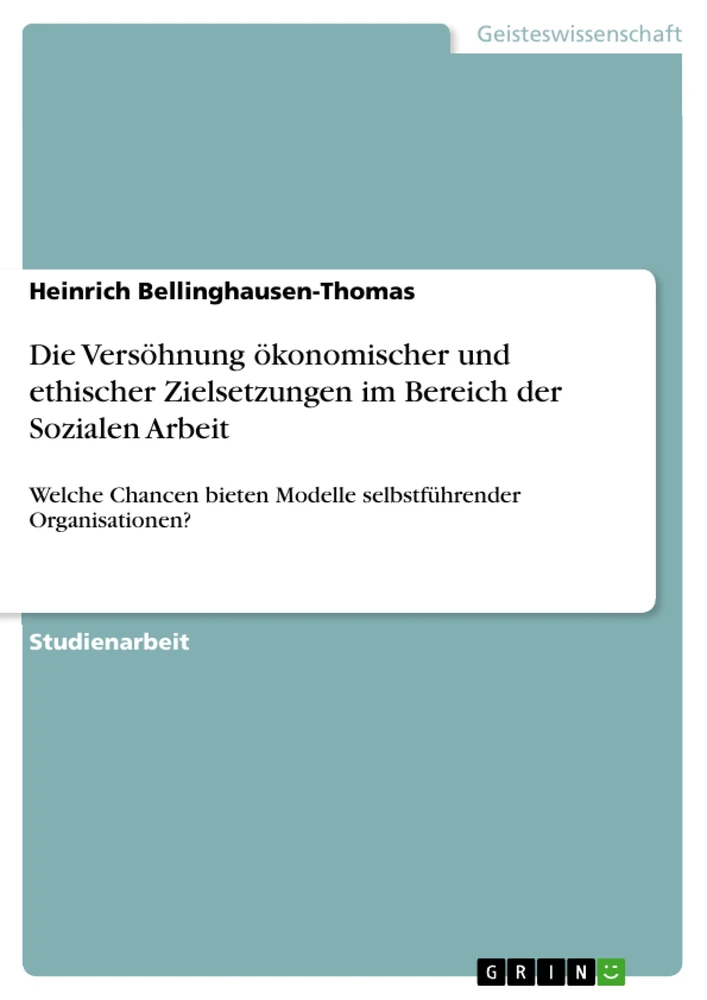Die vorliegende Arbeit skizziert zunächst Erwartungen und Bedarfe westlicher Gesellschaften an sozialwirtschaftliche Konzepte, an die umsetzenden Organisationen und an deren organisationale Strukturen in Bezug auf die Qualität ihrer Leistungen und ihre ökonomischen wie ethischen Prinzipien.
Die sich daran anschließende evolutionäre Einordnung bietet die Möglichkeit, die Entwicklungsstufen traditioneller konformistischer, moderner leistungsorientierter und postmoderner pluralistischer Organisationsformen sowie deren jeweils leitende Paradigmen mit organisationstheoretischen Analogien abzugleichen und in Bezug auf die Einbettung in aktuelle Hierarchiesysteme von Staat und Wohlfahrtsorganisationen zukunftsfähige Perspektiven zu erarbeiten.
Diesbezügliche Möglichkeiten selbstführender Organisationsformen werden schließlich am Beispiel der niederländischen „Buurtzorg“ aufgezeigt, welche ohne Hierarchien, ohne Vorgesetzte, mit Vertrauen in statt Kontrolle von Mitarbeiter_innen äußerst erfolgreich im Bereich ambulanter Pflege arbeiten.
Die jene umfangreichen Themenkomplexe verbindenden Leitfragen dieser Arbeit lauten: Sind ökonomische und ethische Zielsetzungen im Bereich Sozialer Arbeit vereinbar? Welche organisationalen Bedingungen wären hierfür zu erfüllen? Wie realistisch ist eine Umsetzung vor dem Hintergrund der deutschen Wohlfahrtsorganisations-Landschaft?
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialwirtschaftliche Bedarfe moderner westlicher Gesellschaften
- Qualität sozialer Leistungen
- Ökonomische Prinzipien in der Sozialwirtschaft
- Ethische Standards
- Vereinbarkeit von Ökonomie und Ethik in SWO
- Organisationsparadigmen im Wandel der Zeit
- Evolutionäre Stufen von Organisationen und deren Paradigmen
- Das traditionelle konformistische Paradigma
- Das moderne leistungsorientierte Paradigma
- Das postmoderne pluralistische Paradigma
- Analogien zu Organisationstheorien
- Rationale Ansätze
- Human-Ressource Ansatz
- Strukturfunktionalistische und Systemische Ansätze
- Perspektiven organisationaler Strukturen
- Merkmale selbstführender Organisationsformen
- Selbstführung in sozialen Organisationen am Beispiel BUURTZORG
- Keine Hierarchien, keine Vorgesetzten
- Stark eingeschränkte Unterstützungsfunktionen
- Vertrauen vs. Kontrolle
- Kein Organigramm, keine Stellenbeschreibung
- Entscheidungen
- Chancen der Übertragung auf deutsches Sozial- und Wohlfahrtssystem
- Fazit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Spannungen und Vermittlungen zwischen ethischen und ökonomischen Zielsetzungen in der Sozialen Arbeit, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Fokus geraten sind. Sie beleuchtet die Erwartungen und Bedarfe westlicher Gesellschaften an soziale Dienstleistungen, die umsetzenden Organisationen und ihre Strukturen hinsichtlich Qualität, Wirtschaftlichkeit und ethischen Prinzipien. Des Weiteren untersucht die Arbeit die Entwicklung von Organisationsformen und Paradigmen und erörtert die Möglichkeiten selbstführender Organisationsformen als Chance zur Versöhnung von Ökonomie und Ethik.
- Qualität sozialer Leistungen und die Erwartungen an soziale Organisationen
- Die Vereinbarkeit von ökonomischen und ethischen Zielsetzungen in der Sozialwirtschaft
- Evolutionäre Entwicklungsstufen von Organisationsformen und deren Paradigmen
- Die Rolle von Hierarchien und Selbstführung in sozialen Organisationen
- Chancen und Herausforderungen der Übertragung selbstführender Organisationsformen auf das deutsche Sozial- und Wohlfahrtssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um die Versöhnung von ökonomischen und ethischen Zielen in der Sozialen Arbeit vor und zeigt die Notwendigkeit eines kritischen Diskurses über Organisationsstrukturen und -modelle auf. Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedarfe moderner westlicher Gesellschaften an sozialwirtschaftlichen Konzepten, Organisationen und deren Leistungen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Qualität sozialer Leistungen und den unterschiedlichen Perspektiven von Leistungserbringern, Leistungsempfängern, Trägern und Politik.
Kapitel 3 setzt sich mit der Entwicklung von Organisationsparadigmen im Wandel der Zeit auseinander. Es beschreibt das traditionelle konformistische Paradigma, das moderne leistungsorientierte Paradigma und das postmoderne pluralistische Paradigma und stellt Analogien zu organisationstheoretischen Ansätzen her. Kapitel 4 betrachtet die Merkmale selbstführender Organisationsformen und untersucht das Beispiel von "Buurtzorg" in den Niederlanden, ein Unternehmen im Bereich der ambulanten Pflege, das ohne Hierarchien und Vorgesetzte arbeitet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: soziale Arbeit, Sozialwirtschaft, Selbstführung, Organisationsparadigmen, ökonomische Prinzipien, ethische Standards, Qualität sozialer Leistungen, Hierarchien, Vertrauen vs. Kontrolle, Buurtzorg.
Häufig gestellte Fragen
Sind Ökonomie und Ethik in der Sozialen Arbeit vereinbar?
Diese Leitfrage untersucht die Spannung zwischen wirtschaftlicher Effizienz und moralischen Standards in Wohlfahrtsorganisationen.
Was ist das Besondere am niederländischen Modell „Buurtzorg“?
Buurtzorg arbeitet in der ambulanten Pflege ohne Hierarchien und Vorgesetzte, basierend auf Vertrauen in die Mitarbeiter statt Kontrolle.
Wie haben sich Organisationsparadigmen im Laufe der Zeit verändert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen traditionellen konformistischen, modernen leistungsorientierten und postmodernen pluralistischen Organisationsformen.
Was bedeutet „Selbstführung“ in sozialen Organisationen?
Selbstführung bedeutet, dass Teams eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, ohne auf klassische Organigramme oder Stellenbeschreibungen angewiesen zu sein.
Kann das Buurtzorg-Modell auf Deutschland übertragen werden?
Die Arbeit analysiert die Chancen und Hürden einer Übertragung auf die deutsche Wohlfahrtslandschaft und deren Hierarchiesysteme.
- Citar trabajo
- Heinrich Bellinghausen-Thomas (Autor), 2016, Die Versöhnung ökonomischer und ethischer Zielsetzungen im Bereich der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342533