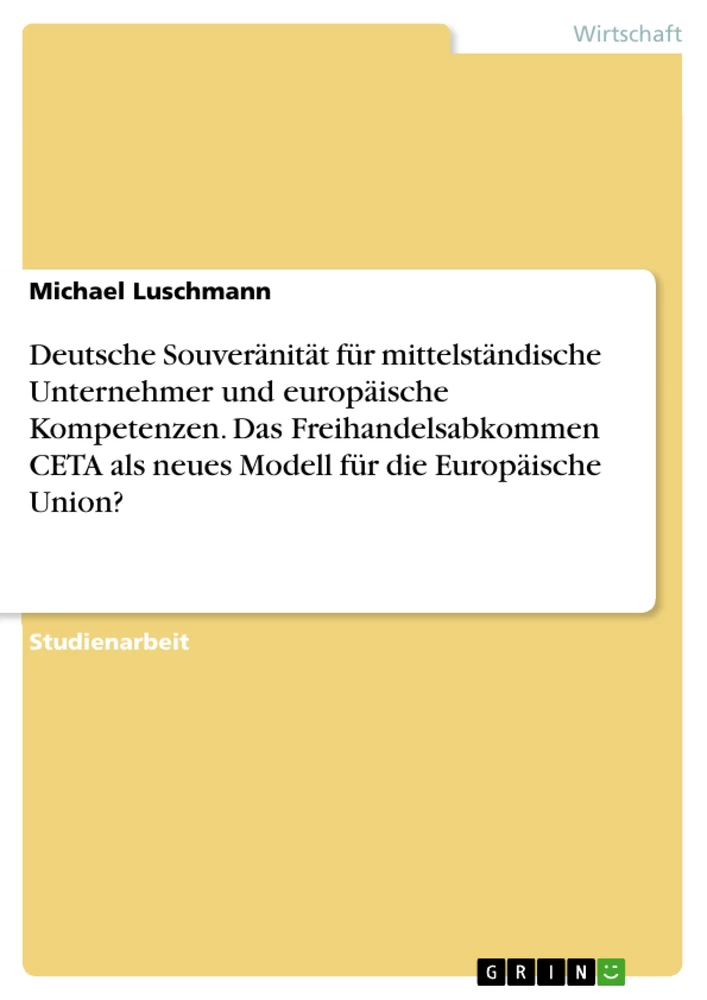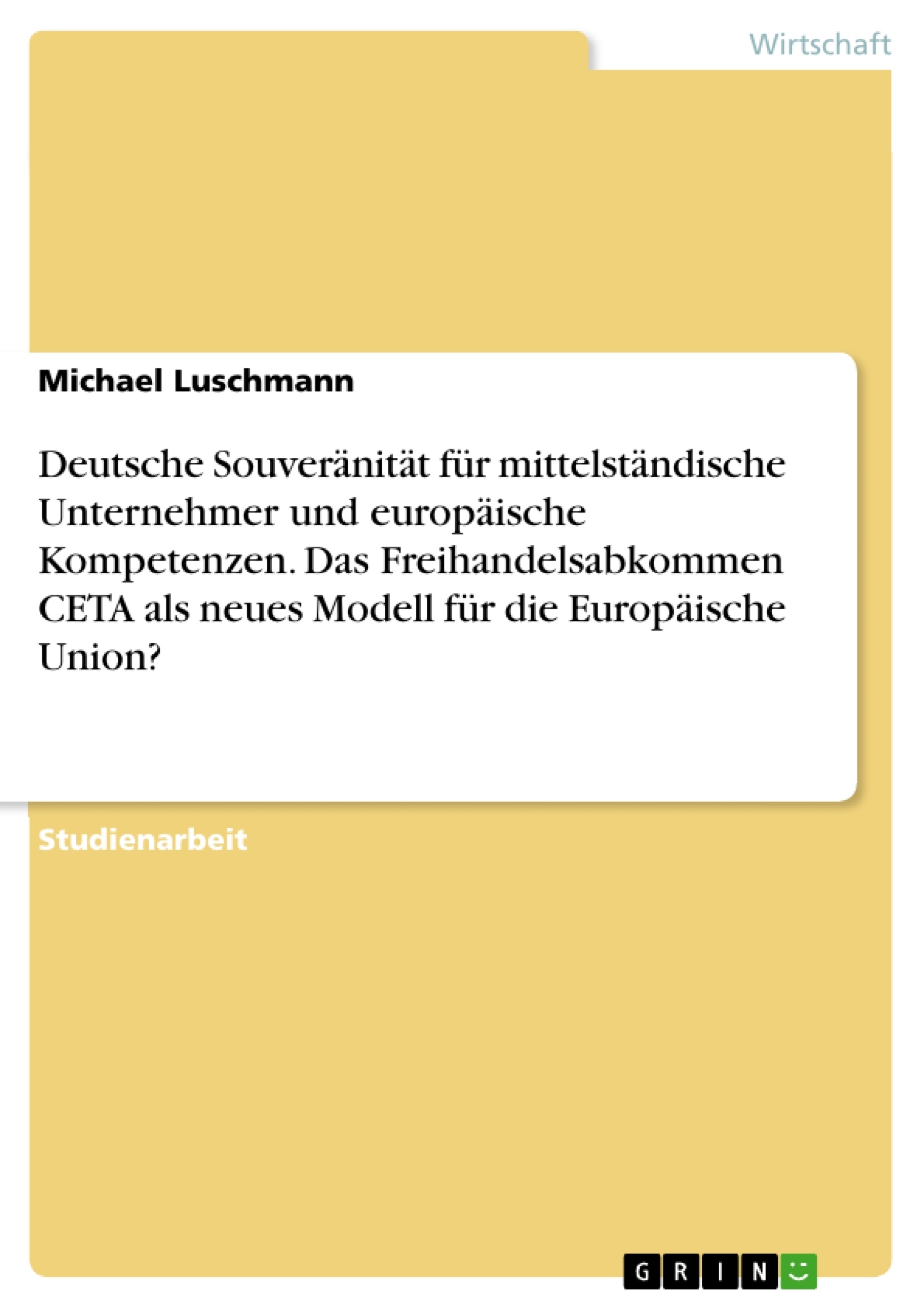Auf beiden Seiten des Atlantiks gingen Bürger und Bürgerinnen in letzter Zeit auf die Straßen um gegen das geplante Handels- und Investitionsschutzabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), über welches die Europäische Union (EU) und die USA derzeit verhandeln, zu protestieren.
Doch nur wenige wissen, dass die EU mit Kanada die Verhandlungen über ein ähnliches Wirtschafts- und Handelsabkommen, dem sogenannten CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), 2014 vorher bereits zum Abschluss gebracht hat. CETA ist damit das erste Investitionsschutzabkommen, das direkt von der EU Kommission verhandelt wurde und zwischen der EU und Kanada abgeschlossen werden wird. Die Kompetenzen zur Aushandlung von Investitionsschutzabkommen sind erst seit 2009 mit dem Vertrag von Lissabon von den Mitgliedstaaten auf die EU übergegangen. Bereits seit 2009 verhandelte die EU mit der kanadische Regierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Derzeit befindet es sich noch im Stadium der juristischen Überprüfung („legal scrubbing“). Da der rechtliche Rahmen für dieses Freihandelsabkommens neuen Typs gerade im Hinblick auf die Vertragsschlusskompetenz des Abkommens und die Investor-Staat-Schiedsgerichtbarkeit derzeit noch für Konfliktpotential zwischen den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission sorgt, rechnet das Bundeswirtschaftsministerium nicht vor 2017 mit dem Inkrafttreten von CETA.
Dabei kommt CETA eine Art Modellcharakter zu, denn CETA wird oftmals auch als „Blaupause“ für TTIP angesehen. Da die Zuständigkeit der EU relativ neu ist, muss sie sich erst eine eigenständige Reputation aufbauen. Es stellt sich die Frage ob es notwendig ist in einem europäisch nordamerikanischen Freihandelsabkommen Regelungen zum Investitionsschutz aufzunehmen, da willkürliche Behandlung und Enteignung in demokratischen Ländern mit unabhängiger Gerichtsbarkeit wie in Kanada oder den USA nicht drohen. Da dies eher in Ländern mit diktatorischen Zügen eine Rolle spielt, geht es bei CETA um die Präzedenzwirkung für entsprechende Verhandlungen mit anderen Ländern, die über kurz oder lang folgen dürften. CETA (und auch TTIP) schaffen aus politökonomischer Sicht sehr viel bessere Ausgangsbedingungen und Erfolgsaussichten, soweit es um künftige Verhandlungen mit Schwellenländern geht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung und Hintergrund
- II. Regelungen des CETA: Inhalt und Verfahren
- 1. Inhalt, Ziele und Wirkungen des CETA-Handelsvertrags
- 2. Investitionsschutz als wesentlicher Bestandteil des CETA
- III. Kompetenz
- 1. Hintergrund und Brisanz der Kompetenzfrage
- 2. Vertragsschlusskompetenz bei Freihandelsabkommen im Allgemeinen
- a) Grundprinzipien der Kompetenzordnung nach Art. 5 EUV
- b) Die Kompetenzarten
- 3. Vertragsschlusskompetenz bei CETA: Stellt CETA ein gemischtes Abkommen dar oder hat die EU die ausschließliche Kompetenz?
- a) Analyse der ausschließlichen Kompetenz der EU im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik
- aa) „EU-only“-Abkommen
- bb) Gemischtes Abkommen
- b) Analyse der relevanten Bestimmungen des CETA
- IV. Investorenschutz durch Schiedsgerichte: Verzicht auf Souveränität oder mehr Sicherheit?
- V. Zusammenfassung und Wertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) und dessen Auswirkungen auf die deutsche Souveränität mittelständischer Unternehmen sowie die europäischen Kompetenzen. Die Arbeit analysiert den Inhalt und die Verfahren von CETA, insbesondere den Investitionsschutz, und befasst sich eingehend mit der Kompetenzfrage im Kontext des Abkommens. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bewertung des Investorenschutzes durch Schiedsgerichte.
- Analyse des Inhalts und der Ziele von CETA
- Bewertung des Investitionsschutzes innerhalb von CETA
- Untersuchung der Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedsstaaten bezüglich CETA
- Auswirkungen von CETA auf die deutsche Souveränität mittelständischer Unternehmen
- Bewertung des Investorenschutzes durch Schiedsgerichte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung und Hintergrund: Diese Einleitung liefert den Kontext der Arbeit, indem sie die Relevanz des internationalen Investitionsschutzes, Wirtschaftssanktionen und Handels- und Investitionskooperationen im Kontext des CETA-Abkommens erläutert. Sie führt in die Problematik der deutschen Souveränität mittelständischer Unternehmen und der europäischen Kompetenzen ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit.
II. Regelungen des CETA: Inhalt und Verfahren: Dieses Kapitel beleuchtet den Inhalt, die Ziele und die voraussichtlichen Wirkungen des CETA-Handelsvertrags. Es analysiert den Investitionsschutz als zentralen Bestandteil des Abkommens und untersucht dessen Auswirkungen auf die beteiligten Wirtschaftsakteure. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit CETA ein neues Modell für die Europäische Union darstellt.
III. Kompetenz: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Kompetenzfrage im Zusammenhang mit CETA. Es analysiert den Hintergrund und die Brisanz dieser Frage, untersucht die Vertragsschlusskompetenz bei Freihandelsabkommen allgemein und geht detailliert auf die Kompetenzverteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten bei CETA ein. Es wird untersucht, ob CETA als gemischtes Abkommen oder als Abkommen mit ausschließlicher EU-Kompetenz einzustufen ist.
IV. Investorenschutz durch Schiedsgerichte: Verzicht auf Souveränität oder mehr Sicherheit?: Dieses Kapitel analysiert den Investorenschutz durch Schiedsgerichte im Rahmen von CETA. Es diskutiert die Vor- und Nachteile dieses Systems und bewertet die potenziellen Auswirkungen auf die nationale Souveränität. Es untersucht, ob der Mechanismus mehr Sicherheit für Investoren bietet oder einen Verzicht auf Souveränität darstellt.
Schlüsselwörter
CETA, Freihandelsabkommen, Investitionsschutz, Schiedsgerichte, EU-Kompetenz, nationale Souveränität, mittelständische Unternehmen, Handelspolitik, gemeinsame Handelspolitik, gemischtes Abkommen.
Häufig gestellte Fragen zum CETA-Abkommen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) mit Fokus auf dessen Auswirkungen auf die deutsche Souveränität mittelständischer Unternehmen und die europäischen Kompetenzen. Schwerpunkte sind der Inhalt und die Verfahren von CETA, insbesondere der Investitionsschutz, die Kompetenzfrage und die Bewertung des Investorenschutzes durch Schiedsgerichte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse des Inhalts und der Ziele von CETA, Bewertung des Investitionsschutzes, Untersuchung der Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedsstaaten bezüglich CETA, Auswirkungen von CETA auf die deutsche Souveränität mittelständischer Unternehmen und Bewertung des Investorenschutzes durch Schiedsgerichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung und Hintergrund, Regelungen des CETA: Inhalt und Verfahren, Kompetenz, Investorenschutz durch Schiedsgerichte und Zusammenfassung und Wertung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des CETA-Abkommens.
Was wird im Kapitel "Regelungen des CETA: Inhalt und Verfahren" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Inhalt, die Ziele und die voraussichtlichen Wirkungen des CETA-Handelsvertrags. Es analysiert den Investitionsschutz als zentralen Bestandteil und dessen Auswirkungen auf die beteiligten Wirtschaftsakteure. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit CETA ein neues Modell für die Europäische Union darstellt.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels zur Kompetenzfrage?
Das Kapitel "Kompetenz" befasst sich eingehend mit der Kompetenzverteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten bezüglich CETA. Es analysiert, ob CETA als gemischtes Abkommen oder als Abkommen mit ausschließlicher EU-Kompetenz einzustufen ist, und untersucht die Vertragsschlusskompetenz bei Freihandelsabkommen allgemein.
Wie wird der Investorenschutz durch Schiedsgerichte bewertet?
Das Kapitel zum Investorenschutz analysiert die Vor- und Nachteile des Schiedsgerichts-Systems im Rahmen von CETA und bewertet die potenziellen Auswirkungen auf die nationale Souveränität. Es untersucht, ob der Mechanismus mehr Sicherheit für Investoren bietet oder einen Verzicht auf Souveränität darstellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: CETA, Freihandelsabkommen, Investitionsschutz, Schiedsgerichte, EU-Kompetenz, nationale Souveränität, mittelständische Unternehmen, Handelspolitik, gemeinsame Handelspolitik, gemischtes Abkommen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Zusammenfassung und Wertung (Kapitel V) fasst die Ergebnisse der einzelnen Kapitel zusammen und bietet eine abschließende Bewertung des CETA-Abkommens hinsichtlich der behandelten Themen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem CETA-Abkommen, internationalem Investitionsschutz, EU-Kompetenzen und der Souveränität mittelständischer Unternehmen befassen. Sie ist insbesondere für Wissenschaftler, Studierende und politische Entscheidungsträger von Interesse.
Wo finde ich mehr Informationen zum CETA-Abkommen?
Weitere Informationen zum CETA-Abkommen finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission und anderen einschlägigen Informationsquellen.
- Citar trabajo
- Michael Luschmann (Autor), 2016, Deutsche Souveränität für mittelständische Unternehmer und europäische Kompetenzen. Das Freihandelsabkommen CETA als neues Modell für die Europäische Union?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341450