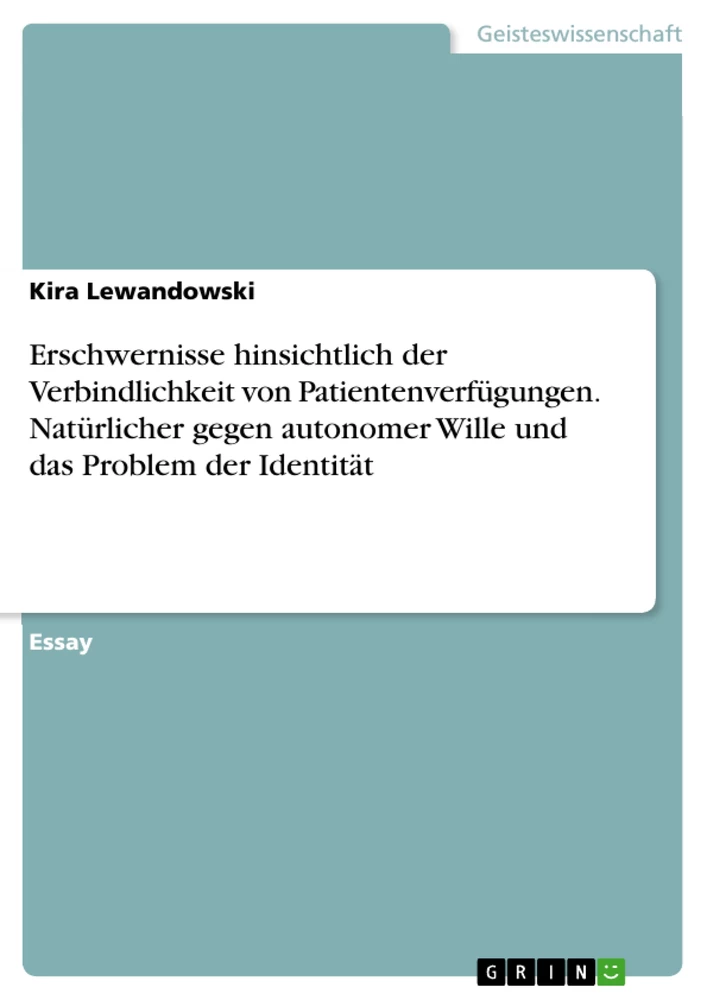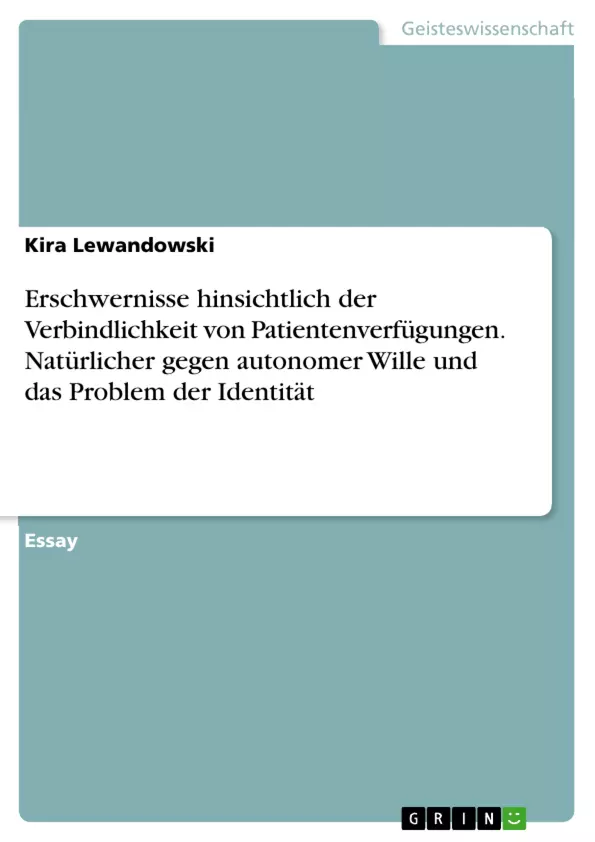Patientenverfügungen sollen ihren Verfasser insoweit schützen, als dass später nicht gegen seinen Willen gehandelt wird. Es gibt Argumente, durch die die Bindungswirkung solcher Verfügungen in Frage gestellt werden kann.
Die Grundlage des Essays ist der Text "Zur Frage der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen" von Reinhard Merkel aus dem Jahr 2004 aus der Zeitschrift "Ethik in der Medizin". Es erfolgt die Darstellung des sogenannten natürlichen und des autonomen Willens. Ebenso ist der Begriff der Identität nach John Locke in "Versuch über den menschlichen Verstand", von Relevanz.
Inhaltsverzeichnis
- Natürlicher gegen autonomer Wille und das Problem der Identität – Erschwernisse hinsichtlich der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
- Priorität des natürlichen Willens?
- Veränderte Überzeugungen
- Der emotionale Faktor
- Das Identitätsproblem
- John Lockes Definition der Identität
- Das Prinzip des Notstandes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen im Spannungsfeld zwischen autonomem und natürlichem Willen. Sie analysiert die jeweiligen Argumente für und gegen die unbedingte Bindungswirkung von Patientenverfügungen und beleuchtet das zentrale Problem der Identität des Patienten zum Zeitpunkt der Verfügung und zum Zeitpunkt der Behandlung.
- Autonomer vs. natürlicher Wille
- Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
- Problem der Identität im Laufe der Zeit
- Konflikt zwischen Patientenwohl und Autonomie
- Anwendung des Prinzips des Notstandes
Zusammenfassung der Kapitel
Natürlicher gegen autonomer Wille und das Problem der Identität – Erschwernisse hinsichtlich der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Priorität des autonomen gegenüber dem natürlichen Willen im Kontext von Patientenverfügungen. Es werden zwei gegensätzliche Positionen vorgestellt: die Befürworter der unbedingten Bindungswirkung und ihre Gegner, die die Patientenverfügung als Indiz, aber nicht als absolutes Gesetz ansehen. Der Konflikt zwischen der Achtung der Autonomie des Patienten und der Berücksichtigung seines aktuellen Willens wird herausgestellt. Die Arbeit basiert auf Reinhard Merkels Text "Zur Frage der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen".
Priorität des natürlichen Willens?: Dieses Kapitel vertieft die Frage nach dem Vorrang des natürlichen Willens. Es argumentiert, dass die uneingeschränkte Priorität des natürlichen Willens die Patientenverfügung ad absurdum führen würde, da diese ja gerade für den Fall der Willensunfähigkeit erstellt wird. Das Kapitel verwendet das Beispiel von Patient A, der sich gegen lebenserhaltende Maßnahmen ausgesprochen hat, aber im aktuellen Zustand Anzeichen von Lebensfreude zeigt. Die Schwierigkeit, den tatsächlichen Willen des Patienten eindeutig zu identifizieren, wird hervorgehoben. Der Versuch, den natürlichen Willen konsequent als Entscheidungskriterium zu verwenden, wird als problematisch dargestellt, insbesondere in Situationen, in denen der natürliche Wille den Tod begünstigt.
Veränderte Überzeugungen: Hier wird die Problematik der im Laufe des Lebens veränderten Überzeugungen und Werte des Patienten behandelt. Im Gegensatz zu einer Patientenverfügung kann sich der Patient in der konkreten Situation selbst äußern, während die Verfügung eine Festlegung auf konkrete Handlungen darstellt. Das Kapitel betont die Schwierigkeit, alle möglichen zukünftigen Szenarien vorherzusehen und die eigene Werteentwicklung zu antizipieren. Die Möglichkeit eines abweichenden, späteren Willens wird als Argument gegen die uneingeschränkte Gültigkeit der Patientenverfügung angeführt, wobei gleichzeitig die Schwierigkeit, sich in die zukünftige Situation des Patienten hineinzuversetzen, für beide Seiten des Arguments gilt.
Der emotionale Faktor: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss emotionaler Faktoren auf die Entscheidungsfindung im Umgang mit Patientenverfügungen. Es wird argumentiert, dass die Priorisierung des natürlichen Willens oft von emotionalen und subjektiven Erwägungen der Angehörigen geprägt ist, während die Betonung des autonomen Willens eine rationalere Herangehensweise darstellt. Die Angehörigen klammern sich oft an kleinste Anzeichen von Lebenswillen, auch wenn der Patient in seiner Verfügung etwas anderes festgelegt hat. Die Patientenverfügung wird als Instrument zum Schutz der Angehörigen gesehen, indem sie ihnen ein eindeutiges Handlungsschema bietet und das Loslassen erleichtert.
Das Identitätsproblem: Dieses Kapitel greift Merkels Argument auf, dass das Problem nicht in der Priorität des autonomen oder natürlichen Willens liegt, sondern in der Frage der Identität des Patienten. Es wird diskutiert, ob die Person, die die Verfügung verfasst hat, identisch ist mit der Person, die zum Zeitpunkt der Behandlung behandelt wird. Der Fokus liegt auf der psychischen Übereinstimmung: Kann man demselben physischen Körper dieselben personalen Merkmale zuschreiben, wenn kein subjektiver Bezug mehr besteht? Das Kapitel betont das rechtliche Fundamentalprinzip, dass eine Person nicht über eine andere verfügen darf.
John Lockes Definition der Identität: Dieses Kapitel bezieht sich auf John Lockes Definition der Identität als ein denkendes, verständiges Wesen, das sich selbst als dasselbe Ding zu verschiedenen Zeiten und Orten wahrnimmt. Es wird argumentiert, dass die fehlende Erinnerung an vergangene Erfahrungen auf einen Verlust des subjektiven Bezugs hinweist und somit die Identität in Frage stellt. Dies betrifft insbesondere Patienten mit Gedächtnisverlust oder Demenz. Das Kapitel diskutiert die Implikationen für die Gültigkeit der Patientenverfügung, wenn zwei verschiedene Identitäten einem Körper innewohnen.
Das Prinzip des Notstandes: Das Kapitel präsentiert Merkels Lösung des Problems: das Prinzip des Notstandes. Dieses Prinzip berücksichtigt die kollidierenden Interessen, priorisiert den gegenwärtigen Lebenswillen, bezieht aber auch alle Bedürfnisse und Belastbarkeiten des Patienten mit ein. Es verzichtet auf die Festlegung eines generellen Vorrangs (z.B. des autonomen Willens) und plädiert für eine individuelle Betrachtung mit ausgiebigen Einschätzungen und Begründungen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz des Patienten-Ichs, das mehr zu verlieren hat als das Verfasser-Ich.
Schlüsselwörter
Patientenverfügung, autonomer Wille, natürlicher Wille, Willensunfähigkeit, Identität, Personale Dispositionen, Lebenswille, Lebensunwille, John Locke, Prinzip des Notstandes, rechtliche Verbindlichkeit, medizinische Ethik.
Häufig gestellte Fragen zu: Natürlicher gegen autonomer Wille und das Problem der Identität – Erschwernisse hinsichtlich der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Problematik der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen im Spannungsfeld zwischen autonomem und natürlichem Willen. Sie analysiert die Argumente für und gegen die unbedingte Bindungswirkung von Patientenverfügungen und beleuchtet das zentrale Problem der Identität des Patienten zum Zeitpunkt der Verfügung und zum Zeitpunkt der Behandlung.
Welche gegensätzlichen Positionen werden bezüglich der Patientenverfügung diskutiert?
Es werden zwei gegensätzliche Positionen vorgestellt: Die Befürworter der unbedingten Bindungswirkung und ihre Gegner, die die Patientenverfügung als Indiz, aber nicht als absolutes Gesetz ansehen. Der Konflikt zwischen der Achtung der Autonomie des Patienten und der Berücksichtigung seines aktuellen Willens steht im Mittelpunkt.
Welche Rolle spielt der natürliche Wille in der Diskussion?
Die uneingeschränkte Priorität des natürlichen Willens würde die Patientenverfügung ad absurdum führen, da diese ja gerade für den Fall der Willensunfähigkeit erstellt wird. Die Schwierigkeit, den tatsächlichen Willen des Patienten eindeutig zu identifizieren, wird hervorgehoben. Die konsequente Verwendung des natürlichen Willens als Entscheidungskriterium wird als problematisch dargestellt, insbesondere wenn der natürliche Wille den Tod begünstigt.
Wie werden veränderte Überzeugungen im Laufe des Lebens berücksichtigt?
Die Problematik der im Laufe des Lebens veränderten Überzeugungen und Werte des Patienten wird behandelt. Eine Patientenverfügung stellt eine Festlegung auf konkrete Handlungen dar, während sich der Patient in der konkreten Situation selbst äußern kann. Die Schwierigkeit, alle zukünftigen Szenarien und die eigene Werteentwicklung vorherzusehen, wird betont. Ein abweichender, späterer Wille wird als Argument gegen die uneingeschränkte Gültigkeit der Patientenverfügung angeführt.
Welchen Einfluss haben emotionale Faktoren auf die Entscheidungsfindung?
Der Einfluss emotionaler Faktoren auf die Entscheidungsfindung im Umgang mit Patientenverfügungen wird beleuchtet. Die Priorisierung des natürlichen Willens ist oft von emotionalen und subjektiven Erwägungen der Angehörigen geprägt, während die Betonung des autonomen Willens eine rationalere Herangehensweise darstellt. Angehörige klammern sich oft an Anzeichen von Lebenswillen, auch wenn die Verfügung etwas anderes festlegt. Die Patientenverfügung kann als Instrument zum Schutz der Angehörigen gesehen werden.
Welche Bedeutung hat das Identitätsproblem?
Das zentrale Problem liegt in der Frage der Identität des Patienten. Es wird diskutiert, ob die Person, die die Verfügung verfasst hat, identisch ist mit der Person, die zum Zeitpunkt der Behandlung behandelt wird. Der Fokus liegt auf der psychischen Übereinstimmung: Kann man demselben physischen Körper dieselben personalen Merkmale zuschreiben, wenn kein subjektiver Bezug mehr besteht?
Wie definiert John Locke Identität und welche Implikationen hat dies?
John Lockes Definition der Identität als ein denkendes, verständiges Wesen, das sich selbst als dasselbe Ding wahrnimmt, wird herangezogen. Fehlende Erinnerung an vergangene Erfahrungen weist auf einen Verlust des subjektiven Bezugs und stellt die Identität in Frage. Dies betrifft Patienten mit Gedächtnisverlust oder Demenz. Die Implikationen für die Gültigkeit der Patientenverfügung werden diskutiert, wenn zwei verschiedene Identitäten einem Körper innewohnen.
Welche Lösung wird für das Problem der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen vorgeschlagen?
Merkels Lösung ist das Prinzip des Notstandes. Dieses Prinzip berücksichtigt kollidierende Interessen, priorisiert den gegenwärtigen Lebenswillen, bezieht aber auch Bedürfnisse und Belastbarkeiten des Patienten mit ein. Es verzichtet auf die Festlegung eines generellen Vorrangs und plädiert für eine individuelle Betrachtung mit ausgiebigen Einschätzungen und Begründungen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz des Patienten-Ichs.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Patientenverfügung, autonomer Wille, natürlicher Wille, Willensunfähigkeit, Identität, Personale Dispositionen, Lebenswille, Lebensunwille, John Locke, Prinzip des Notstandes, rechtliche Verbindlichkeit, medizinische Ethik.
- Arbeit zitieren
- Kira Lewandowski (Autor:in), 2016, Erschwernisse hinsichtlich der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen. Natürlicher gegen autonomer Wille und das Problem der Identität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322190