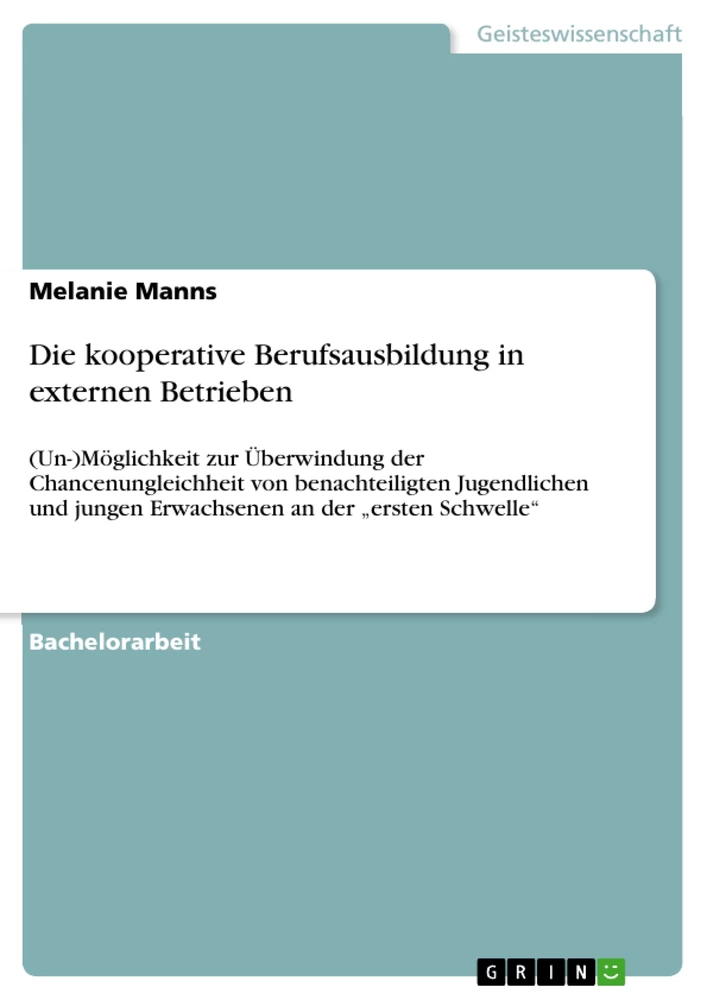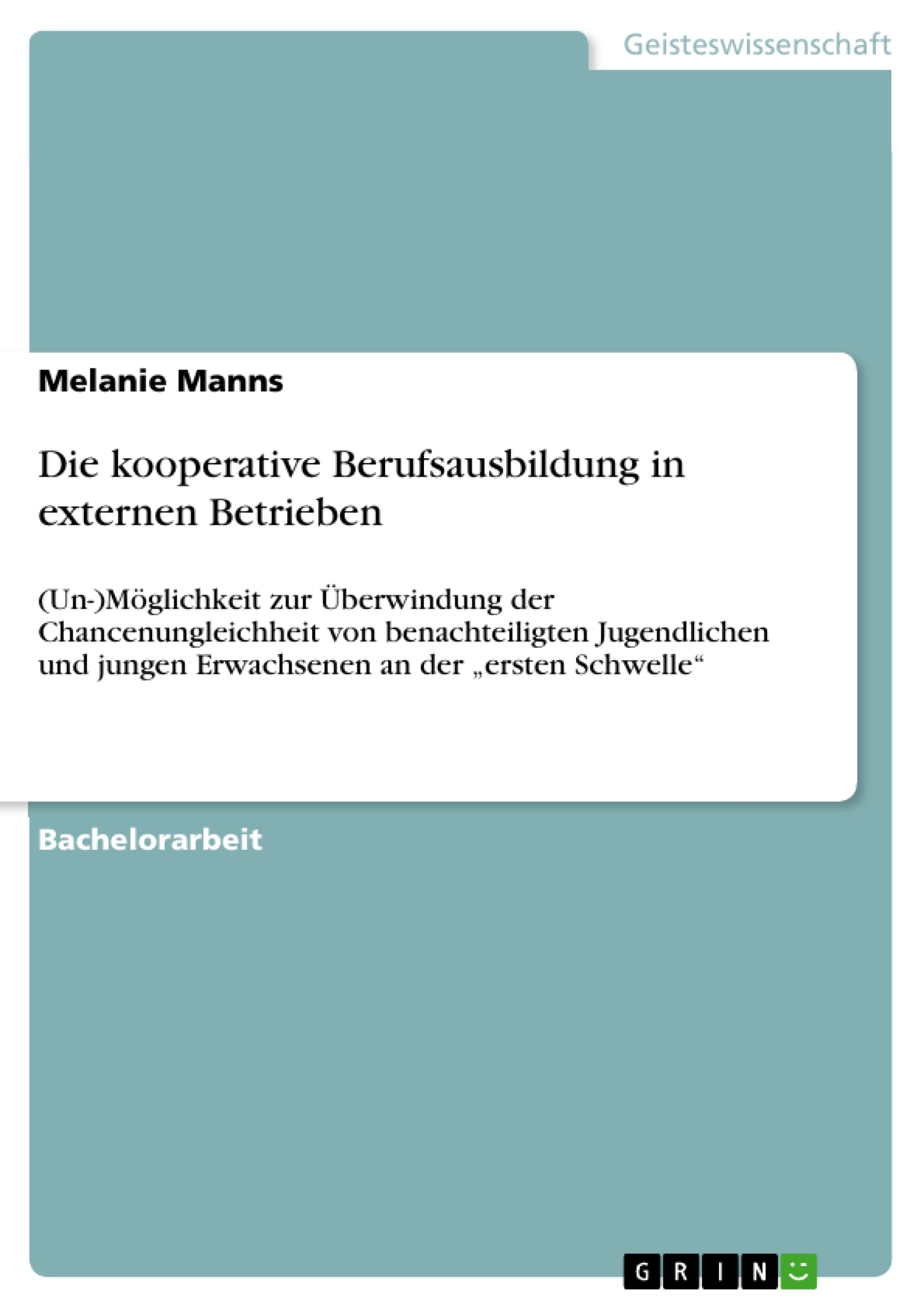Ausbildungslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem. Die Ausgrenzungsrisiken in den allgemeinbildenden Schulen und am Übergang von der Schule in den Beruf (der „ersten Schwelle“) haben sich auf einem ziemlich hohen Niveau stabilisiert: Jedes Jahr verlassen mehrere hunderttausende Schülerinnen und Schüler die deutschen Schulen, ohne eine Ausbildung zu beginnen, wohl aber mit dem Wunsch und dem Ziel, eine Ausbildung machen zu dürfen. Ich wähle an dieser Stelle bewusst den Begriff des „Dürfens“, denn ein Ausbildungsplatz erscheint in Anbetracht der aktuellen Ausbildungslage als Privileg, das vermehrt nur bestimmten Auserwählten - den Bewerberinnen und Bewerbern, die laut Agentur für Arbeit über die erforderliche Ausbildungsreife verfügen - vorenthalten bleibt.
Ich möchte mich im Rahmen dieser Arbeit mit einer Antwort auf diese zunehmende Privilegierung der Berufsausbildung beschäftigen. Die Kooperative Ausbildung bildet gemeinsam mit Betrieben und nach den Prinzipien und rechtlichen Grundlagen des dualen Systems benachteiligte, vermeintlich ausbildungsunreife Jugendliche und junge Erwachsene aus und führt diese zu einem anerkannten Berufsabschluss, der Ehre, Bezahlung nach Tarif und eine sichere, berufliche Zukunft verspricht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die erste Schwelle
- 2.1. Das duale System
- 2.2. Das Übergangssystem
- 2.2.1. Die „Ausbildungsreife“
- 3. Benachteiligte Jugendliche
- 3.1. Ursachen der Benachteiligung
- 3.1.1. Soziale Faktoren
- 3.1.2. Schule als erste Selektionsinstanz
- 3.1.3. Ausbildungsmarktbezogene Faktoren
- 3.1.4. Individuelle Faktoren
- 3.2. Psychosoziale Auswirkungen der Benachteiligungen
- 4. Die Kooperative Ausbildung
- 4.1. Die außerbetriebliche Ausbildung BaE: ein Überblick
- 4.2. Die Entstehung der Kooperativen Ausbildung
- 4.3. Rechtliche Grundlagen
- 4.4. Gestaltungsmöglichkeiten von Ausbildung für benachteiligte Jugendliche
- 4.4.1. Pädagogisches Konzept
- 4.4.2. Beruf und Betrieb
- 4.4.3. Kooperation
- 4.4.4. Wertschätzung und Selbstkonzept
- 5. Chancen und Grenzen der Kooperativen Ausbildung zur Überwindung der Chancenungleichheiten an der ersten Schwelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Kooperative Ausbildung als mögliches Mittel zur Überwindung von Chancenungleichheiten benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener beim Übergang von der Schule in den Beruf (die „erste Schwelle“). Die Arbeit analysiert die Herausforderungen dieses Übergangs, die Ursachen von Benachteiligung und die Funktionsweise der Kooperativen Ausbildung.
- Chancenungleichheit beim Übergang Schule-Beruf
- Ursachen der Benachteiligung von Jugendlichen
- Das duale und das Übergangssystem in Deutschland
- Konzept und Praxis der Kooperativen Ausbildung
- Potenzial und Grenzen der Kooperativen Ausbildung zur Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Problem der Ausbildungslosigkeit als gesellschaftliches Problem und stellt die Kooperative Ausbildung als möglichen Lösungsansatz vor. Sie wirft die Frage auf, ob die Kooperative Ausbildung tatsächlich Chancenungleichheiten an der ersten Schwelle beseitigen kann und diskutiert die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Forschungsfragen der Arbeit.
2. Die erste Schwelle: Dieses Kapitel definiert den Begriff „erste Schwelle“ als den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und die damit verbundenen Risiken. Es beschreibt das duale System und das Übergangssystem in Deutschland, welche oft als Hürden für benachteiligte Jugendliche fungieren. Der Abschnitt analysiert die Herausforderungen dieses Übergangs und legt den Grundstein für die spätere Betrachtung der Kooperativen Ausbildung.
3. Benachteiligte Jugendliche: Kapitel 3 identifiziert benachteiligte Jugendliche und analysiert die Ursachen ihrer Benachteiligung. Es differenziert zwischen sozialen, schulischen, ausbildungsmarktbezogenen und individuellen Faktoren, die zu Ausgrenzung führen. Der Fokus liegt auf der systemischen Natur dieser Benachteiligungen und deren Auswirkungen auf die Chancen der Betroffenen.
4. Die Kooperative Ausbildung: Dieses Kapitel beschreibt die Kooperative Ausbildung als ein alternatives Ausbildungsmodell für benachteiligte Jugendliche. Es erläutert die außerbetriebliche Ausbildung, die Entstehung des Modells, seine rechtlichen Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten, inklusive pädagogischer Konzepte, der Rolle des Betriebs und der Bedeutung von Kooperation und Wertschätzung. Es stellt verschiedene Aspekte der Kooperativen Ausbildung dar.
Schlüsselwörter
Kooperative Ausbildung, Chancenungleichheit, Benachteiligung, Jugendliche, Übergang Schule-Beruf, duale Ausbildung, Übergangssystem, soziale Arbeit, Integration.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Kooperative Ausbildung und Chancenungleichheit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Kooperative Ausbildung als mögliches Mittel zur Überwindung von Chancenungleichheiten benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener beim Übergang von der Schule in den Beruf (die „erste Schwelle“). Sie analysiert die Herausforderungen dieses Übergangs, die Ursachen von Benachteiligung und die Funktionsweise der Kooperativen Ausbildung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Chancenungleichheit beim Übergang Schule-Beruf, Ursachen der Benachteiligung von Jugendlichen, das duale und das Übergangssystem in Deutschland, Konzept und Praxis der Kooperativen Ausbildung sowie das Potenzial und die Grenzen der Kooperativen Ausbildung zur Chancengleichheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst fünf Kapitel: Einleitung, die erste Schwelle (Übergang Schule-Beruf), benachteiligte Jugendliche (Ursachen und Auswirkungen), die Kooperative Ausbildung (Konzept, Praxis, rechtliche Grundlagen) und schließlich die Chancen und Grenzen der Kooperativen Ausbildung zur Überwindung von Chancenungleichheiten.
Was wird unter „erste Schwelle“ verstanden?
Die „erste Schwelle“ bezeichnet den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und die damit verbundenen Risiken, insbesondere für benachteiligte Jugendliche. Das Kapitel analysiert das duale System und das Übergangssystem in Deutschland, welche oft als Hürden für diese Jugendlichen fungieren.
Welche Ursachen für Benachteiligung werden untersucht?
Die Arbeit differenziert zwischen sozialen, schulischen, ausbildungsmarktbezogenen und individuellen Faktoren, die zur Benachteiligung von Jugendlichen führen. Der Fokus liegt auf der systemischen Natur dieser Benachteiligungen und deren Auswirkungen auf die Chancen der Betroffenen.
Was ist die Kooperative Ausbildung?
Die Kooperative Ausbildung wird als alternatives Ausbildungsmodell für benachteiligte Jugendliche vorgestellt. Die Arbeit erläutert die außerbetriebliche Ausbildung, die Entstehung des Modells, seine rechtlichen Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten, inklusive pädagogischer Konzepte, der Rolle des Betriebs und der Bedeutung von Kooperation und Wertschätzung.
Welche Chancen und Grenzen der Kooperativen Ausbildung werden diskutiert?
Das letzte Kapitel bewertet das Potenzial und die Grenzen der Kooperativen Ausbildung zur Überwindung von Chancenungleichheiten beim Übergang Schule-Beruf. Es analysiert, inwieweit die Kooperative Ausbildung tatsächlich dazu beitragen kann, diese Ungleichheiten zu beseitigen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kooperative Ausbildung, Chancenungleichheit, Benachteiligung, Jugendliche, Übergang Schule-Beruf, duale Ausbildung, Übergangssystem, soziale Arbeit, Integration.
- Citation du texte
- Melanie Manns (Auteur), 2015, Die kooperative Berufsausbildung in externen Betrieben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312646