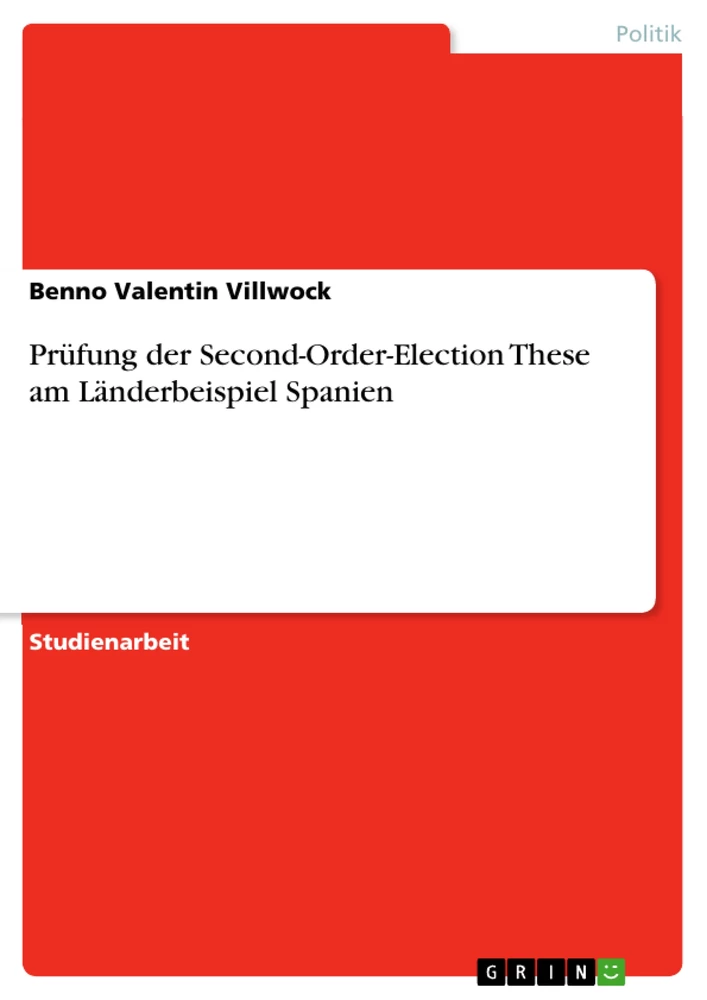Theorieprüfend soll in dieser Arbeit anhand des Länderbeispiels Spanien untersucht werden, inwieweit zentrale Deduktionen der second order election These (SOET) empirisch bestätigt werden können. In einem ersten Schritt wir sich hierbei auf den positiven Theorieteil der SOET, die less-at-stake Dimension (LSD), beschränkt. Aus aktuellem Anlass erfolgt die Analyse, neben der historischen Perspektive, mit besonderem Fokus auf die Europawahlen im Mai 2014. Sind die Thesen zum Europawahlergebnis der SOET im Länderbeispiel Spanien zutreffend? Wodurch wird das Erklärungspotential der LSD im konkreten Fall relativiert, welche alternativen Erklärungsansätze lassen sich anführen? Dem Projekt der vorliegenden Arbeit liegt der epochemachende Artikel Reifs und Schmitts zugrunde.
Der bis heute einflussreichste Ansatz In der politikwissenschaftlichen Forschung zu den Direktwahlen des europäischen Parlaments reicht bis in den Kontext der ersten
Direktwahlen zurück und klassifiziert die Europawahlen als Wahlen zweiter Ordnung, sog. „second order elections“. Der zugrundeliegende Forschungsartikel "Nine Second-Order Elections – A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results" gilt heute als „moderner Klassiker“ der paneuropäischen Wahlforschung. Dem in diesem Artikel formulierten Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass, aus Perspektive der Wahlbevölkerung, bei den Europawahlen bedeutend weniger auf dem Spiel steht als bei den entscheidenden nationalen Wahlen, „less at stake“ ist. Hieraus wird gefolgert, dass die Ergebnisse der Europawahlen in erheblicher Abhängigkeit zu den Ergebnissen der jeweils wichtigsten nationalen Wahlereignisse stehen und in deren Licht zu interpretieren sind. Bei der Wahl des Europaparlaments (EP) handele es sich also nicht eigentlich um eine paneuropäische Wahl, sondern um eine Anzahl parallel stattfindender, nationaler Wahlereignisse.
Die Methodik ist im Wesentlichen quantitativ. Anhand der Vorhersagen der Operationalisierung der LSD werden die Wahlergebnisse der Europawahl im Fallbeispiel Spanien
quantitativ untersucht.Schließlich erfolgt eine Relativierung der quantitativen Ergebnisse anhand besonderer institutioneller Charakteristika und konkreter soziopolitischer Rahmenbedingungen des Länderbeispiels Spanien, durch welche die Ergebnisse des quantitativen Teils ergänzt werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I Einleitung
- II Theoretische Grundlage: Die Second-Order-Election These
- III Analyse der Europawahl in Spanien anhand der SOET
- 1. Der Analysegegenstand
- 2. Konstruktiver Theorieteil, die less-at-stake Dimension
- a) Geringere Wahlbeteiligung
- b) Kleinere und neue Parteien gewinnen, große Parteien verlieren
- c) Europawahlergebnis der Regierung abhängig vom nationalen Wahlzyklus
- 3. Relativierender Theorieteil
- a) Zwischenbewertung des Ergebnisses der quantitativen Analyse
- b) Institutionell-prozeduraler Erklärungsansatz
- c) Tatsächliche Verschiebung von Parteipräferenzen des Elektorats
- IV Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Europawahlen in Spanien anhand der Second-Order-Election These (SOET). Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit zentrale Deduktionen der SOET empirisch bestätigt werden können. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die less-at-stake Dimension (LSD) und untersucht, ob sich die Europawahlergebnisse in Spanien im Lichte der letzten nationalen Wahlen erklären lassen.
- Wahlbeteiligung bei Europawahlen
- Erfolgsaussichten kleiner und neuer Parteien
- Abhängigkeit des Wahlergebnisses der Regierung von der nationalen Wahlkonjunktur
- Institutionelle Besonderheiten des spanischen Wahlsystems
- Einfluss der anhaltenden Krise auf den spanischen Arbeitsmarkt auf die Parteienpräferenz des Elektorats
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Forschungslandschaft zur Analyse der Europawahlen vor und erläutert die Relevanz der SOET. Kapitel II beschreibt die theoretische Grundlage der SOET, insbesondere die less-at-stake Dimension und ihre Operationalisierung. Kapitel III analysiert die Europawahl in Spanien im Kontext der SOET. Zunächst wird der Analysegegenstand, die spanische Parteienlandschaft und das Wahlsystem, dargestellt. Anschließend erfolgt die quantitative Analyse der Europawahlergebnisse im Lichte der LSD. Der relativierende Theorieteil diskutiert alternative Erklärungsansätze für die Ergebnisse, die sich aus den institutionellen Besonderheiten des spanischen Wahlsystems und der anhaltenden Krise auf dem spanischen Arbeitsmarkt ergeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Europawahlen, Second-Order-Election These (SOET), less-at-stake Dimension (LSD), spanisches Wahlsystem, Parteienpräferenz, Arbeitsmarkt, Krise, politische Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Second-Order-Election These (SOET)?
Die These besagt, dass Europawahlen als Wahlen zweiter Ordnung wahrgenommen werden, bei denen aus Sicht der Wähler weniger auf dem Spiel steht als bei nationalen Wahlen.
Was ist die "less-at-stake" Dimension (LSD)?
Die LSD beschreibt die Annahme, dass bei Europawahlen weniger politische Entscheidungsmacht vergeben wird, was zu geringerer Wahlbeteiligung und Stimmenverlusten für Regierungsparteien führt.
Wie wirkte sich die SOET auf die Europawahl 2014 in Spanien aus?
Die Analyse untersucht, ob kleine und neue Parteien in Spanien überproportional gewannen und ob das Ergebnis der Regierung vom nationalen Wahlzyklus abhing.
Welche Rolle spielen institutionelle Charakteristika in Spanien?
Besondere institutionelle Rahmenbedingungen und das spanische Wahlsystem können die rein quantitativen Vorhersagen der SOET relativieren oder ergänzen.
Wer sind die Begründer der Second-Order-Election These?
Der Ansatz basiert auf dem einflussreichen Artikel von Reif und Schmitt aus dem Kontext der ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament.
- Arbeit zitieren
- Benno Valentin Villwock (Autor:in), 2015, Prüfung der Second-Order-Election These am Länderbeispiel Spanien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312164