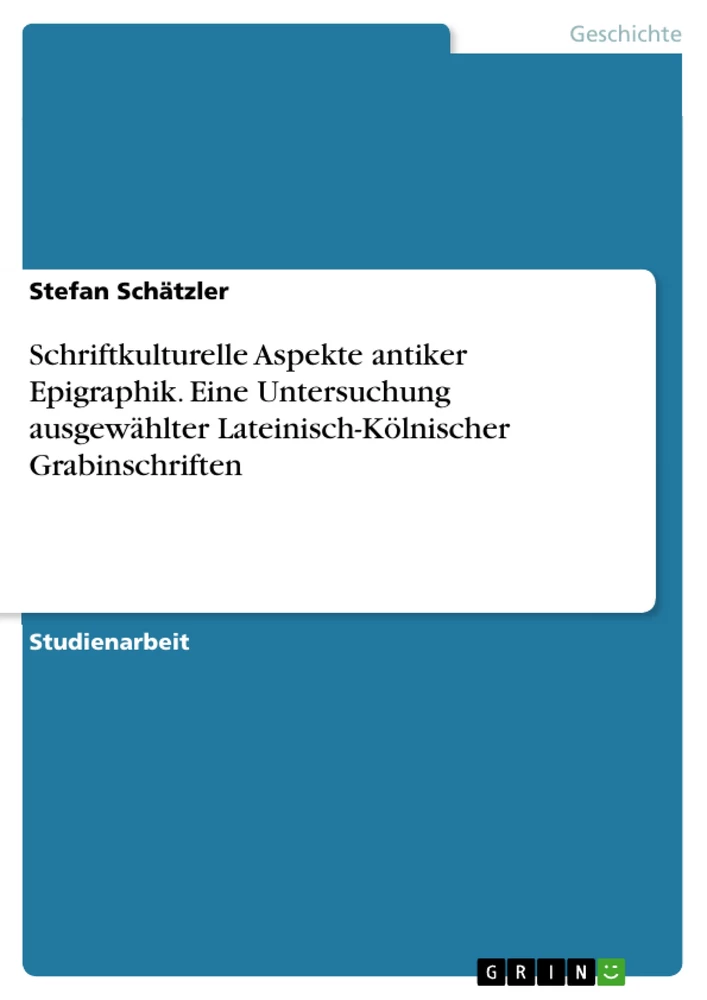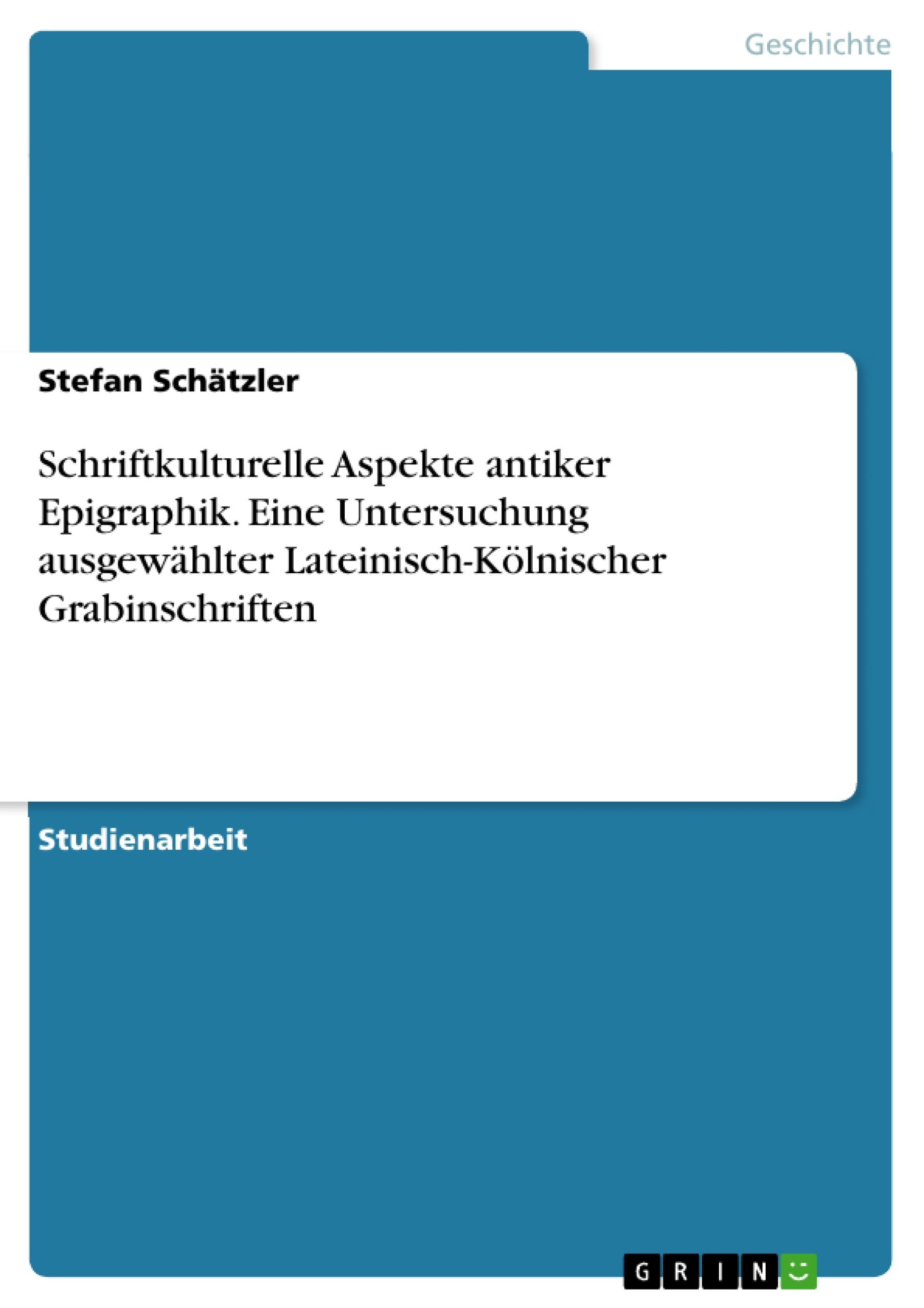In dieser Arbeit soll ein kulturwissenschaftlicher, genauer gesagt schriftkultureller Blickwinkel auf die römische Epigraphik eingenommen werden. Anhand der vergleichenden Betrachtung zweier Grabinschriften, nebst den dazu gehörigen Monumenten, wird der Frage nachgegangen, ob und gegebenenfalls wie hierin römische Sepulkralkultur zum Ausdruck kommt. Dies ist die Leitfrage der Arbeit.
Nach einleitenden Ausführungen werden zunächst zwei römische Grabinschriften vergleichend vorgestellt, und zwar die des wohlhabenden römischen Bürgers Lucius Poblicius und des Zimmermannes Vetinius Verus. Diese Analyse hat sich nicht nur auf die Inschriften selbst zu erstrecken, sondern die Gesamtheit des sie tragenden Monuments zu berücksichtigen. Es kommt hierbei auch darauf an, herauszuarbeiten, worin sich diese Monumente unterscheiden.
Die so gewonnenen Erkenntnisse bilden im Weiteren die Grundlage zur Vorstellung der historischen Kenntnisstände um die antike Römische Sepulkralkultur. Hierbei ist das antike Römische Totenritual zunächst abrissartig zu beleuchten. Hierbei wird auch die These gestreift, nach der Inschriften ein System der Kommunikation darstellen.
Das Ergebnis dieser Befragung wird zeigen, ob und welche Antworten auf die genannten Fragestellungen uns diese schriftkulturellen Zeugnisse geben können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Fragestellung, Herangehensweise und Abgrenzung
- Zwei antike römische Grabinschriften in vergleichender Betrachtung
- Das Grabmal des Lucius Poblicius
- Der Grabstein des Quintus Vetinius Verus
- Zwischenfazit
- Römische Sepulkralkultur – Ein Abriss
- Inschriften als historische Quellengattung
- Grabinschriften als Quelle zur Römischen Sepulkralkultur
- Inschriften als Kommunikationssystem
- Erkenntnisse, Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der schriftkulturellen Bedeutung antiker römischer Grabinschriften, insbesondere anhand von zwei ausgewählten Beispielen: dem Grabmal des Lucius Poblicius und dem Grabstein des Quintus Vetinius Verus. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Rolle dieser Inschriften als Ausdruck der römischen Sepulkralkultur zu untersuchen. Sie nimmt einen induktiven Ansatz ein und versucht, aus den beiden Beispielen auf allgemeine Strukturen und Gesetzmäßigkeiten zu schließen.
- Die Bedeutung antiker Grabinschriften als historische Quellengattung
- Die Funktion von Inschriften als Ausdrucksform der römischen Sepulkralkultur
- Der Vergleich der beiden Grabinschriften in Bezug auf ihre Inschriften und Monumente
- Die Rolle von Inschriften als Kommunikationssystem in der römischen Antike
- Die historische Entwicklung der römischen Sepulkralkultur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung, Herangehensweise und Abgrenzung der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung römischer Grabinschriften als historische Quellengattung. Sie legt den Fokus auf die Untersuchung der römischen Sepulkralkultur anhand von zwei Beispielen und skizziert die Methoden, die in der Arbeit angewandt werden.
- Zwei antike römische Grabinschriften in vergleichender Betrachtung: Dieser Abschnitt präsentiert eine vergleichende Analyse der Grabinschriften des Lucius Poblicius und des Quintus Vetinius Verus. Er untersucht die Inschriften und Monumente im Detail und beleuchtet die Unterschiede in ihrer Gestaltung und Bedeutung. Der Fokus liegt dabei auf der Kommunikation, die durch die Inschriften und Monumente vermittelt wird.
- Römische Sepulkralkultur – Ein Abriss: Dieser Abschnitt beleuchtet die antike römische Sepulkralkultur im Allgemeinen und diskutiert die Rolle von Inschriften als historische Quellengattung. Es werden die wichtigsten Aspekte der römischen Totenrituale und -vorstellungen behandelt und die Bedeutung von Inschriften als Mittel der Kommunikation innerhalb dieser Kultur betrachtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Römische Epigraphik, Sepulkralkultur, Grabinschriften, Inschriftenanalyse, Kommunikation, Lucius Poblicius, Quintus Vetinius Verus, Römisches Totenritual, Schriftkultur, Vergleichende Analyse, Historische Quellengattung.
Häufig gestellte Fragen
Was verraten römische Grabinschriften über die Verstorbenen?
Inschriften geben Auskunft über Namen, Stand, Beruf, Alter und oft auch über die familiären Beziehungen und das soziale Prestige der Person.
Wer war Lucius Poblicius?
Lucius Poblicius war ein wohlhabender römischer Bürger in Köln, dessen monumentales Grabmal heute als eines der besterhaltenen Beispiele römischer Sepulkralkultur im Rheinland gilt.
Was unterscheidet das Grabmal des Poblicius von dem des Vetinius Verus?
Das Grabmal des Poblicius ist ein prachtvolles Monument, das Reichtum und Bürgerstatus betont, während der Grabstein des Zimmermanns Vetinius Verus schlichter ist und den Fokus auf seine berufliche Identität legt.
Wie fungierten Inschriften als Kommunikationssystem?
Grabinschriften waren an belebten Straßen platziert, um Passanten anzusprechen. Sie dienten der Bewahrung des Andenkens (Memoria) und der Selbstdarstellung der Familie gegenüber der Öffentlichkeit.
Was ist das römische Totenritual?
Es umfasst die Bestattungsfeierlichkeiten, die Errichtung des Grabmals sowie regelmäßige Gedenkfeiern am Grab, um die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten aufrechtzuerhalten.
- Citation du texte
- Stefan Schätzler (Auteur), 2014, Schriftkulturelle Aspekte antiker Epigraphik. Eine Untersuchung ausgewählter Lateinisch-Kölnischer Grabinschriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308106