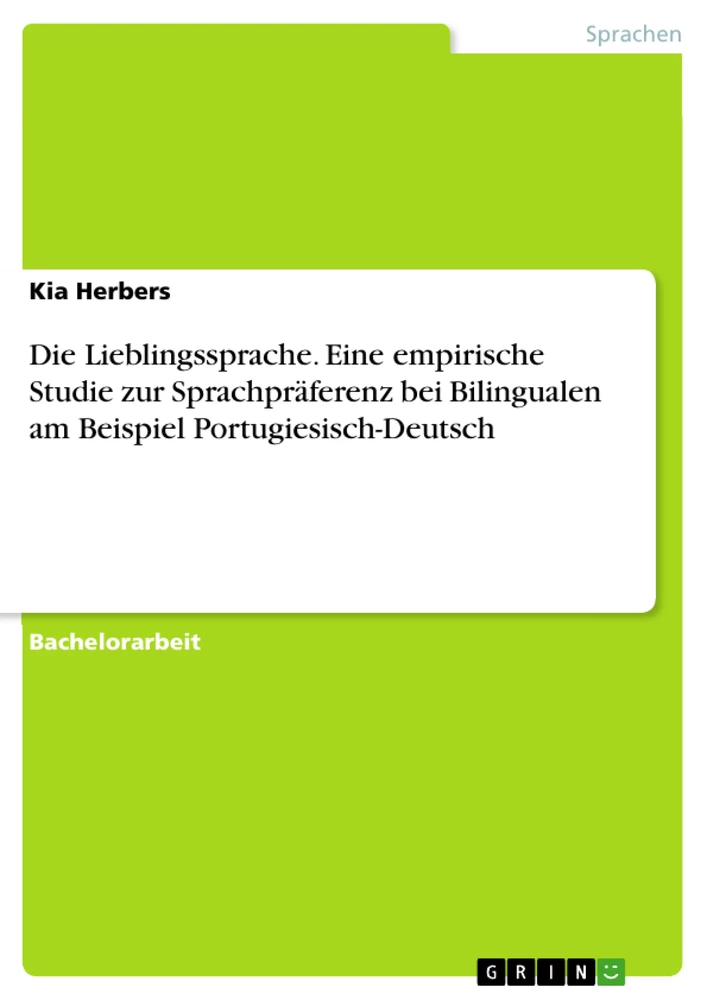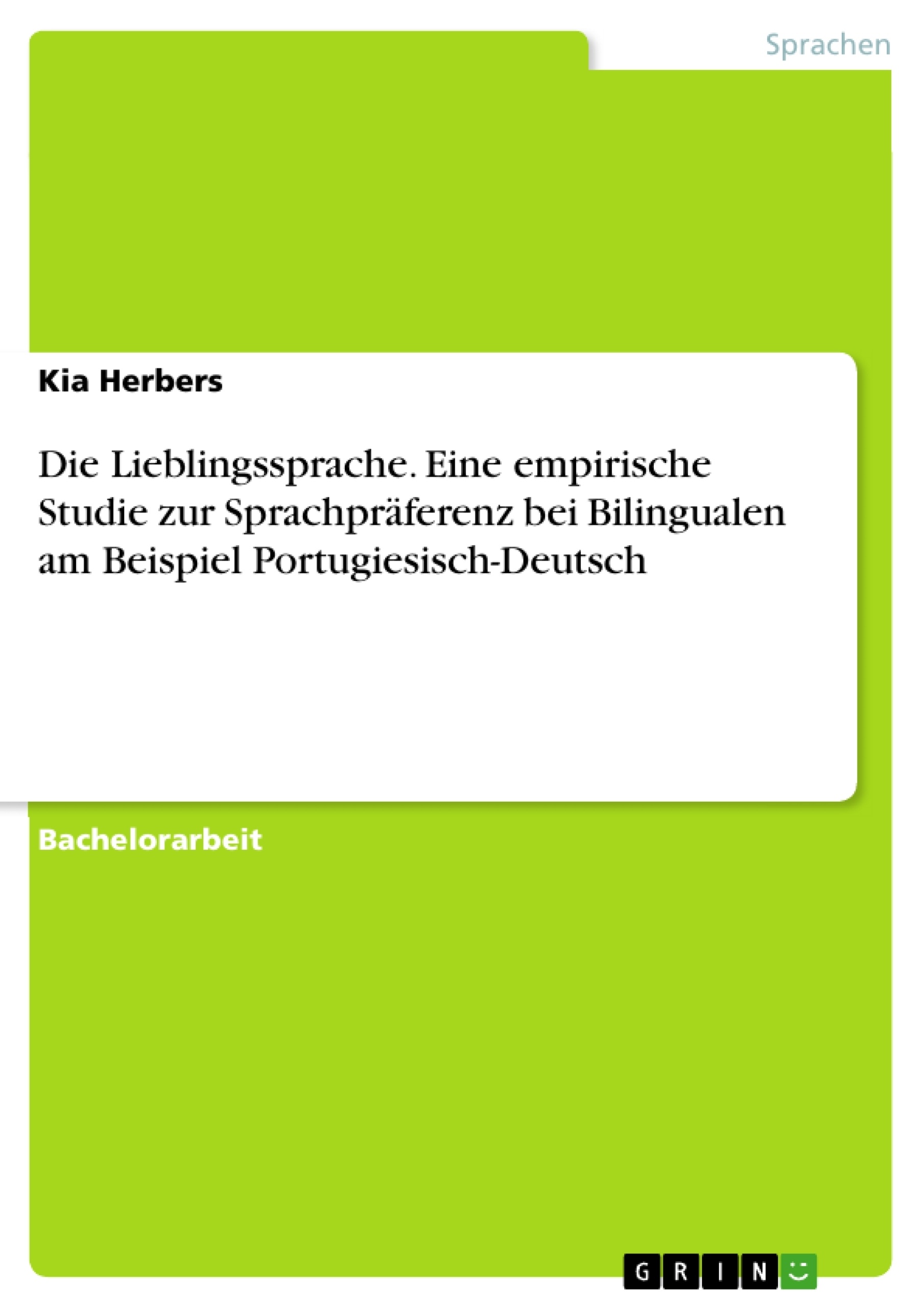Was ist Bilingualismus, wann ist von Bilingualismus die Rede? Wenn für einige das bloße Kommunizieren in zwei Sprachen dem Begriff Zweisprachigkeit gerecht wird, ist er für andere, im engeren Sinne, erst angebracht, wenn beide Sprachen ausgeglichen oder beinahe ausgeglichen in Wort und Schrift beherrscht werden (Wei 2007:14). Das Beherrschen einer Sprache variiert durch die Art der Zweisprachigkeit und kann sich im Laufe des Lebens von einer zur anderen Sprache verlagern.
Das Interesse für eine empirische Untersuchung von Zweisprachigkeit wurde durch meine eigene Zweisprachigkeit ausgelöst. Ich bin als Deutsche in Portugal aufgewachsen, habe eine portugiesische Schule besucht und zu Hause nur Deutsch gesprochen. Ich habe mir schon immer die Frage gestellt, warum ich lieber deutsch spreche und lese, als portugiesisch, die Sprache, die ich besser beherrsche. Dass ich lieber in Deutsch lese, ist mir insofern klar, als dass in Portugal eine signifikante Literaturlücke herrscht, viele der bekanntesten internationalen Autoren sind nicht einmal übersetzt. Das hat meine Lektüregewohnheiten durchaus beeinflusst.
Aber sprechen? Wie kommt das, geht es anderen Bilingualen auch so? Einige Vorüberlegungen zum Thema äußerten sich folgendermaßen: Wenn davon ausgegangen wird, dass ein Zweisprachiger beide Sprachen regelmäßig verwendet, hat sich dann eine subjektive Präferenz für eine dieser Sprachen entwickelt? Da Subjektivität nur schlecht definier- und messbar ist, wird Präferenz anhand der Sprachwahl in unterschiedlichen Bereichen untersucht. Kielhöfer/Jonekeit behaupten: „Allgemein gesehen ist die besser beherrschte Sprache die starke Sprache. Der Zweisprachige bevorzugt sie bei freier Sprachwahl, weil er sie besser kann, und er beherrscht sie wiederum besser, weil er sie häufiger benutzt“ (1995:12). Im Kontrast hierzu behaupten Müller et al., dass „die Verwendung der präferierten Sprache mit anderen Kindern, die auch zweisprachig sind, sowie die Traumsprache nicht notwendigerweise etwas darüber [aussagt], wie gut ein Kind eine Sprache beherrscht“ (2007: 84).
Diesen beiden Thesen möchte ich im Verlauf dieser Arbeit mithilfe unterschiedlicher Variablen nachgehen. Hängt diese Präferenz mit der Familiensprache, bzw. Mutter- oder Vatersprache, oder eher mit der Sprache, die in der Umgebung und dem sozialen Netzwerk gesprochen wird, zusammen? Ist die stärkere Sprache wirklich die bevorzugte?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretischer Teil
- 1. Bilingualismus
- 1.1 Zur Aktualität des Themas
- 1.2 Historischer Zusammenhang und Forschungsstand
- 1.3 Definitionen
- 1.4 Merkmale und Typen
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Verwendete Begriffe
- 2.2 Präferenz
- III. Empirischer Teil
- 3. Methodik
- 3.1 Forschungsinstrument
- 3.2 Forschungsfragen und Hypothesen
- 3.3 Auswertungsschritte
- 3.4 Probanden
- 4. Auswertung
- 4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Hypothesenprüfung
- 5. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Sprachpräferenz bei bilingualen Personen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die die Wahl der Sprache in verschiedenen Kontexten beeinflussen. Die Studie befasst sich mit der Frage, ob die besser beherrschte Sprache tatsächlich die bevorzugte Sprache ist und welche Rolle die Familiensprache sowie die Umgebungssprache spielen.
- Sprachpräferenz bei Bilingualen
- Einfluss der Familiensprache und der Umgebungssprache
- Zusammenhang zwischen Sprachbeherrschung und Sprachpräferenz
- Methodische Ansätze zur Erforschung von Sprachpräferenz
- Aktuelle Forschungsliteratur zum Thema Bilingualismus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die persönliche Motivation der Autorin für die Untersuchung der Sprachpräferenz bei Bilingualen, ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen als zweisprachige Person (Deutsch und Portugiesisch). Sie stellt kontrastierende Thesen aus der bestehenden Forschung vor, die den Zusammenhang zwischen Sprachbeherrschung und Sprachpräferenz unterschiedlich bewerten und kündigt an, diesen Aspekten in der Arbeit nachzugehen.
II. Theoretischer Teil: 1. Bilingualismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff Bilingualismus und beleuchtet seine Aktualität im Kontext der zunehmenden Globalisierung und Migration. Es wird auf verschiedene Definitionen und Merkmale des Bilingualismus eingegangen und der historische Kontext sowie der Forschungsstand dargelegt. Der Abschnitt beleuchtet auch die unterschiedlichen Perspektiven von Sprachwissenschaft, Psychologie, Soziolinguistik, Pädagogik und Neurolinguistik auf das Phänomen des Bilingualismus und betont die Relevanz für die Sprachentwicklung von Kindern.
II. Theoretischer Teil: 2. Begriffsdefinitionen: Hier werden die im weiteren Verlauf der Arbeit relevanten Begriffe, insbesondere der Begriff "Präferenz", präzise definiert und für die empirische Untersuchung vorbereitet. Dieser Abschnitt legt die Grundlage für eine einheitliche und wissenschaftlich fundierte Verwendung der Terminologie.
Schlüsselwörter
Bilingualismus, Sprachpräferenz, Sprachwahl, Familiensprache, Umgebungssprache, Sprachbeherrschung, empirische Studie, Methodik, Hypothesenprüfung, Zweisprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Sprachpräferenz bei bilingualen Personen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Sprachpräferenz bei bilingualen Personen. Sie analysiert die Faktoren, welche die Wahl der Sprache in verschiedenen Kontexten beeinflussen, und untersucht den Zusammenhang zwischen Sprachbeherrschung und Sprachpräferenz, sowie den Einfluss von Familien- und Umgebungssprache.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Sprachpräferenz bei Bilingualen, den Einfluss von Familien- und Umgebungssprache, den Zusammenhang zwischen Sprachbeherrschung und Sprachpräferenz, methodische Ansätze zur Erforschung von Sprachpräferenz und die aktuelle Forschungsliteratur zum Thema Bilingualismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Eine Einleitung, einen theoretischen Teil (mit den Kapiteln Bilingualismus und Begriffsdefinitionen) und einen empirischen Teil (mit den Kapiteln Methodik, Auswertung und Schlussfolgerung). Der theoretische Teil definiert den Begriff Bilingualismus, beleuchtet seine Aktualität und den Forschungsstand, und legt die verwendeten Begriffe präzise fest. Der empirische Teil beschreibt die Methodik der Untersuchung, die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen.
Wie ist die Methodik der empirischen Untersuchung?
Die Arbeit beschreibt im Kapitel "Methodik" das Forschungsinstrument, die Forschungsfragen und Hypothesen, die Auswertungsschritte und die Auswahl der Probanden. Weitere Details zur konkreten Methodik werden im Text der Arbeit selbst erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bilingualismus, Sprachpräferenz, Sprachwahl, Familiensprache, Umgebungssprache, Sprachbeherrschung, empirische Studie, Methodik und Hypothesenprüfung.
Welche Motivation liegt der Arbeit zugrunde?
Die Autorin ist selbst zweisprachig (Deutsch und Portugiesisch) aufgewachsen und hat aus dieser persönlichen Erfahrung heraus die Motivation, die Sprachpräferenz bei Bilingualen zu untersuchen. Sie möchte kontrastierende Thesen aus der bestehenden Forschung zum Zusammenhang zwischen Sprachbeherrschung und Sprachpräferenz überprüfen.
Welche Perspektiven werden im theoretischen Teil berücksichtigt?
Der theoretische Teil beleuchtet unterschiedliche Perspektiven von Sprachwissenschaft, Psychologie, Soziolinguistik, Pädagogik und Neurolinguistik auf das Phänomen des Bilingualismus und betont die Relevanz für die Sprachentwicklung von Kindern.
Wo finde ich weitere Details zur Auswertung der Ergebnisse?
Die detaillierte Auswertung der Ergebnisse und die Überprüfung der Hypothesen sind im Kapitel "Auswertung" beschrieben. Die Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich ebenfalls in diesem Kapitel.
- Quote paper
- Kia Herbers (Author), 2012, Die Lieblingssprache. Eine empirische Studie zur Sprachpräferenz bei Bilingualen am Beispiel Portugiesisch-Deutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294976