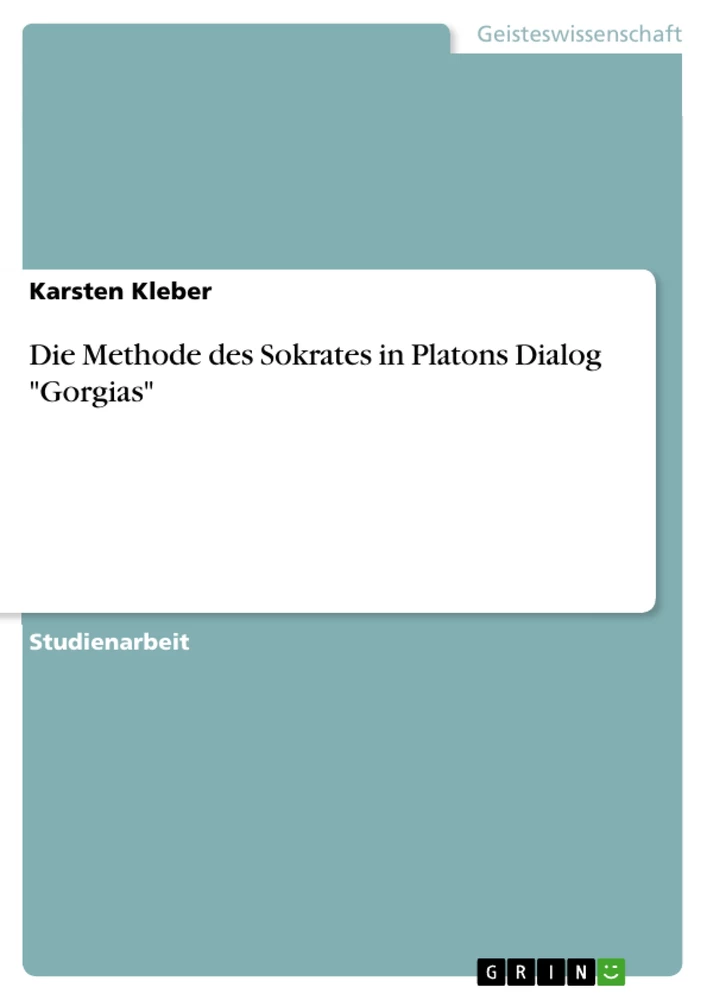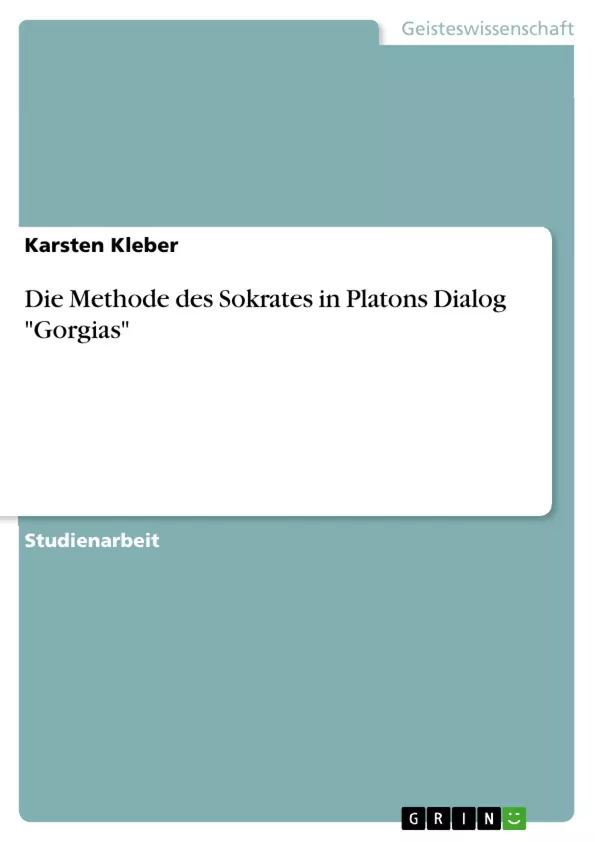Der Dialog "Gorgias" zeichnet sich durch eine ausgeprägte Methodenvielfalt aus.
Monologische und elenktische Abschnitte wechseln sich ab; ein großer Teil der Forschungsliteratur zur Natur des platonischen elenchos, die in der vorliegenden Arbeit ausführlich herangezogen wird, bezieht sich explizit auf Beispiele aus dem "Gorgias".
Die unterschiedlichen Methoden des Dialoges werden überblicksweise vorgestellt und im literarischen Gesamtzusammenhang des Werkes interpretiert.
Es ergeben sich mehrere mögliche Deutungsansätze; so könnte dem "Gorgias" eine gezielte Transformation der "Antiope" des Euripides zugrunde liegen. Gesichert ist am Ende die enorme Relevanz des "Gorgias" für die Werkbiographie Platons und die schwierige Abgrenzung seines Denkens von dem seines Lehrers Sokrates.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die elenktischen Abschnitte
- 3. Kulmination der elenktischen Abschnitte: Das Kallikles-Gespräch
- 4. Die monologischen Abschnitte
- 5. Kulmination der monologischen Abschnitte: Der Jenseitsmythos
- 6. Der Gorgias und die Antiope des Euripides
- 7. Sokrates Methode im Gorgias als werkbiographisches Indiz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Sokrates' Methode im Platonischen Dialog Gorgias. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte seiner Gesprächsführung zu analysieren und ihren Beitrag zum Verständnis des Dialogs zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf den Wechsel zwischen elenktischen und monologischen Abschnitten und deren jeweilige Bedeutung für die Darstellung von Sokrates' Philosophie.
- Sokratische Methode (Elenchos)
- Dialogische und monologische Abschnitte im Gorgias
- Analyse der Gespräche mit Gorgias, Polos und Kallikles
- Interpretation der methodischen Vielfalt im Gorgias
- Der Gorgias als Indiz für Sokrates' Lebenswerk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung stellt den Gorgias als einen zentralen Platonischen Dialog für das Verständnis der sokratischen Methode vor. Sie begründet diese Bedeutung durch die Position des Dialogs im Werk Platons, seine methodische Vielfalt und die Interpretation bestimmter Abschnitte als direkte Thematisierung der sokratischen Methode. Die Einleitung skizziert den Aufbau des Dialogs und kündigt die folgenden Analysen der elenktischen und monologischen Abschnitte an.
2. Die elenktischen Abschnitte: Dieses Kapitel analysiert die elenktischen Abschnitte des Gorgias, die Gespräche Sokrates' mit Gorgias, Polos und Kallikles. Es untersucht diese Gespräche anhand der Bensonschen Kriterien für den Elenchos und beleuchtet die Erfolgsrate Sokrates' in der Widerlegung seiner Gesprächspartner. Die Diskussion beinhaltet die Debatte um die Definition der elenktischen Methode und die Frage nach ihrer Einheitlichkeit im platonischen Werk. Die Kapitel untersucht auch kritische Einwände zu Sokrates' Argumentationsweise im Dialog, insbesondere bezüglich möglicher logischer Fehler.
Schlüsselwörter
Sokratische Methode, Elenchos, Gorgias, Platon, Dialoganalyse, Elenktische Abschnitte, Monologische Abschnitte, Rhetorik, Gerechtigkeit, Hedonismus, Philosophie, Werkbiographie.
Häufig gestellte Fragen zum Platonischen Dialog Gorgias
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Sokrates' Methode im Platonischen Dialog Gorgias. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Aspekte seiner Gesprächsführung und deren Beitrag zum Verständnis des Dialogs. Besonders wird der Wechsel zwischen elenktischen und monologischen Abschnitten und deren Bedeutung für die Darstellung von Sokrates' Philosophie beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die sokratische Methode (Elenchos), die dialogischen und monologischen Abschnitte im Gorgias, die Analyse der Gespräche mit Gorgias, Polos und Kallikles, die Interpretation der methodischen Vielfalt im Gorgias und den Gorgias als Indiz für Sokrates' Lebenswerk.
Wie ist der Dialog Gorgias aufgebaut?
Die Arbeit gliedert den Dialog in elenktische (dialektische) und monologische Abschnitte. Die elenktischen Abschnitte beinhalten die Gespräche Sokrates' mit Gorgias, Polos und Kallikles. Die monologischen Abschnitte kulminieren im Jenseitsmythos. Die Arbeit untersucht beide Abschnitte separat und analysiert ihre jeweilige Bedeutung für das Gesamtverständnis des Dialogs.
Welche Methode wird zur Analyse des Dialogs verwendet?
Die Analyse der elenktischen Abschnitte erfolgt anhand der Bensonschen Kriterien für den Elenchos. Die Arbeit untersucht die Erfolgsrate Sokrates' bei der Widerlegung seiner Gesprächspartner und diskutiert kritische Einwände zu Sokrates' Argumentationsweise, einschließlich möglicher logischer Fehler. Die methodische Vielfalt im Gorgias wird ebenfalls interpretiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Sokratische Methode, Elenchos, Gorgias, Platon, Dialoganalyse, elenktische Abschnitte, monologische Abschnitte, Rhetorik, Gerechtigkeit, Hedonismus, Philosophie, Werkbiographie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst sieben Kapitel: Einleitung (Einführung in den Gorgias und seine Bedeutung für das Verständnis der sokratischen Methode), Analyse der elenktischen Abschnitte (Gespräche mit Gorgias, Polos und Kallikles), Kulmination der elenktischen Abschnitte (Kallikles-Gespräch), Analyse der monologischen Abschnitte, Kulmination der monologischen Abschnitte (Jenseitsmythos), der Gorgias und die Antiope des Euripides (vergleichende Analyse), und Sokrates' Methode im Gorgias als werkbiographisches Indiz.
Welches ist das zentrale Ziel der Arbeit?
Das zentrale Ziel der Arbeit ist es, die sokratische Methode im Platonischen Dialog Gorgias zu analysieren und ihren Beitrag zum Verständnis des Dialogs zu beleuchten. Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Aspekte von Sokrates' Gesprächsführung zu untersuchen und deren Bedeutung im Kontext des gesamten Werkes Platons zu interpretieren.
- Arbeit zitieren
- M.A. Karsten Kleber (Autor:in), 2014, Die Methode des Sokrates in Platons Dialog "Gorgias", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293072