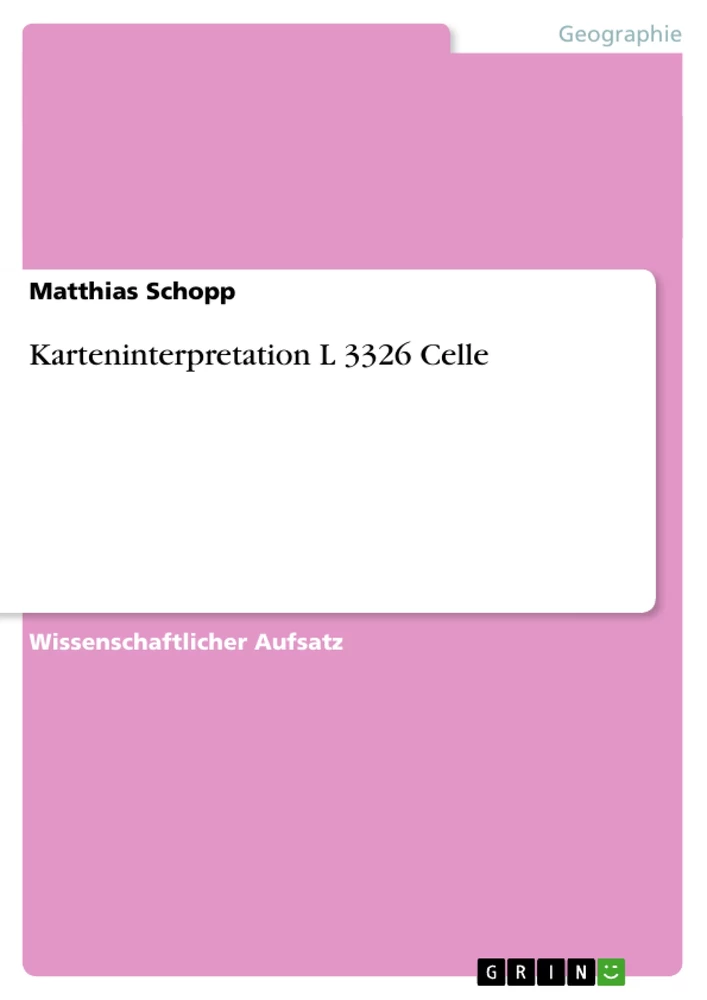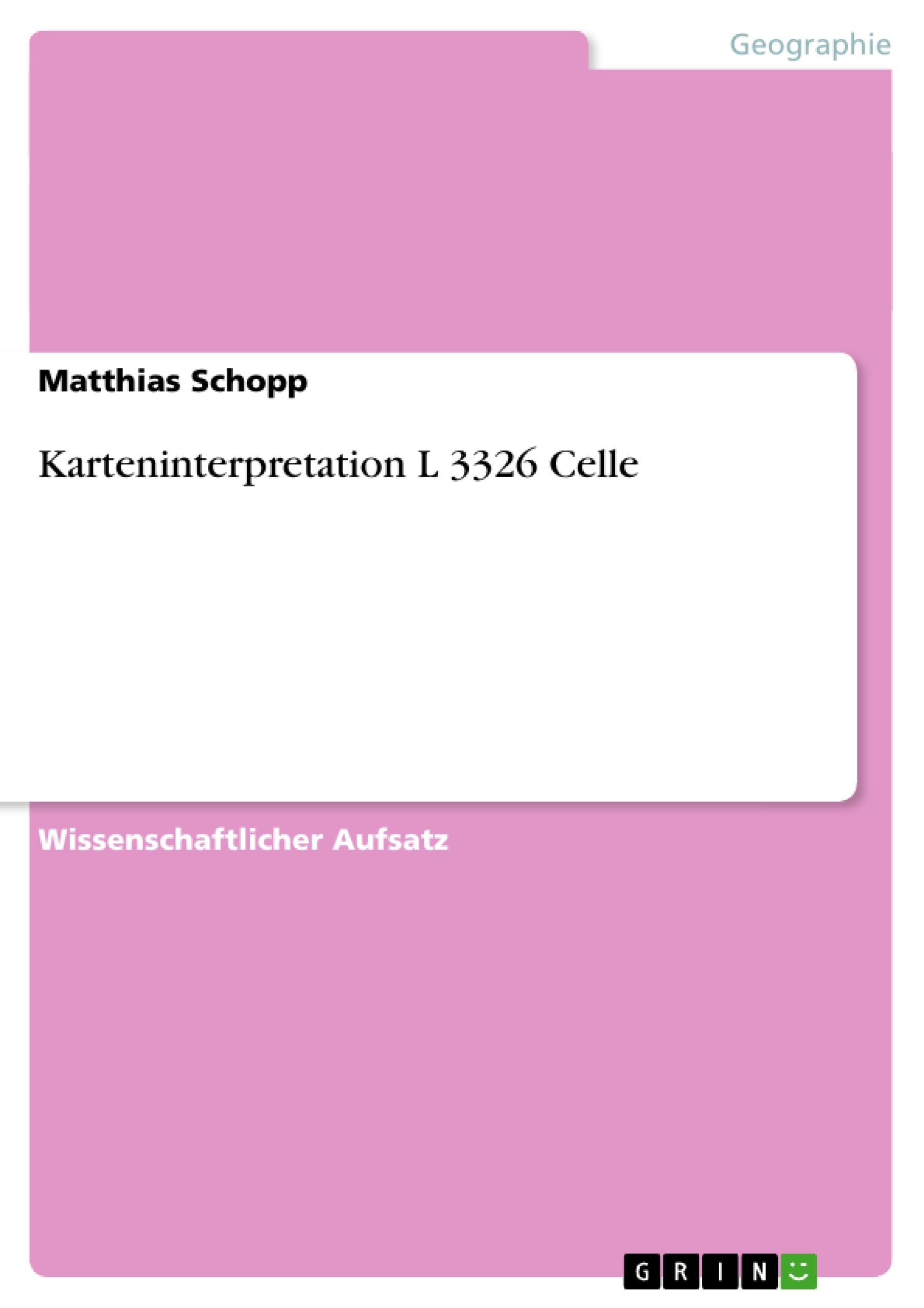Der vorliegende Text beinhaltet eine Interpretation der topographischen Karte L 3326 Celle und dient als Orientierung dafür, was in einer vierstündigen Staatsexamensklausur für eine sehr gute Beurteilung erwartet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Physiogeographische Detailuntersuchung
- 2.1. Teilraum I: Alte Endmoräne
- 2.2. Teilraum II: Sanderflächen
- 2.3. Teilraum III: Alte Grundmoräne
- 2.4. Teilraum IV: Flusstäler
- 3. Kulturgeographische Detailuntersuchung
- 3.1. Siedlungsgenese
- 3.2. Stadt Celle
- 3.3. Land-/Forstwirtschaft und Industrie
- 3.4. Tourismus/Naherholung/Verkehr
- 4. Synthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die topographische Karte L 3326 Celle des Weser-Aller-Flachlandes und eines Teils der Lüneburger Heide. Ziel ist es, die physio- und kulturgeographischen Merkmale des Gebietes zu interpretieren und die unterschiedlichen Teilräume anhand eines länderkundlichen Vergleichs zu charakterisieren. Die Analyse basiert auf der Interpretation von Geländeformen, Gewässerstrukturen, Siedlungsmerkmalen und der Landnutzung.
- Interpretation von Geländeformen im Norddeutschen Tiefland
- Analyse der glazialen Überprägung und deren Auswirkungen auf die Landschaft
- Charakterisierung der verschiedenen Teilräume (Endmoräne, Sanderflächen, Grundmoräne, Flusstäler)
- Zusammenhang zwischen Geologie, Boden und Landnutzung
- Einfluss anthropogener Faktoren auf die Landschaftsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Kartenblatt L 3326 Celle ein, welches einen ländlich geprägten Ausschnitt des Weser-Aller-Flachlandes mit Teilen der Lüneburger Heide zeigt. Die Karte wird als Grundlage für eine länderkundliche Vergleichsanalyse der verschiedenen Teilräume beschrieben, die sich durch offensichtliche Unterschiede auszeichnen. Die methodische Vorgehensweise wird kurz erläutert.
2. Physiogeographische Detailuntersuchung: Dieses Kapitel analysiert die physiogeographischen Merkmale der vier Teilräume. Es werden Geländeformen, Geologie, Böden und Gewässer beschrieben und interpretiert. Der Fokus liegt auf der glazialen Prägung des Gebietes und der Unterscheidung zwischen Alt- und Jungmoränenlandschaften. Die Analyse der einzelnen Teilräume (Alte Endmoräne, Sanderflächen, Alte Grundmoräne und Flusstäler) beinhaltet die Erläuterung ihrer Entstehung, der charakteristischen Merkmale und der jeweiligen Landnutzung.
2.1. Teilraum I: Alte Endmoräne: Dieser Abschnitt beschreibt den Teilraum I, die Alte Endmoräne, charakterisiert durch unruhigen Isohypsenverlauf und höchste absolute Höhen. Die relative Fließgewässerarmut deutet auf wasserdurchlässiges Material hin. Die Analyse stützt sich auf die Zuordnung zu den Ablagerungen der Saale-Vereisung (Warthe-Stadium), basierend auf dem gegliederten Relief und dem Vorhandensein von Seen, die als Toteisseen oder anthropogen entstanden interpretiert werden. Ungünstige Böden und Bewaldung werden ebenfalls als unterstützende Merkmale erwähnt.
2.2. Teilraum II: Sanderflächen: Teilraum II, die Sanderflächen, zeichnen sich durch ein ausgeglicheneres Relief im Vergleich zur Endmoräne aus. Die leicht südliche Neigung und die starke Bewaldung werden als Hinweise auf Sanderflächen gedeutet. Die Beschaffenheit der Böden (Podsol) und die anthropogene Genese der Teiche werden erläutert. Das Beispiel des Klosterhof Salinenmoor veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Geographie, Geschichte und Landnutzung, insbesondere den mittelalterlichen Salzabbau im Zusammenhang mit Mooren und der Geologie (Zechsteinsalz).
Schlüsselwörter
Topographische Karteninterpretation, Weser-Aller-Flachland, Lüneburger Heide, Glaziale Serie, Endmoräne, Sanderflächen, Grundmoräne, Flusstäler, Geologie, Boden, Landnutzung, Siedlungsgenese, Anthropogene Einflüsse, Saale-Vereisung, Zechsteinsalz.
Häufig gestellte Fragen zur länderkundlichen Analyse des Kartenblattes L 3326 Celle
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die topographische Karte L 3326 Celle, welche einen Ausschnitt des Weser-Aller-Flachlandes und Teile der Lüneburger Heide zeigt. Ziel ist die Interpretation der physio- und kulturgeographischen Merkmale und die Charakterisierung der verschiedenen Teilräume mittels länderkundlichen Vergleichs.
Welche Teilräume werden untersucht?
Die Analyse umfasst vier Teilräume: Alte Endmoräne, Sanderflächen, Alte Grundmoräne und Flusstäler. Jeder Teilraum wird hinsichtlich seiner Geländeformen, Geologie, Böden, Gewässer und Landnutzung untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse basiert auf der Interpretation von Geländeformen, Gewässerstrukturen, Siedlungsmerkmalen und der Landnutzung, die auf der topographischen Karte ersichtlich sind. Ein länderkundlicher Vergleich dient der Charakterisierung der unterschiedlichen Teilräume.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine physiogeographische Detailuntersuchung (mit Unterkapiteln zu den einzelnen Teilräumen), eine kulturgeographische Detailuntersuchung und eine Synthese. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, Angaben zur Zielsetzung und zu den Themenschwerpunkten sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der physiogeographischen Untersuchung?
Die physiogeographische Untersuchung charakterisiert die vier Teilräume anhand ihrer spezifischen Merkmale. So wird die Alte Endmoräne durch ein unruhiges Relief und wasserdurchlässiges Material beschrieben, die Sanderflächen durch ein ausgeglicheneres Relief und Bewaldung, die Alte Grundmoräne durch (hier fehlen Details im gegebenen Text) und die Flusstäler durch (hier fehlen Details im gegebenen Text). Die glaziale Prägung des Gebietes und die Unterscheidung zwischen Alt- und Jungmoränenlandschaften spielen eine zentrale Rolle.
Welche Aspekte werden in der kulturgeographischen Untersuchung behandelt?
Die kulturgeographische Untersuchung befasst sich mit der Siedlungsgenese, der Stadt Celle, der Land-/Forstwirtschaft und Industrie sowie dem Tourismus/der Naherholung/dem Verkehr. (Details zu diesen Punkten fehlen im gegebenen Text).
Welche Rolle spielt die Geologie?
Die Geologie spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Geländeformen, Böden und die Landnutzung beeinflusst. Die Analyse bezieht sich auf die Ablagerungen der Saale-Vereisung (Warthe-Stadium) und den Zusammenhang zwischen Zechsteinsalz und der Landnutzung (z.B. im Beispiel Klosterhof Salinenmoor).
Welche anthropogenen Einflüsse werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Einfluss anthropogener Faktoren auf die Landschaftsentwicklung, beispielsweise durch den mittelalterlichen Salzabbau im Zusammenhang mit Mooren und der Geologie (Zechsteinsalz) und die Entstehung anthropogener Teiche.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Topographische Karteninterpretation, Weser-Aller-Flachland, Lüneburger Heide, Glaziale Serie, Endmoräne, Sanderflächen, Grundmoräne, Flusstäler, Geologie, Boden, Landnutzung, Siedlungsgenese, Anthropogene Einflüsse, Saale-Vereisung, Zechsteinsalz.
- Quote paper
- Matthias Schopp (Author), 2014, Karteninterpretation L 3326 Celle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284861