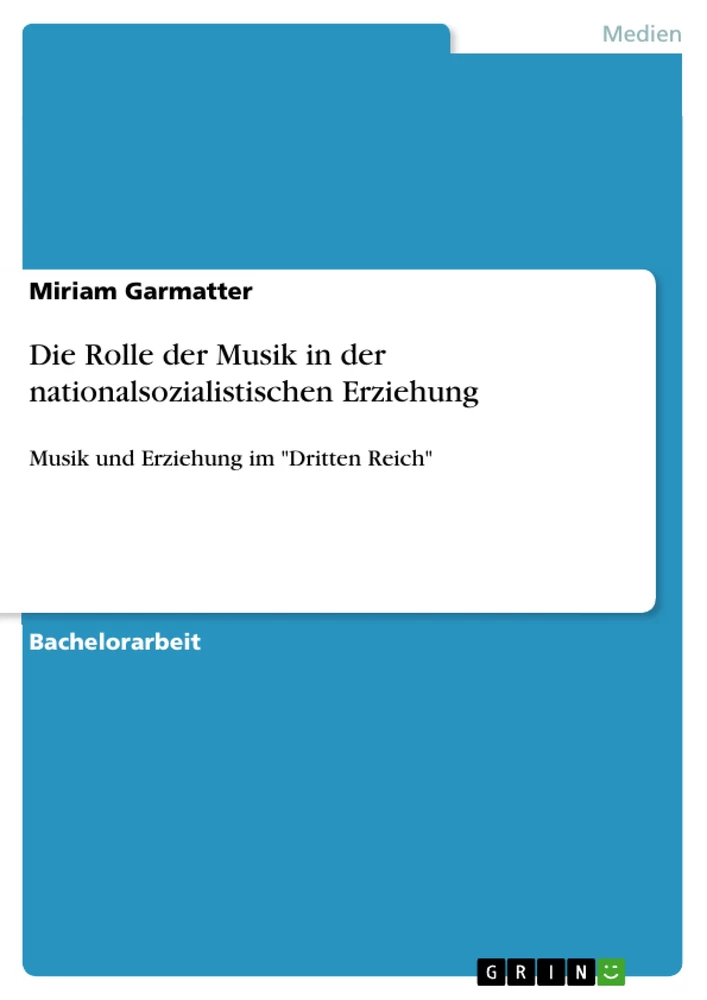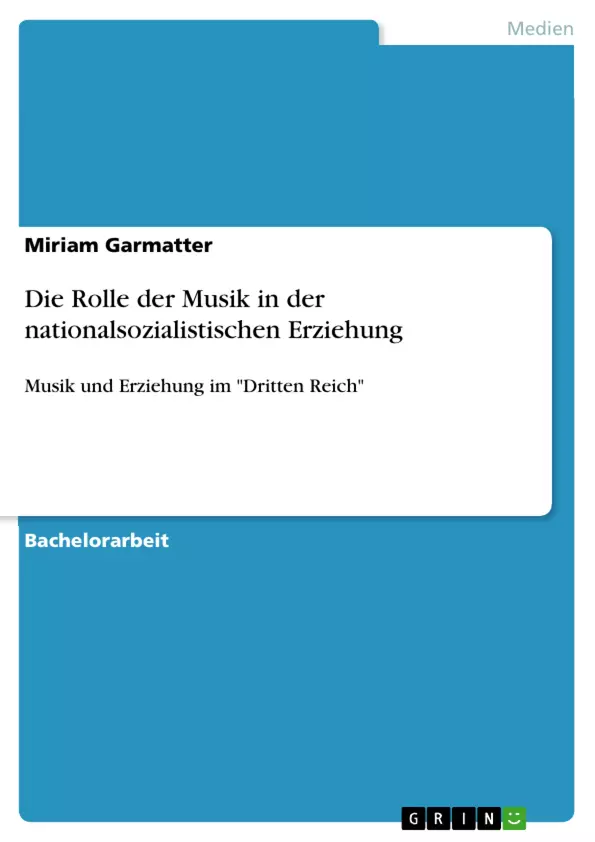Musik hat auf den Menschen je nach Art der Musik und Situation eine unterschiedliche Wirkung. Haisch, welcher den Versuch unternimmt Musik psychoanalytisch zu deuten, fasst den Unterschied zwischen Musik und Sprache ihren Einfluss auf den Menschen treffend zusammen.
"Die Musik begreift weiterreichende und subtilere Bezirke als das gesprochene Wort. Der offenkundige Mangel an Genauigkeit der Tonsprache erklärt sich teils aus ihrer außerordentlichen Generalität, die bis an das Wort heranreicht, teils daraus, dass die affektiven Besetzungen von verdrängten Vorstellungsinhalten leicht auf nichtsprachliche, einfach-klangliche Träger verlagert werden." (Haisch, In: Musik und Macht, von Fred Prieberg. Frankfurt am Main 1991, S. 87)
Besonders in schwierigen Situationen suchen Menschen nach Auswegen und Gelegenheiten, die ihnen ihre Probleme im Alltag erträglicher machen. Freud stellte 1930 fest, dass Menschen hierfür drei Möglichkeiten besitzen: Linderung von Problemen, Enttäuschungen oder Schmerzen kann durch Ablenkungen, Ersatzbefriedigungen oder Rauschmittel geschehen, da die Einschätzung einer schwierigen Lage bei Ablenkung positiver ausfällt, der Schmerz und die Probleme durch Ersatzbefriedigungen gemindert werden und Rauschmittel sogar dazu führen, dass diese gar nicht erst empfunden bzw. wahrgenommen werden. "Die Ersatzbefriedigungen, wie die Kunst sie bietet, sind gegen die Realität Illusionen, darum nicht minder psychisch wirksam dank der Rolle, die die Phantasie im Seelenleben behauptet hat."
(Freud, Siegmund: Das Unbehagen in der Kultur. Wien 1930, S. 22.)
Prieberg greift Freuds These auf und liefert eine treffende Begründung für diese Art der Nutzung von Musik, die allgemein in autoritären Gemeinwesen und speziell im „Dritten Reich“ wiederzufinden ist: Das Ziel eines autoritären Regimes ist die „Kollektivierung“ des Volkes. Diese wird erreicht, indem das Volkes „unter Musik gesetzt“ und so über die Realität des Alltages im NS-Staat hinweggetäuscht wird.(Vgl. Prieberg 1982, S. 242.)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vorhandene Quellen zur Musikerziehung
- 3 Erziehungsvorstellung im „Dritten Reich“
- 3.1 Allgemeine pädagogische Leitlinien und Erziehungsvorstellungen
- 3.2 „Musische Erziehung“ als eine Leitidee der NS-Erziehung
- 4 Musik und Politik im „Dritten Reich“
- 4.1 Funktionaler Einsatz von Musik im Nationalsozialismus
- 4.1.1 Hitlers Propagandatheorie der Massenpsychologie
- 4.1.2 Subtiler Einsatz von Propaganda als Prinzip des Propagandaministers
- 4.1.3 Das Zusammenwirken von Musik und NS-Ideologie zur Schaffung einer „Gesinnungsgemeinschaft“
- 4.2 Unstimmigkeiten und Unklarheiten in der Musikpolitik
- 4.3 Gründe für die Vereinnahmung der Musikerziehung durch die Nationalsozialisten
- 4.1 Funktionaler Einsatz von Musik im Nationalsozialismus
- 5 Musikerziehung in der Hitlerjugend
- 5.1 Historische Entwicklung der Musikarbeit in der Hitlerjugend
- 5.2 Gliederung der Musikarbeit der Hitlerjugend nach Wolfgang Stumme
- 5.3 Die Musik als Vermittlerin eines Gemeinschaftsgefühls
- 5.4 Singen in der Hitlerjugend
- 5.4.1 Funktion der Lieder: Indoktrination durch Singen
- 5.4.2 Das Liedgut in der Hitlerjugend
- 5.4.3 Wirkung der Lieder und des Singens im „Dritten Reich“
- 5.4.4 Langzeitwirkung der Lieder
- 5.5 Instrumentalmusik in der HJ
- 5.6 Die Verantwortung der Musikerzieher in der Hitlerjugend
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rolle der Musik in der nationalsozialistischen Erziehung, insbesondere in der Hitlerjugend. Ziel ist es, den funktionalen Einsatz von Musik in der NS-Propaganda zu analysieren und die Wechselwirkungen zwischen Musik, Ideologie und Erziehung aufzuzeigen. Dabei wird auch die Frage nach der Verantwortung der Musikerzieher beleuchtet.
- Funktionaler Einsatz von Musik in der NS-Propaganda
- Die Rolle der Musik in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen im „Dritten Reich“
- Analyse der Musikarbeit in der Hitlerjugend
- Vermittlung von Gemeinschaftsgefühl durch Musik
- Vergleich der musikpädagogischen Praxis vor und nach 1933
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Musik in der nationalsozialistischen Erziehung dar und begründet die Wahl der Hitlerjugend als Fallbeispiel. Sie thematisiert die kontroverse Debatte um die Bewertung der Musikarbeit in der HJ und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an, der die Ebenen von Absicht, Umsetzung und Wirkung unterscheidet. Die Definition des Begriffs „Musikerziehung“ wird im Kontext der Arbeit eingegrenzt.
2 Vorhandene Quellen zur Musikerziehung: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen bei der Verwendung von Quellen aus der NS-Zeit. Es diskutiert die Schwierigkeiten, die Authentizität von Veröffentlichungen zu beurteilen, da Ängste und Zwänge die Aussagen beeinflussen konnten. Die Arbeit differenziert zwischen offiziellen Veröffentlichungen und Liedern, Schulbüchern und anderen Materialien, die Einblicke in die musikalische Praxis bieten.
3 Erziehungsvorstellung im „Dritten Reich“: Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeinen pädagogischen Leitlinien und Erziehungsvorstellungen des Nationalsozialismus. Es untersucht die Bedeutung der „musischen Erziehung“ als Leitidee und setzt sie in den Kontext der NS-Ideologie. Der Fokus liegt auf der Frage, wie musikalische Erziehung zur Vermittlung der nationalsozialistischen Weltanschauung eingesetzt wurde.
4 Musik und Politik im „Dritten Reich“: Dieses Kapitel analysiert den funktionalen Einsatz von Musik im Nationalsozialismus. Es untersucht Hitlers Propagandatheorie, den subtilen Einsatz von Propaganda und das Zusammenwirken von Musik und NS-Ideologie zur Schaffung einer „Gesinnungsgemeinschaft“. Weiterhin werden Unstimmigkeiten und Unklarheiten in der Musikpolitik thematisiert sowie die Gründe für die Vereinnahmung der Musikerziehung durch die Nationalsozialisten erörtert.
5 Musikerziehung in der Hitlerjugend: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Musikerziehung innerhalb der Hitlerjugend. Es untersucht die historische Entwicklung der Musikarbeit, deren Gliederung nach Wolfgang Stumme und die Rolle der Musik bei der Vermittlung eines Gemeinschaftsgefühls. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Singen in der HJ, einschließlich der Indoktrination durch Lieder, deren Liedgut, Wirkung und Langzeitwirkung. Die Rolle der Instrumentalmusik und die Verantwortung der Musikerzieher werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Musikerziehung, Nationalsozialismus, Hitlerjugend, Propaganda, Musikpädagogik, NS-Ideologie, Gemeinschaftsgefühl, Liedgut, Indoktrination, Wirkung von Musik, Quellenkritik, Totalitarismus.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Musikerziehung in der Hitlerjugend
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Musik in der nationalsozialistischen Erziehung, insbesondere innerhalb der Hitlerjugend. Sie analysiert den funktionalen Einsatz von Musik in der NS-Propaganda und die Wechselwirkungen zwischen Musik, Ideologie und Erziehung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verantwortung der Musikerzieher.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den funktionalen Einsatz von Musik in der NS-Propaganda; die Rolle der Musik in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen im Dritten Reich; eine Analyse der Musikarbeit in der Hitlerjugend; die Vermittlung von Gemeinschaftsgefühl durch Musik; und einen Vergleich der musikpädagogischen Praxis vor und nach 1933. Sie umfasst auch eine Auseinandersetzung mit der Quellenkritik im Umgang mit Materialien aus der NS-Zeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in folgende Kapitel: Einleitung; Vorhandene Quellen zur Musikerziehung; Erziehungsvorstellung im „Dritten Reich“; Musik und Politik im „Dritten Reich“; Musikerziehung in der Hitlerjugend (inkl. detaillierter Analyse des Singens und der Instrumentalmusik in der HJ und der Verantwortung der Musikerzieher); und Fazit. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden Übersicht zusammengefasst.
Wie wird der funktionale Einsatz von Musik in der NS-Propaganda analysiert?
Die Arbeit analysiert Hitlers Propagandatheorie, den subtilen Einsatz von Propaganda und das Zusammenwirken von Musik und NS-Ideologie zur Schaffung einer „Gesinnungsgemeinschaft“. Sie beleuchtet auch Unstimmigkeiten und Unklarheiten in der Musikpolitik des NS-Regimes und die Gründe für die Vereinnahmung der Musikerziehung durch die Nationalsozialisten.
Welche Rolle spielte das Singen in der Hitlerjugend?
Die Arbeit untersucht die Funktion der Lieder als Instrument der Indoktrination, analysiert das Liedgut der Hitlerjugend und beleuchtet die Wirkung und Langzeitwirkung des Singens im Dritten Reich.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen bei der Verwendung von Quellen aus der NS-Zeit und diskutiert die Schwierigkeiten, die Authentizität von Veröffentlichungen zu beurteilen. Sie differenziert zwischen offiziellen Veröffentlichungen und Liedern, Schulbüchern und anderen Materialien, die Einblicke in die musikalische Praxis bieten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird in der Zusammenfassung nicht explizit genannt, aber die Arbeit untersucht die Rolle der Musik in der nationalsozialistischen Erziehung und die Verantwortung der Musikerzieher, was zu entsprechenden Schlussfolgerungen führen wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Musikerziehung, Nationalsozialismus, Hitlerjugend, Propaganda, Musikpädagogik, NS-Ideologie, Gemeinschaftsgefühl, Liedgut, Indoktrination, Wirkung von Musik, Quellenkritik, Totalitarismus.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sind im HTML-Dokument enthalten und beschreiben den Inhalt jedes Kapitels detailliert.
- Quote paper
- Miriam Garmatter (Author), 2010, Die Rolle der Musik in der nationalsozialistischen Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267155