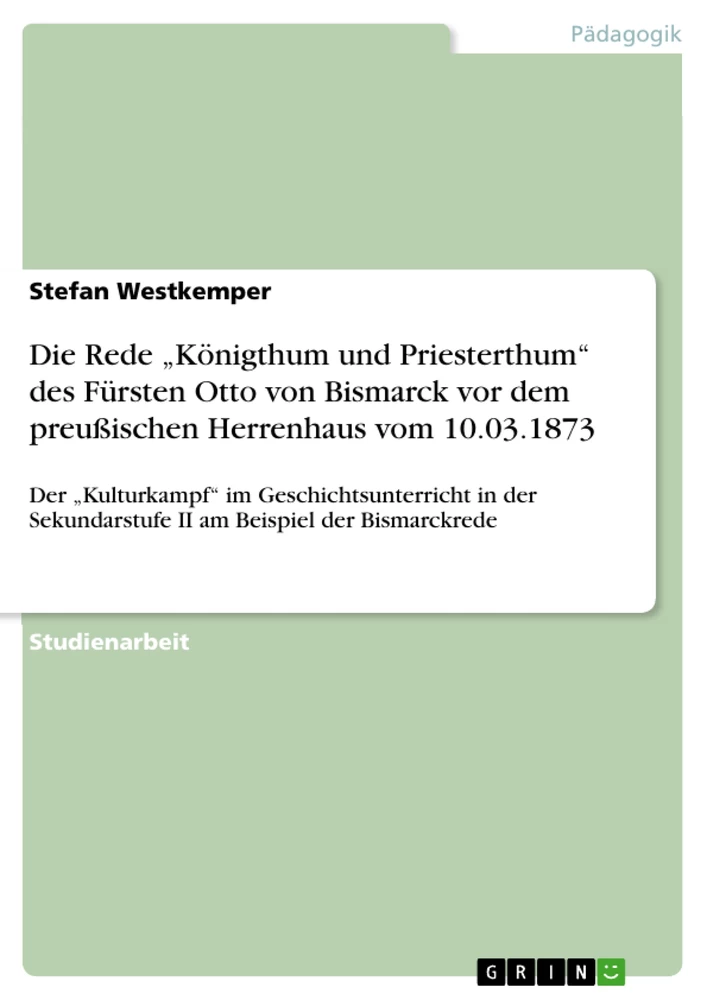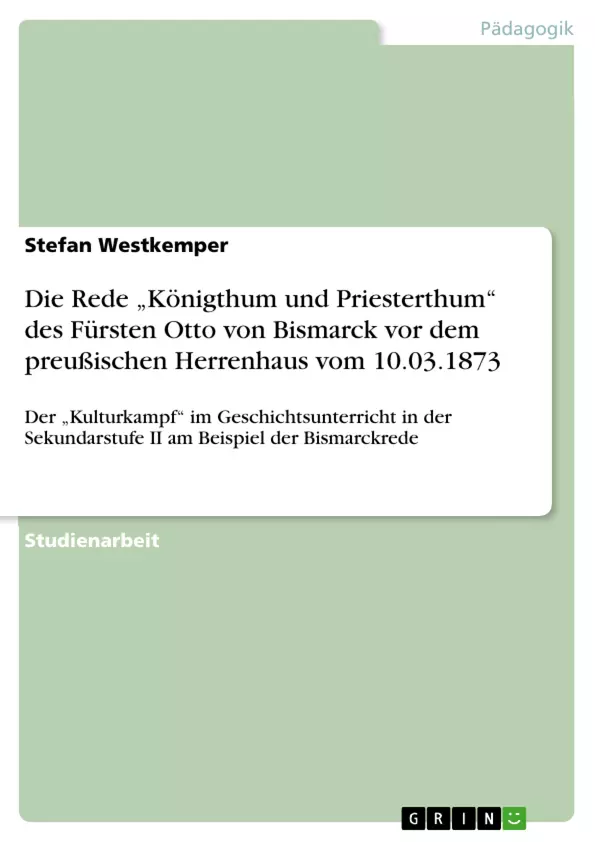Der in dieser Arbeit behandelte Aspekt des Themenfeldes Kulturkampf ist im Geschichtsunterricht in der Schule – egal ob in der Sekundarstufe I oder II – oftmals unterrepräsentiert. […] Dennoch bietet der Konflikt Preußens und damit des Deutschen Reichs, und für diese stellvertretend Bismarcks, mit der ka-tholischen Kirche bzw. dem Papst viele Anknüpfungspunkte, um im Geschichtsunterricht behandelt zu werden.
Diese Arbeit soll das Thema fachdidaktisch zugänglich machen und ist deshalb in die folgenden zwei Teile gegliedert: Zuerst wird die Rede Bismarcks in ihren historischen Kontext eingeordnet, was allerdings aufgrund des Kontextes dieser Arbeit nur in gebotener Kürze und überblickshaft geschehen kann – was auch dazu führt, dass ein geringeres Maß an wissenschaftliche Fachliteratur verwendet und auf Überblicksdarstellungen zurückgegriffen wird. Der zweite Teil ist der Hauptteil der Arbeit. Er befasst sich mit der „Nutzbarmachung“ der Rede für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II. Dabei soll die Rede nicht als Hauptanalysegegenstand verwendet werden, sondern als Hintergrund und Begründung dienen, anhand derer die folgenden fachdidaktischen und unterrichtsbezogenen Aspekte er- bzw. abgearbeitet werden: die Rede nach dem Interpretationsmodell von Tischner einordnen und erschließen, das didaktische Potenzial der Rede aufzeigen, das Aufzeigen der Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler anhand der Rede erlernen und trainieren (ggf. wiederholen) können. Zum Schluss soll noch kurz etwas über das Thema des Kulturkampfes in Schulbüchern gesagt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Einordnung der Bismarck-Rede „Königthum und Priesterthum“ in den historischen Kontext
- a) Zur Person Bismarcks
- b) Papst Pius IX und die "Radikalisierung" der Katholischen Kirche
- c) Der Kampf Bismarcks gegen den Ultramontanismus
- III. Einordnung des Lerngegenstands in den Lehrplan Sek. II für NRW
- IV. Didaktisches Potenzial der Rede
- a) Zu erlernende Kompetenzen
- b) Methoden- und Sachkompetenz nach Tischner
- c) Zusätzlich zu erlernende Kompetenzen
- d) Weiteres didaktisches Potenzial
- V. Verwendung im Unterricht und Beispielaufgaben
- VI. Das Thema „Kulturkampf“ in Schulbüchern
- VII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den „Kulturkampf“ und insbesondere Bismarcks Rede „Königthum und Priesterthum“ für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II aufzuarbeiten und didaktisch nutzbar zu machen. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Rede und zeigt ihr didaktisches Potenzial auf. Der Fokus liegt auf der Erschließung relevanter Kompetenzen für Schüler und der Einordnung der Thematik in den Lehrplan.
- Der historische Kontext des Kulturkampfes und Bismarcks Rolle darin.
- Das didaktische Potenzial der Bismarck-Rede für den Geschichtsunterricht.
- Die im Unterricht zu vermittelnden Kompetenzen anhand der Rede.
- Die Darstellung des Kulturkampfes in Schulbüchern.
- Die Einordnung der Rede nach dem Interpretationsmodell von Tischner.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Unterrepräsentanz des Kulturkampfes im Geschichtsunterricht fest und begründet die Notwendigkeit, dieses Thema – am Beispiel der Bismarckrede – didaktisch aufzuarbeiten. Sie betont den Gegenwartsbezug und die Parallelen zum Kampf gegen die Sozialdemokratie, beide Konflikte zielten auf die innere Einigung des Deutschen Reiches ab. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: die Einordnung der Rede in den historischen Kontext und die didaktische Aufarbeitung für den Unterricht.
II. Die Einordnung der Bismarck-Rede „Königthum und Priesterthum“ in den historischen Kontext: Dieses Kapitel ordnet Bismarcks Rede in den historischen Kontext ein, indem es auf die Person Bismarcks, Papst Pius IX. und die Radikalisierung der katholischen Kirche sowie Bismarcks Kampf gegen den Ultramontanismus eingeht. Der Fokus liegt auf der fachdidaktischen Perspektive, um die Rede für den Unterricht nutzbar zu machen. Es wird zwar nur ein Überblick geboten, aber die Bedeutung von Bismarck als herausragende Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts und sein Einfluss auf den „Lauf der Geschichte“ werden hervorgehoben. Sein Machtstreben und autoritärer Führungsstil werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kulturkampf, Otto von Bismarck, Königthum und Priesterthum, katholische Kirche, Ultramontanismus, Deutsches Reich, Geschichtsunterricht, Sekundarstufe II, Fachdidaktik, Lehrplan, Kompetenzen, Tischner, Schulbücher.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bismarck-Rede „Königthum und Priesterthum“ – Didaktische Aufarbeitung für den Geschichtsunterricht
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit konzentriert sich auf die didaktische Aufarbeitung von Bismarcks Rede „Königthum und Priesterthum“ und dem Kulturkampf für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen. Sie untersucht den historischen Kontext der Rede und zeigt ihr didaktisches Potenzial auf, mit besonderem Augenmerk auf die Vermittlung relevanter Kompetenzen an Schüler.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Kontext des Kulturkampfs und Bismarcks Rolle, das didaktische Potenzial der Bismarck-Rede, die im Unterricht zu vermittelnden Kompetenzen, die Darstellung des Kulturkampfs in Schulbüchern und die Einordnung der Rede nach dem Interpretationsmodell von Tischner. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Einordnung der Rede in den historischen Kontext (inkl. Bismarck, Papst Pius IX. und Ultramontanismus), die Einordnung in den Lehrplan Sek. II NRW, das didaktische Potenzial der Rede, Beispiele für den Unterricht, die Darstellung des Themas in Schulbüchern und ein Fazit.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die den historischen Kontext der Bismarck-Rede beleuchten und deren didaktischen Einsatz im Unterricht aufzeigen. Sie umfasst eine Einleitung, die den Mangel an Behandlung des Kulturkampfes im Geschichtsunterricht darlegt. Es folgen Kapitel zur Einordnung der Rede in den historischen Kontext (Bismarck, Papst Pius IX., Ultramontanismus), zur didaktischen Einordnung im Lehrplan, zum didaktischen Potenzial der Rede (inkl. Kompetenzen nach Tischner), zur Verwendung im Unterricht mit Beispielaufgaben, zur Darstellung des Kulturkampfes in Schulbüchern und schließlich ein Fazit.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler durch die Auseinandersetzung mit der Rede erwerben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Kompetenzen, die Schüler durch die Bearbeitung der Bismarck-Rede erwerben sollen. Diese umfassen sowohl Methoden- als auch Sachkompetenz nach Tischner und weitere didaktische Potenziale, die die Arbeit herausarbeitet.
Wie wird die Rede im Unterricht eingesetzt?
Die Arbeit enthält Vorschläge zur Verwendung der Bismarck-Rede im Unterricht und präsentiert Beispielaufgaben, um die didaktische Umsetzung zu erleichtern. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung von historischen Hintergründen und der Entwicklung von analytischen Fähigkeiten der Schüler.
Welche Rolle spielt Tischners Interpretationsmodell?
Das Interpretationsmodell von Tischner dient als analytisches Werkzeug, um die Bismarck-Rede zu verstehen und deren didaktisches Potenzial zu erschließen. Die Arbeit zeigt auf, wie dieses Modell angewendet werden kann, um die Kompetenzen der Schüler zu fördern.
Wie wird der Kulturkampf in Schulbüchern dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung des Kulturkampfes in verschiedenen Schulbüchern und bewertet deren didaktische Qualität und Vollständigkeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Kulturkampf, Otto von Bismarck, Königthum und Priesterthum, katholische Kirche, Ultramontanismus, Deutsches Reich, Geschichtsunterricht, Sekundarstufe II, Fachdidaktik, Lehrplan, Kompetenzen, Tischner, Schulbücher.
- Citar trabajo
- Stefan Westkemper (Autor), 2013, Die Rede „Königthum und Priesterthum“ des Fürsten Otto von Bismarck vor dem preußischen Herrenhaus vom 10.03.1873 , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213388