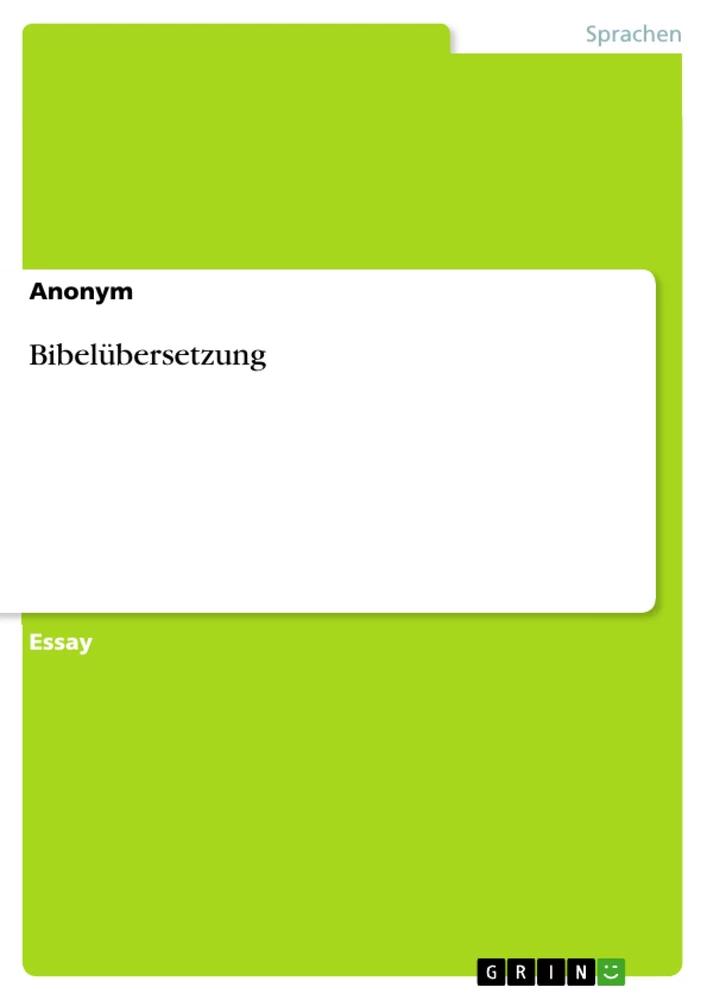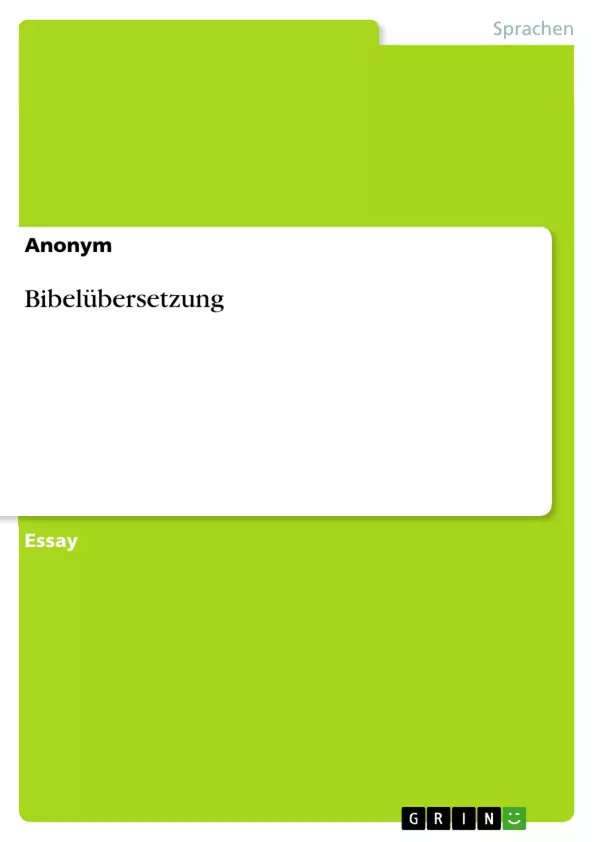So oft wie die Bibel wurde kein anderes Buch auf der Welt übersetzt und verkauft. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn viele kluge Köpfe sich über die Jahrhunderte hinweg den Kopf über die „richtige“ Übersetzung und das richtige Übersetzen zerbrochen haben. Die „Lutherbibel“ und „Die Schrift“ sind zwei der bedeutendsten Bibelübersetzungen. Die Lutherbibel wurde 1534 von Martin Luther vervollständigt und wird in der Liturgie der evangelischen Kirche bis heute verwendet. „Die Schrift“ wurde von Franz Rosenzweig in anfänglicher Zusammenarbeit mit Martin Buber 1938 fertig gestellt und orientierte sich teilweise an Luther. Alle drei Schriftsteller äußern sich in weiteren Texten zu ihren Prinzipien des Übersetzens. Im Folgenden sollen die theoretischen Positionen von Luther mit denen von Rosenzweig und Buber verglichen und in Beziehung gesetzt werden. Als Quellen dienen dazu Luthers „Sendbrief vom Dolmetschen“ (1530), Rosenzweigs „Die Schrift und Luther“ (1926) und Bubers „Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift“ (1954). Das Augenmerk soll auf den Texten Luthers und Rosenzweigs liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung der Übersetzung
- Die Lutherbibel und ihre Prinzipien
- Rosenzweigs und Bubers Übersetzungsprinzipien
- Der Inhalt und die Form in der Übersetzung
- Die Individualität und Unabdingbarkeit der Übersetzung
- Die Übersetzungstechniken von Luther, Rosenzweig und Buber
- Die Bindung an die Sprache
- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Vergleich der theoretischen Positionen von Martin Luther, Franz Rosenzweig und Martin Buber zum Thema Bibelübersetzung. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse ihrer Prinzipien des Übersetzens und der Unterschiede in ihrer Herangehensweise, die sich aus unterschiedlichen historischen Kontexten und Zielsetzungen ergeben.
- Die Bedeutung von Inhalt und Form in der Übersetzung
- Die Rolle der Sprache und des Sprachbewusstseins
- Die Individualität und Subjektivität von Übersetzungen
- Die Unübersetzbarkeit von Sprachen
- Die Entwicklung des Übersetzungsprinzips im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Bedeutung der Bibelübersetzung in den historischen Kontext und führt die wichtigsten Akteure ein: Martin Luther, Franz Rosenzweig und Martin Buber.
- Das Kapitel über die Lutherbibel analysiert Luthers Prinzipien des Übersetzens, die darauf basieren, den Inhalt der Bibel dem Volk zugänglich zu machen.
- Das Kapitel über Rosenzweigs und Bubers Übersetzungsprinzipien beleuchtet deren Ziel, sowohl den Inhalt als auch die Form der Bibel zu vermitteln und den Leser aktiv in den Übersetzungsprozess einzubeziehen.
- Der Abschnitt über Inhalt und Form in der Übersetzung vertieft die Diskussion über die Priorität des Inhalts bei Luther im Vergleich zu Rosenzweigs und Bubers Fokus auf Inhalt und Form.
- Das Kapitel über Individualität und Unabdingbarkeit der Übersetzung stellt die verschiedenen Ansichten der drei Übersetzer über die Einzigartigkeit jeder Übersetzung dar.
- Der Abschnitt über die Übersetzungstechniken vergleicht Luthers sorgfältige Wortwahl mit Bubers spontaner Herangehensweise, die von Rosenzweig teilweise geteilt wird.
- Das Kapitel über die Bindung an die Sprache behandelt die Frage, inwieweit sich die Übersetzer an die Sprache des Zielpublikums und die Ausgangssprache gebunden fühlten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Bibelübersetzung, Übersetzungsprinzipien, Inhalt, Form, Sprache, Sprachbewusstsein, Individualität, Subjektivität, Unübersetzbarkeit, Martin Luther, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Lutherbibel, „Die Schrift“, „Sendbrief vom Dolmetschen“, „Die Schrift und Luther“, „Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift“.
Häufig gestellte Fragen
Welche Prinzipien verfolgte Martin Luther bei seiner Bibelübersetzung?
Luther wollte die Bibel dem Volk zugänglich machen („dem Volk aufs Maul schauen“). Für ihn stand die Verständlichkeit des Inhalts im Vordergrund.
Wie unterschied sich die Übersetzung von Buber und Rosenzweig?
Ihre Übersetzung „Die Schrift“ versuchte, die hebräische Sprachform und den Rhythmus im Deutschen zu erhalten, statt den Text zu glätten.
Was ist Luthers „Sendbrief vom Dolmetschen“?
Ein zentrales Dokument von 1530, in dem Luther seine Übersetzungsmethoden verteidigt und die Bedeutung einer lebendigen Sprache betont.
Welche Rolle spielt die "Form" in der Bibelübersetzung?
Während Luther die Form oft dem Inhalt unterordnete, sahen Rosenzweig und Buber in der Form (Wortwahl, Klang) einen untrennbaren Teil der göttlichen Botschaft.
Ist eine "richtige" Übersetzung der Bibel überhaupt möglich?
Die Arbeit zeigt, dass jede Übersetzung von der Zeit, der Theologie und der individuellen Sichtweise des Übersetzers geprägt ist.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2010, Bibelübersetzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208248