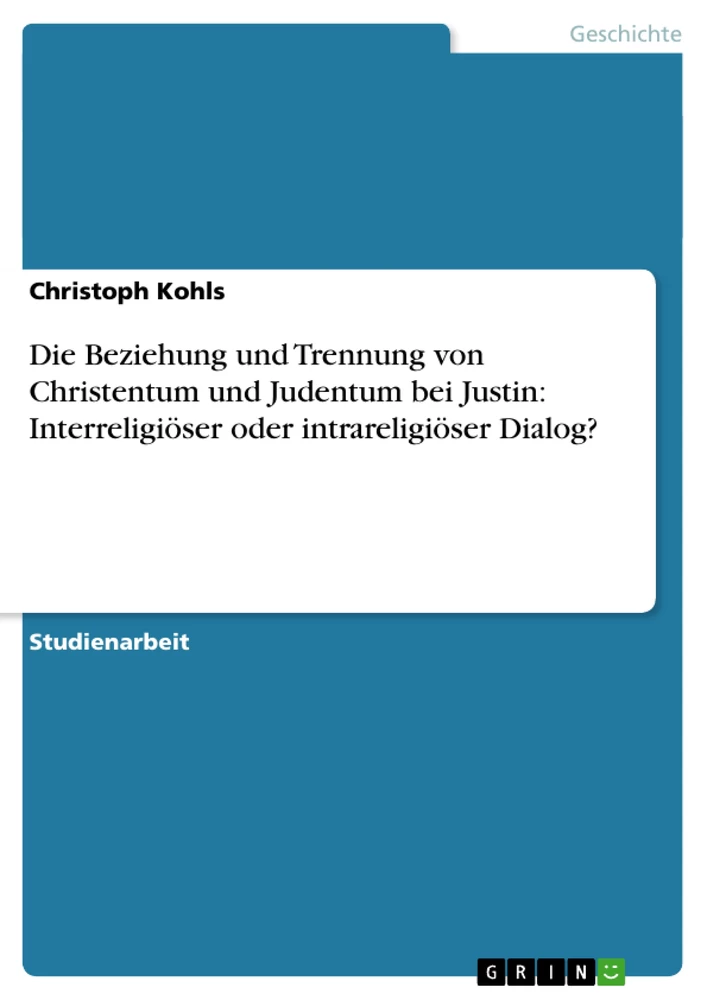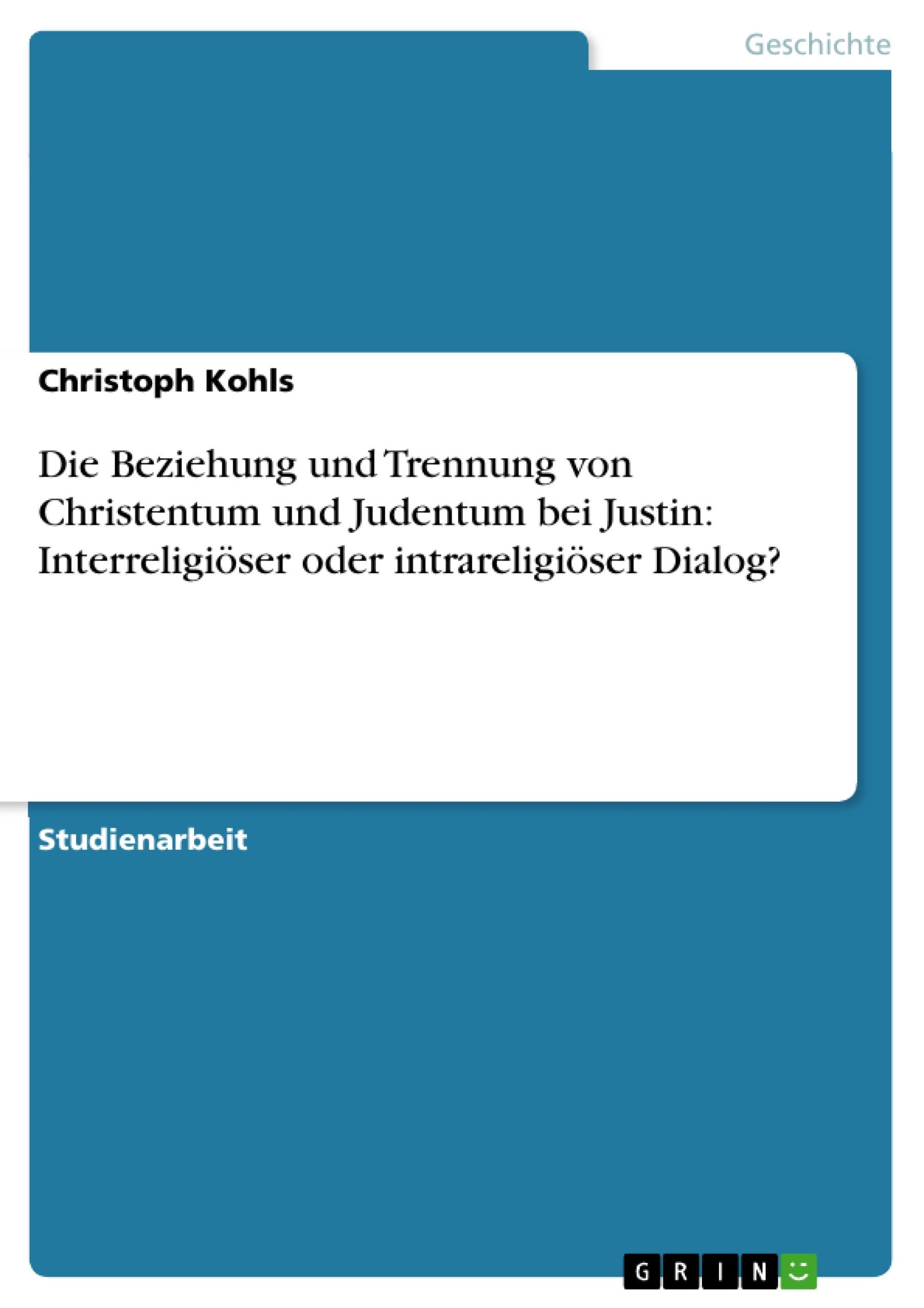Das Christentum war im 2. Jahrhundert n. Chr. noch nicht so etabliert, wie es beispielsweise heutzutage der Fall ist. Die Christen befanden sich in einem Prozess der Selbstfindung, wozu auch und vor allem die Auseinandersetzung mit dem jüdischem Glauben zählte. Anfangs wurde der christliche Glaube als eine jüdische Sekte angesehen, die Entwicklung zeigt jedoch, dass das Christentum sich als eigenständige Religion verstand und sich immer mehr von seinen jüdischen Wurzeln entfremdete, ohne sie jemals ganz zu verlieren. Innerhalb dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden, wie die Beziehung und Trennung zwischen Judentum und Christentum in Justins Apologie „Dialog mit dem Juden Tryphon“ anhand der Kapitel 8,3-43,2 dargestellt wird. Die Fragestellung wird um die Frage erweitert, ob es sich um einen inter- oder intrareligiösen Dialog handelt. Dabei wird zuerst die Situation des Christentums im 2. Jahrhundert skizziert, vor allem auch im Hinblick auf die Stellung zum Judentum. Weiterhin wird die Person Justin charakterisiert, um seine Beweggründe für diese Schrift darzulegen, aber auch, um seinen Weg zum Christentum zu zeigen. Dann wird der „Dialog mit dem Juden Tryphon“ dargestellt, zum Einen bezüglich seines Inhaltes, zum Anderen bezüglich der äußeren Quellenkritik. Daraufhin werden die Ergebnisse zusammengefasst und bezüglich der Fragestellung analysiert. Schließlich wird im Fazit die eingangs gestellte Frage beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Christentum und Judentum im 2. Jahrhundert
- Justin
- Die Schrift „Der Dialog mit dem Juden Tryphon“
- Die Beziehung und Trennung von Christentum und Judentum bei Justin: Interreligiöser oder intrareligiöser Dialog?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung und Trennung zwischen Judentum und Christentum im 2. Jahrhundert n. Chr., fokussiert auf Justins „Dialog mit dem Juden Tryphon“. Die zentrale Fragestellung ist, wie diese Beziehung und Trennung in Justins Werk dargestellt wird und ob es sich dabei um einen inter- oder intrareligiösen Dialog handelt.
- Das Christentum im 2. Jahrhundert und seine Beziehung zum Judentum
- Justins Person und sein Weg zum Christentum
- Der Inhalt und die Quellenkritik von Justins „Dialog mit dem Juden Tryphon“
- Analyse der Beziehung zwischen Judentum und Christentum in Justins Werk
- Klärung der Frage nach dem inter- oder intrareligiösen Charakter des Dialogs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage: Wie wird die Beziehung und Trennung zwischen Judentum und Christentum in Justins „Dialog mit dem Juden Tryphon“ dargestellt, und handelt es sich um einen inter- oder intrareligiösen Dialog? Sie umreißt den methodischen Ansatz, beginnend mit der Situation des Christentums im 2. Jahrhundert, gefolgt von einer Charakterisierung Justins und einer Analyse seines Dialogs. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfrage zusammengefasst und analysiert, um schließlich die eingangs gestellte Frage im Fazit zu beantworten.
2. Das Christentum und Judentum im 2. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Beziehung zwischen Judentum und Christentum im 2. Jahrhundert. Es beginnt mit der Feststellung, dass Jesus zunächst nicht beabsichtigte, eine neue Religion zu gründen, sondern das Judentum zu reformieren. Die anfängliche Betrachtung des Christentums als jüdische Sekte wird erörtert, ebenso wie die Herausbildung des Christentums als eigenständige Religion. Das Kapitel analysiert die Rolle der Judenchristen und Heidenchristen, die unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb des Judentums und den Prozess der wachsenden Abgrenzung und Missbilligung des Christentums durch das Judentum, unter anderem im Kontext des jüdischen Krieges und der Tempelzerstörung. Die zunehmende Abgrenzung und die Herausbildung einer eigenständigen christlichen Identität werden detailliert beschrieben, wobei die Rolle von Paulus und die Herausbildung der christlichen Kirche hervorgehoben werden. Das Kapitel betont den komplexen und langwierigen Prozess der Trennung.
Schlüsselwörter
Christentum, Judentum, 2. Jahrhundert, Justin der Märtyrer, Dialog mit dem Juden Tryphon, Interreligiöser Dialog, Intrareligiöser Dialog, Judenchristen, Heidenchristen, Paulus, Tempelzerstörung, Abgrenzung, Trennung, Religionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Der Dialog mit dem Juden Tryphon" Justins
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Beziehung und Trennung zwischen Judentum und Christentum im 2. Jahrhundert n. Chr., mit besonderem Fokus auf Justins „Dialog mit dem Juden Tryphon“. Die zentrale Frage ist, ob Justins Darstellung einen inter- oder intrareligiösen Dialog repräsentiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Christentum im 2. Jahrhundert und seine Beziehung zum Judentum, Justins Person und seinen Weg zum Christentum, den Inhalt und die Quellenkritik von Justins „Dialog mit dem Juden Tryphon“, eine Analyse der Beziehung zwischen Judentum und Christentum in Justins Werk und die Klärung der Frage nach dem inter- oder intrareligiösen Charakter des Dialogs.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das Christentum und Judentum im 2. Jahrhundert, ein Kapitel über Justin, ein Kapitel über den „Dialog mit dem Juden Tryphon“, ein Kapitel zur Analyse der Beziehung und Trennung bei Justin (inter- oder intrareligiös?) und ein Fazit. Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Die Kapitel fassen jeweils ihren Inhalt zusammen und analysieren ihn im Kontext der Forschungsfrage.
Was wird im Kapitel über das Christentum und Judentum im 2. Jahrhundert behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Beziehung zwischen beiden Religionen im 2. Jahrhundert. Es thematisiert die anfängliche Betrachtung des Christentums als jüdische Sekte, die Herausbildung des Christentums als eigenständige Religion, die Rolle von Judenchristen und Heidenchristen, die unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb des Judentums, den Prozess der wachsenden Abgrenzung und Missbilligung des Christentums durch das Judentum (u.a. im Kontext des jüdischen Krieges und der Tempelzerstörung), die zunehmende Abgrenzung und die Herausbildung einer eigenständigen christlichen Identität (mit Betonung der Rolle des Paulus und der Herausbildung der christlichen Kirche), und den komplexen und langwierigen Prozess der Trennung.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Christentum, Judentum, 2. Jahrhundert, Justin der Märtyrer, Dialog mit dem Juden Tryphon, Interreligiöser Dialog, Intrareligiöser Dialog, Judenchristen, Heidenchristen, Paulus, Tempelzerstörung, Abgrenzung, Trennung, Religionsgeschichte.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie wird die Beziehung und Trennung zwischen Judentum und Christentum in Justins „Dialog mit dem Juden Tryphon“ dargestellt, und handelt es sich um einen inter- oder intrareligiösen Dialog?
Welche Methode wird angewendet?
Der methodische Ansatz beginnt mit der Situation des Christentums im 2. Jahrhundert, gefolgt von einer Charakterisierung Justins und einer Analyse seines Dialogs. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfrage zusammengefasst und analysiert, um die eingangs gestellte Frage im Fazit zu beantworten.
- Citar trabajo
- Christoph Kohls (Autor), 2012, Die Beziehung und Trennung von Christentum und Judentum bei Justin: Interreligiöser oder intrareligiöser Dialog?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207422