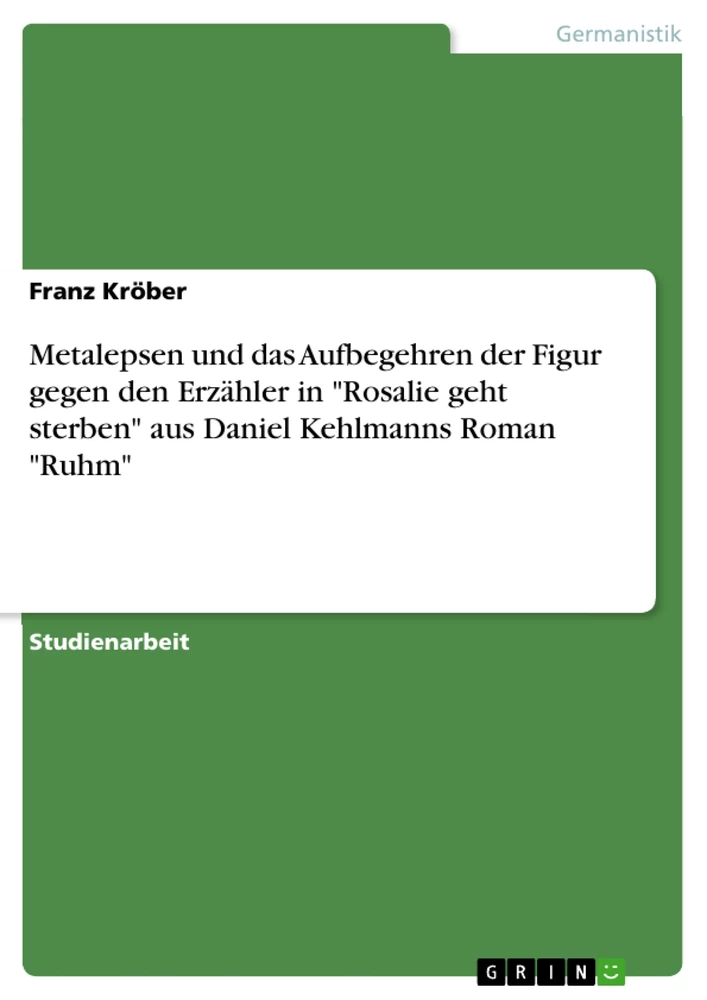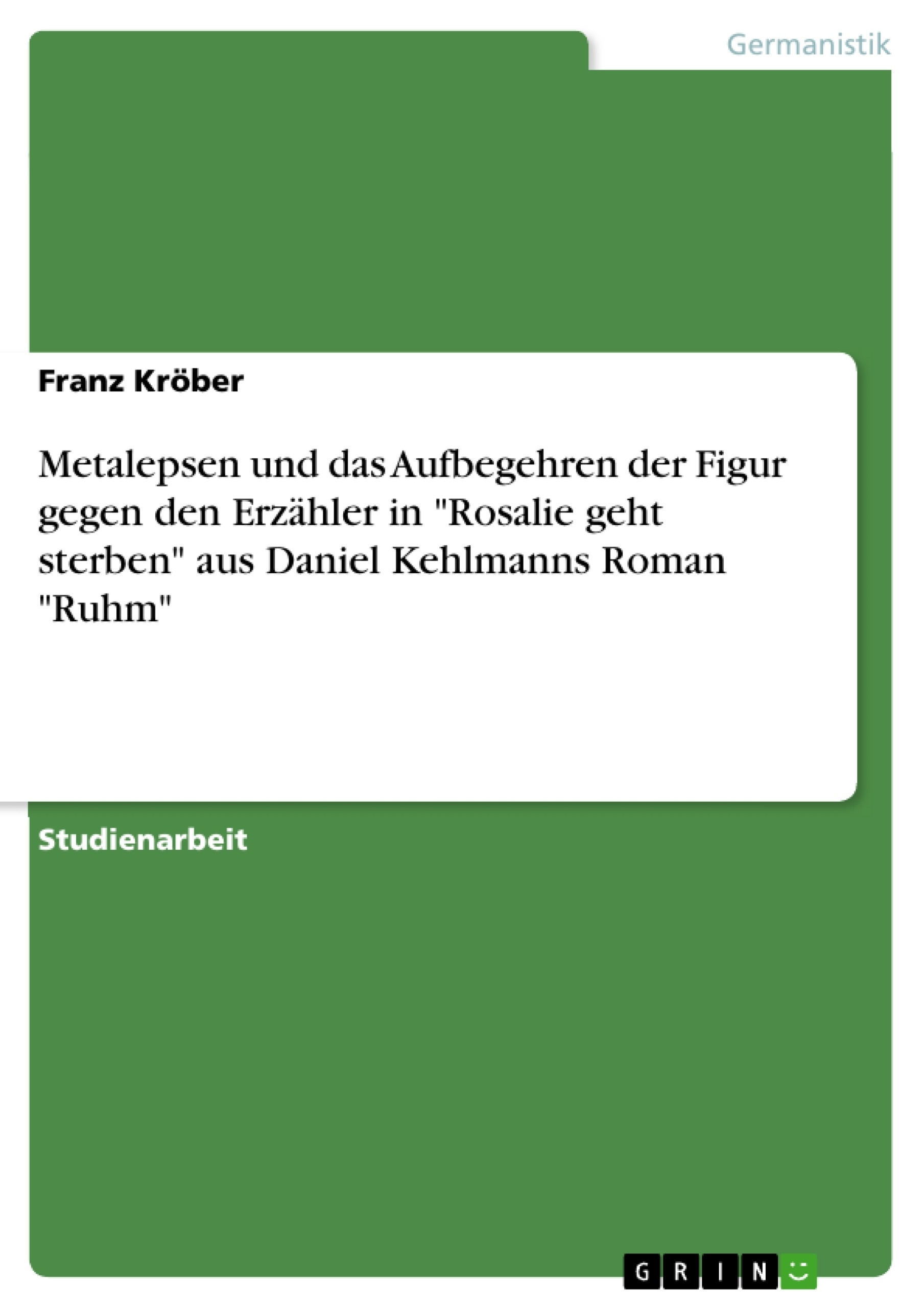Der Realitätsanspruch des extradiegetischen und der fiktionale Charakter des diegetischen Universums in "Rosalie geht sterben" wird durch das Aufbegehren der Hauptfigur, daraus folgenden Metalepsen und schließlich durch das Kapitulieren des Erzählers in Frage gestellt. Diese These wird in der folgenden Erzähltextanalyse untersucht. Da Metalepsen durch das Überqueren der Grenze zwischen dem Erzähler und der erzählten Welt generell die Idee verdeutlichen, die Welt außerhalb der Diegese könne ebenso gut fiktional sein und die Diegese möglicherweise real, scheinen sie das Ringen Rosalies um ihre Realität hervorragend zu illustrieren. Folglich steht am Beginn dieser Arbeit eine knappe Definition dieses narratologischen Phänomens; anschließend wird die Darstellung des Erzählers der Narration als nicht eigenständige Welt, das Aufbegehren Rosalies und letztlich die Kapitulation des Erzählers vor seiner Figur diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Metalepsen: eine Definition
- 3. Erzähltheoretische Analyse zu Rosalie geht sterben
- 3.1 „Du bist meine Erfindung“: die Unselbstständigkeit der Diegese
- 3.2 Die Erzählung als eigenständige Welt: Rosalies Veränderung und Auseinandersetzungen zwischen Erzähler und Figur
- 3.3 Die Kapitulation des Erzählers vor der Figur: Realitätsanspruch von extradiegetischer und diegetischer Welt
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Realitätsanspruch der extradiegetischen und diegetischen Welt in Daniel Kehlmanns "Rosalie geht sterben". Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle von Metalepsen und das Aufbegehren der Hauptfigur Rosalie gegen die omnipotente Erzählinstanz. Ziel ist es, die Funktionsweise von Metalepsen als Mittel der Wirklichkeitshinterfragung zu beleuchten und den Einfluss auf die Deutungshoheit des Erzählers zu analysieren.
- Metalepsen als Mittel der Wirklichkeitshinterfragung
- Das Aufbegehren der Hauptfigur gegen den Erzähler
- Die Ambivalenz des Realitätsanspruchs in der Erzählung
- Die Funktion des metafiktionalen Charakters der Erzählung
- Der Einfluss von Intertextualität auf die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangssituation in Kehlmanns "Rosalie geht sterben" vor: Rosalie, die ihrem Tod durch Suizid zuvorkommen will, ändert schließlich ihren Entschluss und beeinflusst den Erzähler, ihre Geschichte zu verändern. Der omnipräsente Erzähler betont die Fiktionalität der Geschichte und seine Rolle als Schöpfer. Rosalie scheint sich ihrer fiktiven Existenz bewusst zu sein, entwickelt aber zunehmend eine eigene Identität und widersetzt sich dem vorgegebenen Handlungsverlauf. Dies führt zu Metalepsen und stellt den Realitätsanspruch des Erzählers in Frage. Die Arbeit untersucht diese Thematik anhand einer erzähltheoretischen Analyse.
2. Metalepsen: eine Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Metalepse nach Genette und Häsner. Es beschreibt die "bewegliche Grenze" zwischen extradiegetischer und diegetischer Welt und die Transgressionen, die eine Metalepse ausmachen. Häsner betont die "systeminterne Ebenendifferenzierung" und das "zeitliche Gefälle" zwischen Diskurs und Histoire als Voraussetzungen für Metalepsen. Der Effekt der Metalepse wird als "Spiegelung" beschrieben, die den Leser in die Fiktion einbezieht. Metalepsen werden als "eindeutiges Fiktionssignal" gewertet, da sie die logischen Regeln der Erzählung brechen und den Realitätsanspruch untergraben.
3. Erzähltheoretische Analyse zu Rosalie geht sterben: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über "Rosalie geht sterben" als Episode aus Kehlmanns "Ruhm" und seine Verbindungen zu anderen Geschichten und Figuren. Es wird auf die mögliche Identität des Erzählers (Leo Richter oder Miguel Aurisantos Blancos) und die intertextuellen Bezüge zu Paulo Coelhos "Veronika beschließt zu sterben" hingewiesen. Diese Bezüge verstärken den metafiktionalen Charakter der Erzählung, der für die Analyse zentral ist.
3.1 „Du bist meine Erfindung“: Die Unselbständigkeit der Diegese: Dieses Kapitel analysiert den metafiktionalen Charakter der Erzählung und die omnipräsente Rolle des Erzählers, der sich selbst als Schriftsteller präsentiert. Er betont die Fiktionalität der Diegese und unterbindet jeden Versuch, sie als reale Welt erscheinen zu lassen. Die Grenzen zwischen Erzähler, Rosalie und der Erzählung verschwimmen, und Rosalie scheint in ihre Rolle als Figur gezwängt zu sein. Der Erzähler betont die künstliche Natur von Rosalie und der Geschichte, indem er seine Recherche und die Erfindung von Details beschreibt. Dies unterstreicht die Fiktionalität der Erzählung.
Häufig gestellte Fragen zu "Rosalie geht sterben" - Eine erzähltheoretische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Realitätsanspruch der extradiegetischen und diegetischen Welt in Daniel Kehlmanns "Rosalie geht sterben", einer Episode aus seinem Werk "Ruhm". Der Fokus liegt auf der Rolle von Metalepsen und Rosalies Widerstand gegen die omnipotente Erzählinstanz. Es wird untersucht, wie Metalepsen die Wirklichkeitshinterfragung beeinflussen und die Deutungshoheit des Erzählers verändern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Metalepsen als Mittel der Wirklichkeitshinterfragung, Rosalies Aufbegehren gegen den Erzähler, die Ambivalenz des Realitätsanspruchs in der Erzählung, den metafiktionalen Charakter der Erzählung und den Einfluss von Intertextualität auf die Interpretation. Die Analyse bezieht sich auf erzähltheoretische Konzepte von Genette und Häsner.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Metalepsen, ein Kapitel zur erzähltheoretischen Analyse von "Rosalie geht sterben" (unterteilt in drei Unterkapitel), und eine Zusammenfassung. Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation und die Problematik. Das Kapitel zu Metalepsen liefert die theoretische Grundlage. Das Hauptkapitel analysiert die Geschichte im Detail, unter Berücksichtigung von Intertextualität und der Rolle des Erzählers.
Was sind Metalepsen und wie werden sie in der Analyse verwendet?
Metalepsen werden definiert als Grenzüberschreitungen zwischen der extradiegetischen (Erzähler-) und diegetischen (Erzähl-) Welt. In der Analyse werden sie als Mittel der Wirklichkeitshinterfragung untersucht, die den Realitätsanspruch des Erzählers untergraben und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lassen. Die Analyse betrachtet, wie Rosalies Handlungen und das Verhalten des Erzählers zu diesen Metalepsen führen.
Welche Rolle spielt Rosalie in der Analyse?
Rosalie, die Protagonistin, die zunächst ihren Tod plant, wird als Figur analysiert, die sich ihrer fiktiven Existenz bewusst wird und sich zunehmend gegen die vorgegebene Handlung und die omnipotente Erzählinstanz auflehnt. Ihr Widerstand und ihre Veränderung stellen den Realitätsanspruch der Erzählung in Frage und sind zentral für die Analyse der Metalepsen.
Welche Bedeutung hat der Erzähler in "Rosalie geht sterben"?
Der Erzähler spielt eine omnipräsente Rolle und betont die Fiktionalität der Geschichte. Er präsentiert sich selbst als Schöpfer der Geschichte und manipuliert den Handlungsverlauf. Die Analyse untersucht, wie der Erzähler durch seine Kommentare und Eingriffe in die Geschichte den Realitätsanspruch beeinflusst und wie Rosalie diesem entgegenwirkt. Die mögliche Identität des Erzählers (Leo Richter oder Miguel Aurisantos Blancos) wird ebenfalls angesprochen.
Welche Rolle spielt die Intertextualität?
Die Intertextualität, insbesondere die Verbindung zu Paulo Coelhos "Veronika beschließt zu sterben", wird als Verstärkung des metafiktionalen Charakters der Erzählung betrachtet und in die Analyse einbezogen. Diese Bezüge tragen zur Komplexität des Realitätsanspruchs bei und bieten weitere Interpretationsmöglichkeiten.
Wie wird der metafiktionale Charakter der Erzählung behandelt?
Der metafiktionale Charakter der Erzählung, also die explizite Thematisierung der Fiktionalität, ist ein zentrales Element der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie der Erzähler die Fiktionalität betont, wie Rosalie darauf reagiert und wie diese bewusste Konstruktion der Fiktion den Realitätsanspruch beeinflusst.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Metalepsen in "Rosalie geht sterben" ein wichtiges Mittel sind, um den Realitätsanspruch der Erzählung zu hinterfragen und die Macht des Erzählers zu relativieren. Rosalies Widerstand gegen die vorgegebene Handlung und die bewusste Konstruktion der Fiktion tragen dazu bei, die Ambivalenz zwischen Realität und Fiktion hervorzuheben.
- Citar trabajo
- Franz Kröber (Autor), 2011, Metalepsen und das Aufbegehren der Figur gegen den Erzähler in "Rosalie geht sterben" aus Daniel Kehlmanns Roman "Ruhm", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189258