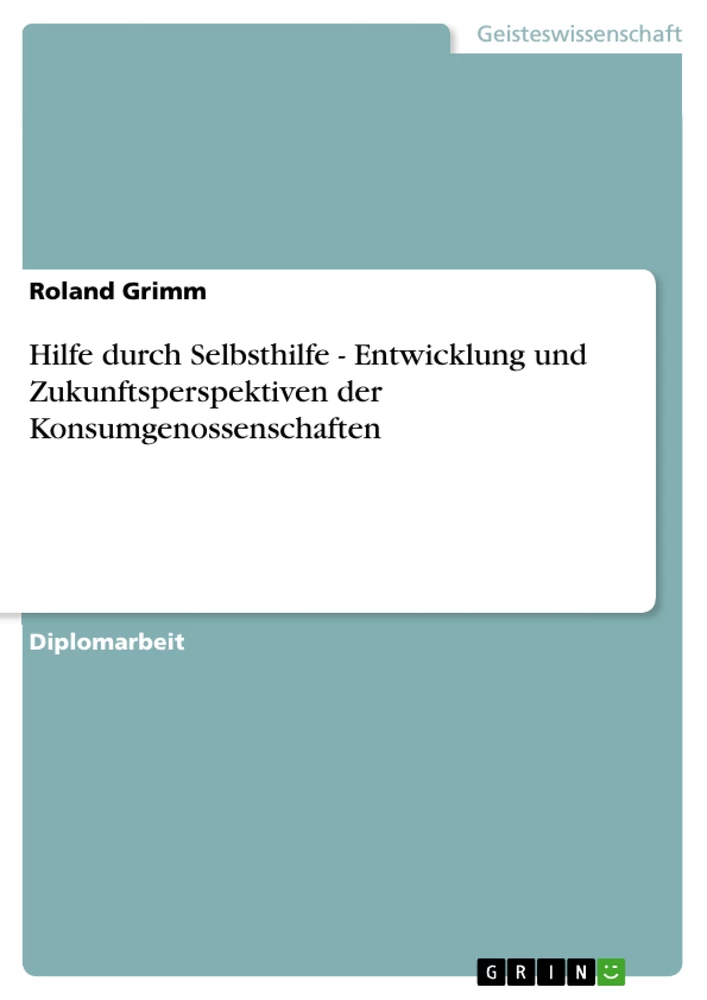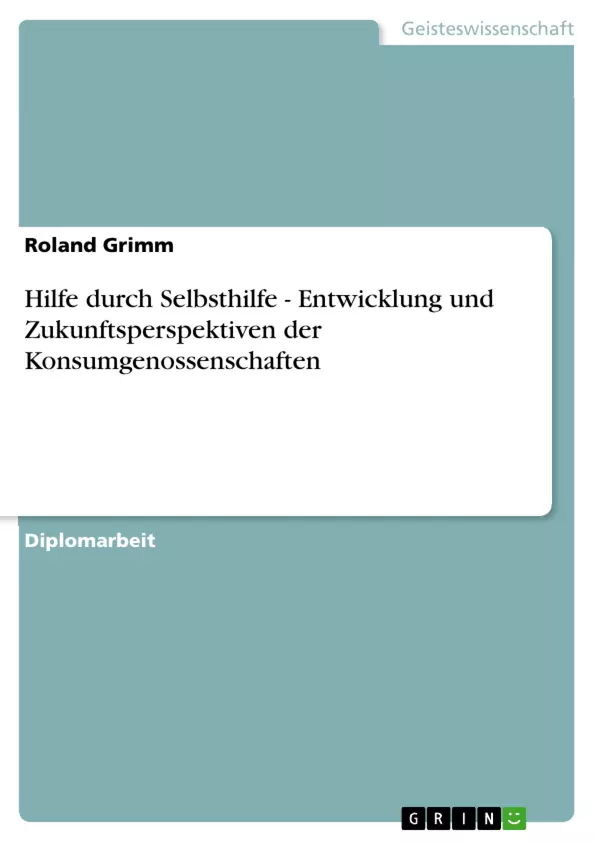Konsumgenossenschaften gelten heute in Deutschland als eine gescheiterte Unternehmensform des Lebensmittelhandels. Ihr Schicksal wird dabei in der Regel mit dem skandalumwitterten Untergang des Frankfurter ´co op-Konzerns` Ende der 80er Jahre gleichgesetzt. Noch häufiger dürften die Konsumgenossenschaften unter den heutigen Deutschen allerdings gänzlich unbekannt sein. In den Supermärkten der co op-AG, die Mitte der siebziger Jahre das Erbe eines großen Teils der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung antrat, hatte deren Geschichte, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht, tatsächlich keine sichtbaren Spuren mehr hinterlassen. ´Co op` erschien den meisten Verbrauchern daher als ein ganz ´normales` Unternehmen ohne genossenschaftliche Vorgeschichte.
Verblaßt ist weitgehend die Erinnerung an die ursprünglichen Ziele und Ideale, die der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung Leben eingehaucht hatten und die ihr Wesen bestimmten. Dieses Wesen ist durch die nüchterne juristische Definition der Konsumgenossenschaften als „Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf von Lebens- oder Wirtschaftsbedürfnissen im großen und Ablaß im kleinen“ nur sehr unzureichend umschrieben. Hinzugefügt werden muß insbesondere, daß Konsumgenossenschaften einst als Selbsthilfe-Initiativen von Verbrauchern angesichts eines überteuerten und qualitativ schlechten Lebensmittelangebots entstanden sind und daß ihre Entwicklung nicht bei der Errichtung verbrauchereigener Lebensmittelgeschäfte Halt machte, sondern eigene Produktionsbetriebe der Konsumenten-Genossen miteinschloß.
Der Charakter dieser Genossenschaftsform, ihre Entstehung, historische Entwicklung (in Deutschland) und schließlich ihr (zumindest vorübergehendes) Scheitern wird in der vorliegenden Arbeit ausführlich behandelt. Zudem befasst sich der Autor mit möglichen Zukunftsperspektiven der Konsumgenossenschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Die Idee der Genossenschaft
- 1. Historische Entstehungsursachen der modernen Genossenschaft
- 2. Kollektive Selbsthilfe versus Fremdhilfe
- 3. Der Idealtypus der Genossenschaft
- 3.1. Freiwilligkeit
- 3.2. Das Förderungsprinzip
- 3.3. Das Identitätsprinzip
- 3.4. Die Genossenschaft als Sozialgemeinschaft
- 3.5. Das Demokratieprinzip
- 3.6. Selbstverwaltung und Selbstverantwortung
- 3.7. Nicht geschlossene Mitgliederzahl
- 3.8. Genossenschaften und Wirtschaftssystem
- 4. Die Genossenschaftsidee und ihre historischen Wurzeln in verschiedenen sozialen Schichten
- 4.1. Städtische Arbeiter und Genossenschaft
- 4.1.1. Arbeiter und Produktivgenossenschaft
- 4.1.2. Arbeiter und Konsumgenossenschaft
- 4.2. Selbständige Handwerker und Genossenschaft
- 4.3. Bauern und Genossenschaft
- 5. Eine grobe Kategorisierung von Genossenschaftsarten
- 5.1. Vollgenossenschaften und hilfswirtschaftliche Genossenschaften
- 5.2. Unternehmens- und Haushaltsgenossenschaften
- 5.3. Verkäufer- und Käufergenossenschaften
- Teil II: Konsumgenossenschaftliche Ziel- und Strategievorstellungen
- 1. Allgemeine konsumgenossenschaftliche Ziele
- 2. Die Rochdaler Grundsätze
- 2.1. Offene Mitgliedschaft
- 2.2. Das Rückvergütungsprinzip
- 3. Gesamtgesellschaftliche Konsumgenossenschaftskonzeptionen
- 3.1. Eduard Pfeiffer
- 3.2. Heinrich Kaufmann
- 3.3. Konsumgenossenschaftliche Eigenproduktion versus Produktivgenossenschaften
- 3.4. Peter Schlack
- 4. Konsumgenossenschaften und erwerbswirtschaftliche Konkurrenz
- 5. Das Nichtmitgliedergeschäft
- Teil III: Geschichte der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung
- 1. Vereinzelte konsumgenossenschaftliche Gründungen (1850 - 1864)
- 2. Die Entwicklung zur Konsumgenossenschaftsbewegung (1864 - 1903)
- 3. Die Ära Heinrich Kaufmann' (1903 - 1933)
- 4. Die nationalsozialistische Zerschlagung der Konsumgenossenschaften
- 5. Die Wiederaufbauphase nach dem 2. Weltkrieg (1945 - 1960)
- 6. Die konsumgenossenschaftliche Krise und der Weg zur co op AG
- 7. Das Schicksal der co op AG
- 8. Die Reste der Konsumgenossenschaftsbewegung
- Teil IV: Ursachen für den Bedeutungsverlust der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung
- 1. Der organisatorische Wandel 1967 - 1974
- 2. Der Verfall der genossenschaftlichen Demokratie
- 3. Gemeinwirtschaftliches Selbstverständnis
- 4. Das Nichtmitgliedergeschäft
- 5. Die veränderte Konkurrenzsituation
- 6. Rechtliche Begrenzungen konsumgenossenschaftlicher Entwicklung
- 7. Das Verschwinden traditioneller Zielgruppen
- 8. Zusammenfassung der Ergebnisse
- Teil V: Zukunftsperspektiven der Konsumgenossenschaften in Deutschland
- 1. Die internationale Bedeutung der Konsumgenossenschaften
- 2. Die Rolle als Marktgegengewicht
- 3. Zukunftsperspektiven im ´Öko-Bereich
- 4. Marktnischen für Konsumgenossenschaften
- 4.1. Neue Dorf-Konsumgenossenschaften
- 4.2. 'Internet-Shopping` und neue Dienstleistungen
- 5. Die Eigenkapitalausstattung
- 6. Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung und den Zukunftsperspektiven von Konsumgenossenschaften in Deutschland. Sie analysiert die historische Entwicklung des Genossenschaftsmodells, die Herausforderungen, denen es in der heutigen Zeit begegnet, und die Potenziale für eine zukünftige Relevanz.
- Die historische Entwicklung des Genossenschaftsmodells
- Die Herausforderungen und Chancen für Konsumgenossenschaften in der heutigen Zeit
- Die Rolle von Konsumgenossenschaften als Gegengewicht zum Markt
- Die Potenziale von Konsumgenossenschaften im ökologischen Bereich
- Zukunftsperspektiven für Konsumgenossenschaften in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I beleuchtet die Entstehung der modernen Genossenschaft, ihre ideellen Grundlagen und ihre historischen Wurzeln in verschiedenen sozialen Schichten. Teil II konzentriert sich auf die Ziele und Strategien von Konsumgenossenschaften, insbesondere die Rochdaler Prinzipien und die Entwicklung von Gesamtgesellschaftlichen Konzeptionen. Teil III zeichnet die Geschichte der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung von ihren Anfängen bis zur heutigen Situation nach. Teil IV untersucht die Ursachen für den Bedeutungsverlust der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung in den letzten Jahrzehnten. Teil V widmet sich den Zukunftsperspektiven der Konsumgenossenschaften in Deutschland, wobei die Rolle als Marktgegengewicht, die Potenziale im Öko-Bereich und neue Marktnischen im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Genossenschaften, Konsumgenossenschaften, Selbsthilfe, Rochdaler Prinzipien, Geschichte der Konsumgenossenschaftsbewegung, Marktnischen, Öko-Bereich, Zukunftsperspektiven, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Grundprinzip einer Konsumgenossenschaft?
Das Prinzip lautet "Hilfe zur Selbsthilfe". Verbraucher schließen sich zusammen, um gemeinsam Lebensmittel und Bedarfsgüter günstiger und in besserer Qualität zu beschaffen.
Was sind die "Rochdaler Grundsätze"?
Es sind historische Leitlinien der Genossenschaftsbewegung, dazu gehören die offene Mitgliedschaft, demokratische Verwaltung und das Rückvergütungsprinzip.
Warum ist die co op AG Ende der 80er Jahre gescheitert?
Der Untergang war geprägt von Skandalen, einem Verfall der genossenschaftlichen Demokratie und der Schwierigkeit, sich im harten Wettbewerb des Lebensmittelhandels zu behaupten.
Welche Rolle spielen Konsumgenossenschaften heute noch?
Obwohl sie im Massenmarkt an Bedeutung verloren haben, finden sie neue Nischen im Öko-Bereich, als Dorfläden oder in Form von Internet-Shopping-Gemeinschaften.
Was ist das Identitätsprinzip bei Genossenschaften?
Es besagt, dass die Mitglieder der Genossenschaft gleichzeitig deren Eigentümer und deren Kunden (Nutzer) sind.
- Citation du texte
- Roland Grimm (Auteur), 1997, Hilfe durch Selbsthilfe - Entwicklung und Zukunftsperspektiven der Konsumgenossenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164570