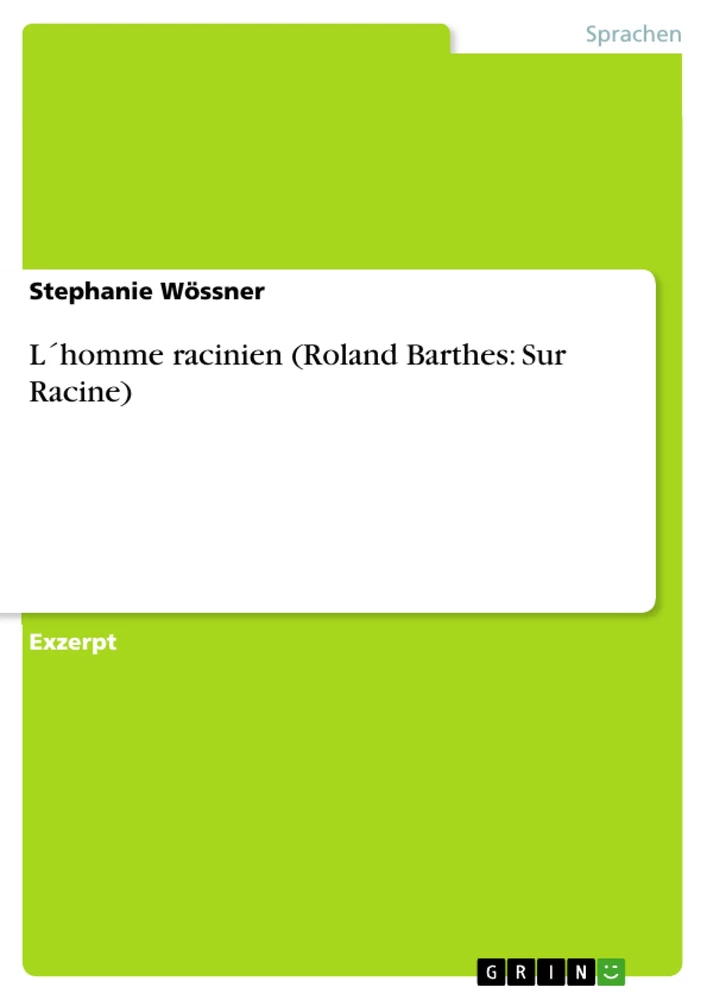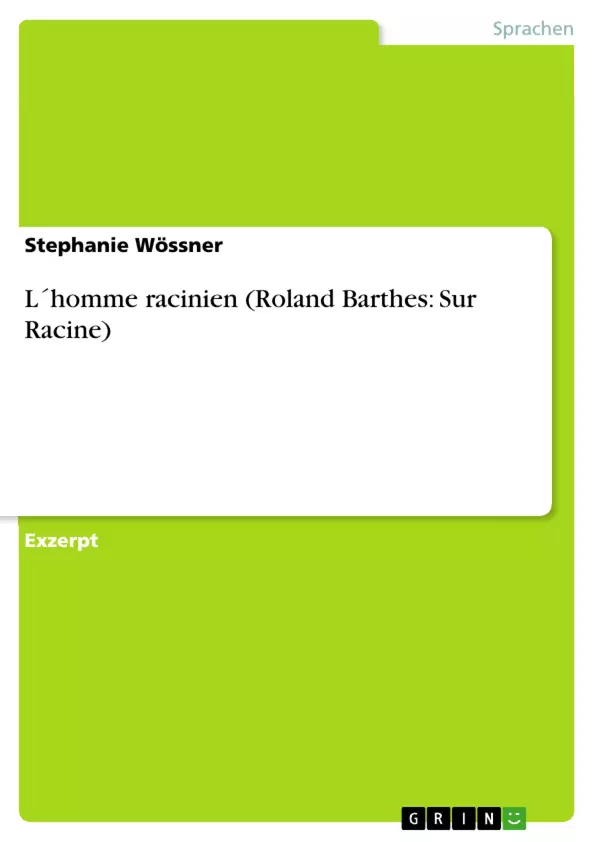Der französische Literaturkritiker, Soziologe und Philosoph Roland Barthes, einer der Hauptvertreter des Strukturalismus in Frankreich, war mit seinem Werk Sur Racine 1963 Auslöser einer akademischen Kontroverse: er vertrat die Ansicht, daß Interpretation eines Werks allein über die Erkennung seiner Struktur möglich sein müsse.
Im Kapitel ,,L´Homme Racinien" beschreibt er die Struktur, die Racines Stücken zu eigen ist. Zu Beginn ruft er in Erinnerung, daß ausnahmslos alle Tragödien im Mittelmeerraum spielen, zwar in drei verschiedenen Ländern, diese Schauplätze seien jedoch alle eingezwängt zwischen Meer und Wüste, Licht und Schatten. Die konkreteren Orte der Handlung seien das Zimmer, das Vorzimmer und die Außenwelt, mit der die tragische Figur durch den Tod, durch Flucht und durch seine(n) Vertrauten in Verbindung treten könne. Beim Zimmer handle es sich um einen undefinierten, unsichtbaren und gefürchteten Ort, an dem die Macht residiere, von dem alle Beteiligten nur mit Respekt und Furcht reden und es nicht wagen, ihn zu betreten - als Ersatz für ein nicht vorhandenes Zimmer diene mitunter das Exil eines Königs. Als unmittelbare Vermittlungsinstanz zwischen dem inneren und äußeren Kommunikationssystem diene deshalb das Vorzimmer, ein Raum der Sprache, wo die tragische Figur ihre Gedanken offenbare. Zwischen diesen beiden Orten gebe es eine Verbindung - eine Tür, einen Vorhang oder eine Mauer, die Augen und Ohren habe - deren Überschreitung einen Verstoß darstelle. Zur Außenwelt, dem dritten Handlungsbereich, gebe es schließlich keine wirklich stabile, begehbare Verbindung, die Tragödie stelle gewissermaßen Gefängnis und Schutz gegen das, was nicht Teil von ihr ist, zugleich dar. Die einzig existierenden Verbindungen zu dieser Außenwelt seien der Tod, die Flucht und der Vertraute, der jedem der tragischen Figuren zur Seite gestellt ist. Ein wirklicher Tod, so Barthes, sei jedoch unmöglich, da das Vorzimmer ein Raum der Sprache sei und dort immer geredet werde. Gehe ein Akteur jedoch von der Bühne, so komme das in gewisser Weise seinem Tod gleich, komme die Sprache aus irgendwelchen Gründen zum erliegen, sei dies ebenfalls der Fall. Die Flucht auf dem immer vorhandenen, an der Küste entlang segelnden Schiff werde lediglich vom Vertrauten als Ausweg aus der Tragödie vorgeschlagen, von der tragischen Figur niemals selbst erwähnt, geschweige denn ausgeführt [...]
Inhaltsverzeichnis
- L'Homme Racinien
- Der Raum der Tragödie
- Die Basistragödie
- Die Figuren und ihre Beziehungen
- Liebe und Licht/Schatten
- Die Tragik und ihre Ursachen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Roland Barthes analysiert in seinem Werk „Sur Racine“ die Struktur der Tragödien von Jean Racine. Er argumentiert, dass die Interpretation eines Werkes durch die Analyse seiner Struktur möglich ist. Im Fokus stehen die räumlichen, Figuren- und Handlungsstrukturen der Stücke, sowie die Rolle der Liebe und das Verhältnis von Licht und Schatten als Metaphern für die Tragik.
- Die räumliche Struktur der Tragödien als Ausdruck der tragischen Situation
- Die Basistragödie, die auf die alte Fabel der Horde und den Inzest zurückgeht
- Die Rolle der Figuren und ihre Beziehungen als Ausdruck des tragischen Konflikts
- Die Bedeutung von Liebe und Leidenschaft als Auslöser und gleichzeitig Spiegelung der Tragik
- Die metaphorische Bedeutung von Licht und Schatten für das tragische Schicksal
Zusammenfassung der Kapitel
L'Homme Racinien
In diesem Kapitel beschreibt Barthes die spezifische Struktur der Racineschen Tragödien, die er als „l'homme racinien“ bezeichnet. Er analysiert den räumlichen Kontext der Stücke, der sich zwischen Meer und Wüste, Licht und Schatten bewegt. Die drei Orte – das Zimmer, das Vorzimmer und die Außenwelt – bilden ein Gefüge, das die tragische Figur in Isolation und Konflikt hält. Barthes untersucht auch die Rolle des Vertrauten und die Sprache als zentrale Elemente der Tragödie.
Weiterhin beleuchtet er die basistragische Fabel der Horde, die als Grundlage für den Vater-Sohn-Konflikt interpretiert wird. Barthes analysiert die Figurenbeziehungen und zeigt auf, wie die tragische Figur in einem Dilemma gefangen ist, das sich auf der Ebene der Sprache und der visuellen Wahrnehmung manifestiert. Er untersucht die Rolle der Liebe und die Metaphorik von Licht und Schatten als Ausdruck des tragischen Schicksals.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Struktur, Tragödie, Raum, Figur, Beziehung, Liebe, Licht, Schatten, Sprache, Basistragödie, Inzest, Autorität, Begierde, Aliénation, Schicksal, „l'homme racinien“, „éros sororal“, „éros – événement“, „acteurs“, „personnages“.
- Quote paper
- Stephanie Wössner (Author), 1999, L´homme racinien (Roland Barthes: Sur Racine), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1569