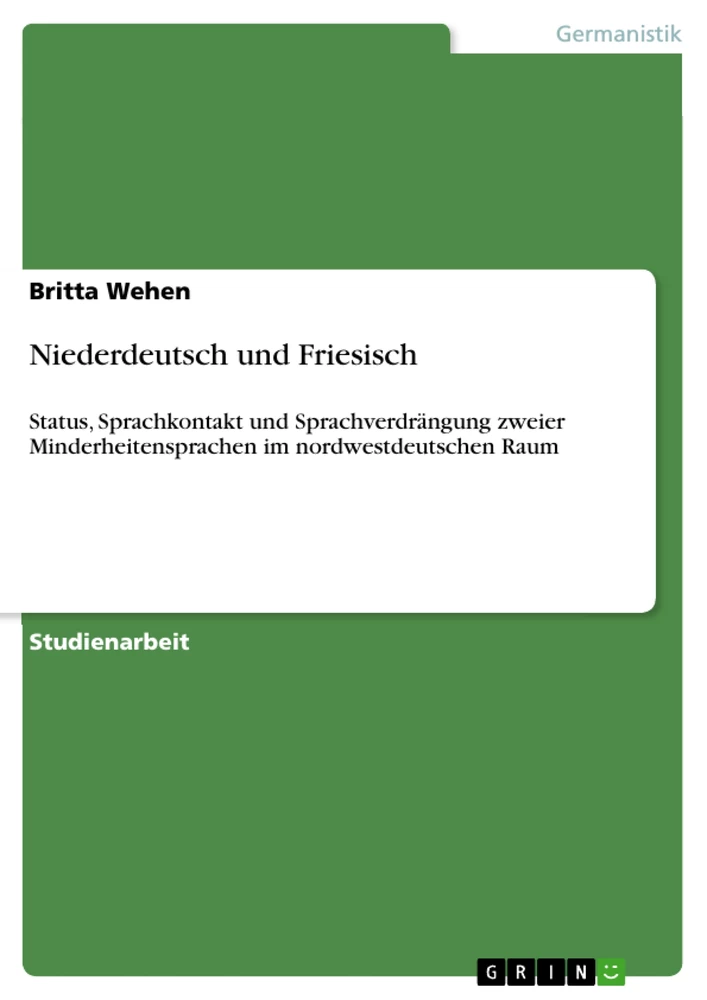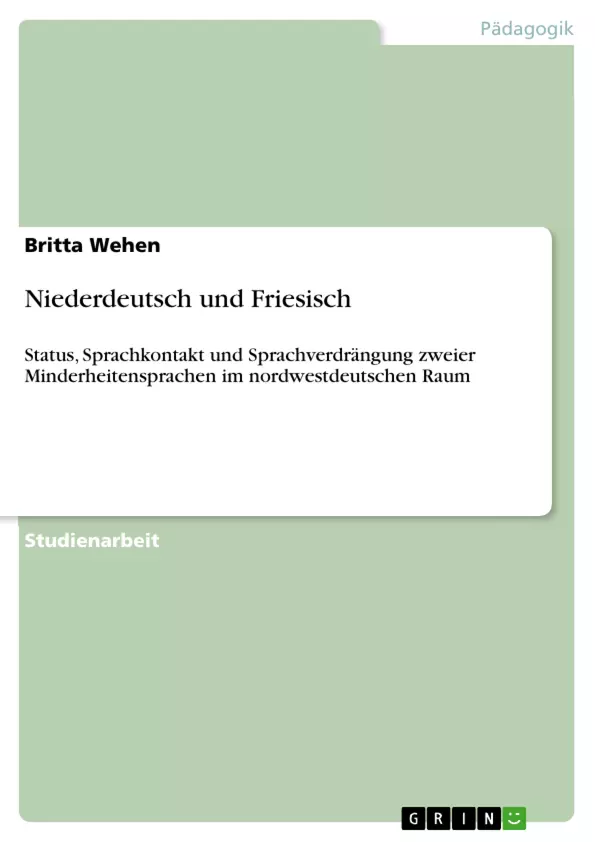Norddeutschland ist von einem Nebeneinander von Regionalsprache und Regionalkultur einerseits sowie Nationalsprache und Nationalkultur anderer-seits gekennzeichnet, das Hochdeutsche hat dabei den Status der Standard-sprache erlangt und verdrängt die regionalen „Minderheitensprachen“ immer mehr. Diese Entwicklung setzte bereits im 16./17. Jahrhundert ein, als das Hochdeutsche zur allgemeinen Schriftsprache wurde und das Mittelniederdeutsch in dieser Funktion ablöste (Appenzeller 2004, S.25). Besonders gravierend für die Regionalsprache ist die Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges: Viele Flüchtlinge aus den ehemaligen ostdeutschen Gebie-ten siedelten im Nordwesten Deutschlands, woraufhin regionale Mundarten ihren Status als Umgangssprache verloren, da es plötzlich immer mehr Personen im Umkreis gab, die die regionale Mundart nicht beherrschten. Zur Alltags- und Verkehrssprache wurde somit immer häufiger das Hochdeutsche herangezogen, das bis dahin die Stellung der Mundarten als tägliche Gebrauchssprache kaum antasten konnte (Sjölin 1997, S.469). Nun aber sahen sich Einheimische zunehmend damit konfrontiert, dass „fremde“ Kinder Vorteile in der Schule hatten, da sie bereits vor der Einschulung Hoch-deutsch sprachen, wohingegen die meisten Einheimischen bis dahin die regionale Mundart als Muttersprache erlernten und das Hochdeutsche erst ab dem 6. Lebensjahr in der Schule.
Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die friesischen Dialekte sowie das Niederdeutsche – in der Regel verfügen Personen, die nach 1945 geboren sind, zwar vielfach über äußerst gute Passivkenntnisse der regionalen Mundart, oftmals wird der Dialekt aber nicht mehr auf natürlichem Weg an die Kinder weitergegeben und ist insofern stark gefährdet.
In dieser Arbeit soll daher die norddeutsche Mehrsprachigkeitssituation untersucht werden, im Fokus der Arbeit stehen das (Nord-)Friesische sowie das Niederdeutsche, da diese beiden Sprachen seit 1999 durch die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen gefördert werden, was sowohl die Gefährdung dieser beiden Sprachen als auch das Bemühen um ihren Fortbestand und ihre Pflege verdeutlicht.
Durch welche sprachlichen Kontakte hat sich also die Verwendung der regionalen Mundarten in den letzten Jahrhunderten geändert? In welchen Kommunikationssituationen werden die regionalen Dialekte heutzutage noch verwendet und wie angesehen sind sie? Kann von einer generellen Bevorzugung des Hochdeutschen gesprochen werden?
Inhaltsverzeichnis
- Status, Sprachkontakt und Sprachverdrängung zweier Minderheitensprachen im nordwestdeutschen Raum
- Sprachkontakt im Nordfriesland
- Sprachverdrängung durch Hochdeutsch
- Sprachliche Situation im Kreis Nordfriesland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mehrsprachigkeitssituation in Norddeutschland, insbesondere die Entwicklung des Friesischen und Niederdeutschen. Die Zielsetzung ist es, die sprachlichen Kontakte zu analysieren, die sozioökonomischen Gründe für den Wandel der Sprachverwendung zu beleuchten und den aktuellen Status dieser Regionalsprachen zu beschreiben.
- Sprachverdrängung von Minderheitensprachen durch Hochdeutsch
- Sozioökonomische Faktoren im Sprachwandel
- Kommunikationssituationen und der Status von Regionaldialekten
- Sprachkontakt zwischen Friesisch, Niederdeutsch und Hochdeutsch
- Die Rolle des Tourismus und der Politik im Sprachwandel
Zusammenfassung der Kapitel
Status, Sprachkontakt und Sprachverdrängung zweier Minderheitensprachen im nordwestdeutschen Raum: Der Text beschreibt die Entwicklung der Regionalsprachen Friesisch und Niederdeutsch im Kontext der Standardisierung des Hochdeutschen. Der Fokus liegt auf der Verdrängung der Minderheitensprachen nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Zuzug von Flüchtlingen aus den ostdeutschen Gebieten. Die Arbeit beleuchtet die damit verbundenen sozioökonomischen Faktoren, wie die Benachteiligung von Kindern, die keine Hochdeutschkenntnisse vor der Einschulung besaßen, und die zunehmende Verwendung des Hochdeutschen als Alltags- und Verkehrssprache. Die Bedeutung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen für den Erhalt dieser Sprachen wird hervorgehoben.
Sprachkontakt im Nordfriesland: Dieses Kapitel analysiert die Sprachkontakte im Kreis Nordfriesland, der durch das Nebeneinander von Hochdeutsch, Dänisch, Jütisch, Friesisch und Niederdeutsch gekennzeichnet ist. Es beschreibt die historischen Sprachwechsel, angefangen mit dem Übergang vom Latein zum Mittelniederdeutschen im 13./14. Jahrhundert, bis hin zur zunehmenden Dominanz des Hochdeutschen seit den 1930er Jahren. Der Text beleuchtet die Entwicklung einer Diglossie zwischen Friesisch und Niederdeutsch, später einer Triglossie mit der Hinzunahme des Hochdeutschen, und die Auswirkungen von Sturmfluten und politischen Veränderungen auf die Sprachlandschaft. Die Rolle des Tourismus im 20. Jahrhundert bei der Verbreitung des Hochdeutschen wird ebenfalls betrachtet.
Sprachverdrängung durch Hochdeutsch: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den Prozess der Sprachverdrängung des Friesischen durch Hochdeutsch und Niederdeutsch. Der Text analysiert detailliert den Sprachwechsel, der aus verschiedenen Gründen motiviert war, darunter die größere kommunikative Reichweite des Hochdeutschen und Niederdeutschen, Eheschließungen mit Nicht-Friesen, erwartete Nachteile für Kinder in der Schule, und die Wahrnehmung des Friesischen als "altertümlich". Sprachpflegerische Bemühungen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts werden beschrieben, aber auch die alarmierenden Ergebnisse einer Sprachstatistik von 1929, die den Rückgang des Friesischen verdeutlicht. Der Text verdeutlicht den unterschiedlichen Erfolg verschiedener friesischer Dialekte im Hinblick auf die Weitergabe an nachfolgende Generationen.
Sprachliche Situation im Kreis Nordfriesland: Dieser Teil fasst die sprachliche Situation im Kreis Nordfriesland zusammen, die durch den Kontakt verschiedener Sprachen (Hochdeutsch, Dänisch, Jütisch, Friesisch, Niederdeutsch) geprägt ist. Er unterstreicht den Einfluss des Hochdeutschen seit 1945. Der Text erwähnt eine Fragebogenerhebung aus dem Jahr 1988, die den Sprachgebrauch und das Verständnis der verschiedenen Sprachen in der Bevölkerung darstellt, und zeigt eine deutliche Tendenz zur Einsprachigkeit bei jüngeren Generationen sowie eine Hierarchie der Sprachen mit Hochdeutsch an der Spitze.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Norddeutschland, Friesisch, Niederdeutsch, Hochdeutsch, Sprachkontakt, Sprachverdrängung, Sprachwandel, Soziolinguistik, Minderheitensprachen, Diglossie, Triglossie, Sprachpolitik, Sprachgeschichte, Nordfriesland.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Status, Sprachkontakt und Sprachverdrängung zweier Minderheitensprachen im nordwestdeutschen Raum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Mehrsprachigkeitssituation in Norddeutschland, insbesondere die Entwicklung des Friesischen und Niederdeutschen. Sie analysiert die sprachlichen Kontakte, die sozioökonomischen Gründe für den Wandel der Sprachverwendung und beschreibt den aktuellen Status dieser Regionalsprachen.
Welche Sprachen werden im Text behandelt?
Der Text befasst sich hauptsächlich mit Friesisch, Niederdeutsch und Hochdeutsch. Zusätzlich werden Dänisch und Jütisch im Kontext des Kreises Nordfriesland erwähnt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Zu den zentralen Themen gehören Sprachverdrängung von Minderheitensprachen durch Hochdeutsch, sozioökonomische Faktoren im Sprachwandel, Kommunikationssituationen und der Status von Regionaldialekten, Sprachkontakt zwischen den drei genannten Sprachen, sowie die Rolle des Tourismus und der Politik im Sprachwandel.
Wie wird die Sprachverdrängung des Friesischen und Niederdeutschen beschrieben?
Die Sprachverdrängung wird als ein Prozess dargestellt, der durch verschiedene Faktoren wie die größere kommunikative Reichweite des Hochdeutschen, Eheschließungen mit Nicht-Friesen/Nicht-Niederdeutschen, Nachteile für Kinder in der Schule und die Wahrnehmung der Minderheitensprachen als "altertümlich" beeinflusst wurde. Der Zuzug von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg wird als ein bedeutender Faktor hervorgehoben.
Welche Rolle spielt der Kreis Nordfriesland in der Untersuchung?
Der Kreis Nordfriesland dient als Fallstudie, da dort ein komplexer Sprachkontakt zwischen Hochdeutsch, Dänisch, Jütisch, Friesisch und Niederdeutsch besteht. Die historische Entwicklung des Sprachkontakts und die aktuelle Sprachsituation in der Region werden detailliert analysiert.
Welche Methoden werden verwendet?
Der Text stützt sich auf historische Sprachdaten, soziolinguistische Analysen und eine im Text erwähnte Fragebogenerhebung aus dem Jahr 1988, um die Sprachsituation im Kreis Nordfriesland zu beschreiben. Die Arbeit beleuchtet sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte des Sprachwandels.
Welche Bedeutung hat die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen?
Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen wird als ein wichtiger Faktor für den Erhalt des Friesischen und Niederdeutschen erwähnt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt eine deutliche Tendenz zur Einsprachigkeit (Hochdeutsch) bei jüngeren Generationen im Kreis Nordfriesland und unterstreicht die dominante Stellung des Hochdeutschen. Die Herausforderungen für den Erhalt der Minderheitensprachen werden deutlich gemacht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Norddeutschland, Friesisch, Niederdeutsch, Hochdeutsch, Sprachkontakt, Sprachverdrängung, Sprachwandel, Soziolinguistik, Minderheitensprachen, Diglossie, Triglossie, Sprachpolitik, Sprachgeschichte, Nordfriesland.
Gibt es Kapitelzusammenfassungen?
Ja, der Text beinhaltet Zusammenfassungen für jedes Kapitel, welche die wichtigsten Punkte und Ergebnisse zusammenfassen.
- Citar trabajo
- Britta Wehen (Autor), 2010, Niederdeutsch und Friesisch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154467