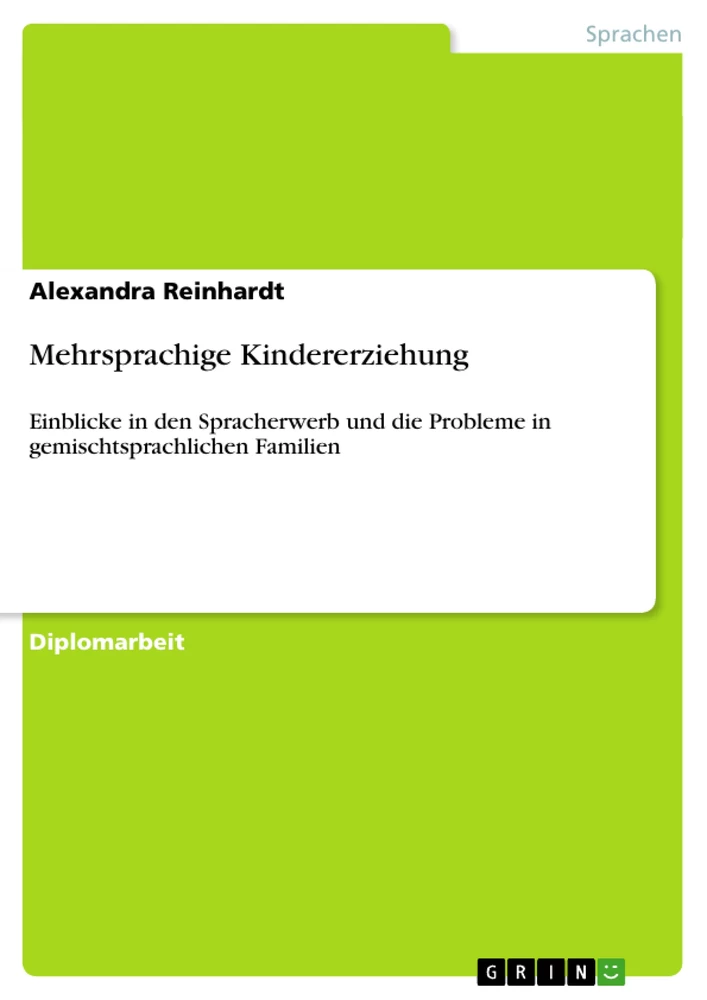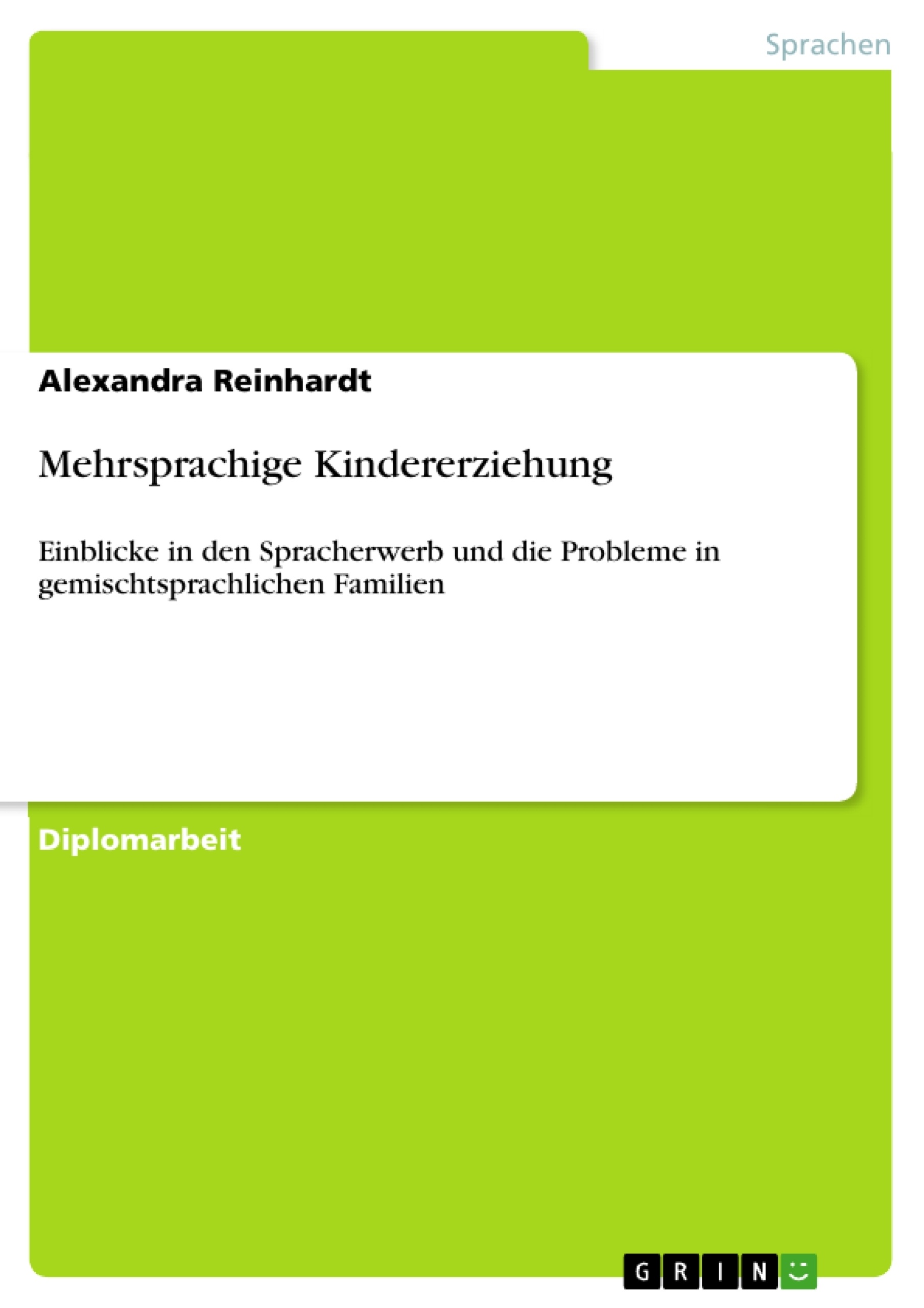Das Thema meiner Diplomarbeit habe ich gewählt, da mir im Freundes- und Bekanntenkreis immer häufiger aufgefallen ist, dass mehrsprachige Familien heutzutage zum Alltag gehören. Auslandaufenthalte und Auslandreisen sind zum Standard geworden. Überall auf der Welt trifft man auf Menschen verschiedenster
Kulturen. Die Gesellschaft in vielen Ländern der Welt ist multikulturell geworden.
Menschen verschiedener Sprach- und Kulturkreise treffen immer häufiger aufeinander und entscheiden sich eine Familie zu gründen. Es stellt sich dann schnell die Frage, in welchen Sprachen das Kind erzogen werden soll und ob dies Probleme bereiten wird.
Diese Arbeit beleuchtet also dieses Thema.
Das erste Kapitel beschäftigt sich zunächst mit der Theorie von Bilingualismus.
Hierbei werden die verschiedenen Arten des Bilingualismus dargestellt.
Im zweiten Kapitel wird der Spracherwerb sowohl monolingual als auch bilingual bzw. multilingual näher erläutert.
Das nächste Kapitel zeigt die verschiedenen Spracherwerbsmethoden für die bilinguale Erziehung auf.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den möglichen Problemen, die zweisprachige Kinder haben können und gibt Ratschläge.
Im letzten Kapitel erfolgt abschließend eine Auswertung ausgewählter Fragen der Umfrage, die im Rahmen dieser Diplomarbeit angefertigt wurde.
In den Kapiteln „Zusammenfassung der Ergebnisse“ und „Schlussfolgerungen“ werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein kleiner Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- BIBLIOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG UND REFERAT
- VORWORT
- I EINLEITUNG
- II ZIEL- UND AUFGABENSTELLUNG DER ARBEIT
- III MATERIALGRUNDLAGE
- IV METHODOLOGISCHES VORGEHEN
- 1 BEGRIFFSKLÄRUNG BILINGUALISMUS
- 1.1 Arten des Bilingualismus
- 1.1.1 Kollektiver Bilingualismus
- 1.1.2 Individueller Bilingualismus
- 1.1.2.1 Simultaner Früh-Bilingualismus
- 1.1.2.2 Konsekutiver Bilingualismus
- 1.1.2.3 Subtraktiver und additiver Bilingualismus
- 1.1.2.4 Später Bilingualismus
- 1.2 Einige Definitionen von Bilingualismus
- 1.2.1 Normative Definitionen
- 1.2.2 Methodologische Definitionen
- 1.2.3 Beschreibende Definitionen
- 1.3 Ansatz für die vorliegende Arbeit
- 2 SPRACHERWERB DES KINDES
- 2.1 Der Spracherwerb
- 2.1.1 Ablauf des Spracherwerbs
- 2.1.2 Was sollte das Kind können?
- 2.1.3 Die sprachliche Kompetenz
- 2.1.3.1 Sprachliche Kompetenz im engeren Sinne
- 2.1.3.2 Soziolinguistische Kompetenz
- 2.1.3.3 Strategische Kompetenz
- 2.1.3.4 Sprachlogische Kompetenz
- 2.2 Doppelter Spracherwerb
- 2.2.1 Ablauf des doppelten Spracherwerbs
- 2.2.2 Einflüsse auf den doppelten Spracherwerb
- 2.2.2.1 Das Umfeld
- 2.2.2.2 Die Familie
- 3 SPRACHERWERBSMODELLE FÜR DIE ZWEISPRACHIGE KINDERERZIEHUNG
- 3.1 Eine Person - eine Sprache
- 3.1.1 Funktionsweise von „Eine Person - eine Sprache“
- 3.1.2 Konsequenz bei Wahl des Modells „eine Person - eine Sprache“
- 3.2 Situationsbedingte Sprachtrennung
- 3.2.1 Ein Elternteil ist oft unterwegs
- 3.2.2 Der erste Satz zählt
- 3.2.3 Familiensprache – Umgebungssprache
- 3.3 Eine Familie drei Sprachen?
- 3.4 Allgemeine Bedingungen für die Wahl des Spracherwerbsmodells
- 4 PROBLEME BEI ZWEISPRACHIGER KINDERERZIEHUNG
- 4.1 Die Familie verändert sich
- 4.1.1 Trennung der Eltern
- 4.1.2 Neue Partner der Eltern
- 4.1.3 Adoption und Mehrsprachigkeit
- 4.1.4 Behinderung und Mehrsprachigkeit
- 4.2 Mischsprache, Interferenz und Semilingualismus
- 4.2.1 Mischsprache
- 4.2.2 Interferenz
- 4.2.3 Semilingualismus
- 4.3 Sprachverweigerung
- 4.3.1 Ursachen der Sprachverweigerung
- 4.3.2 Umgang der Eltern mit Sprachverweigerung
- 4.4 Schule und Kindergarten
- 4.4.1 Der Kindergarten
- 4.4.2 Die Schule
- 4.4.2.1 Lesen
- 4.4.2.2 Schreiben
- 4.4.2.3 Zählen und Rechnen
- 4.5 Sprachförderung durch die Eltern
- 5 DIE UMFRAGE
- 5.1 Der Inhalt
- 5.2 Die Auswertung
- 5.2.1 Angaben zur mehrsprachigen Erziehung
- 5.2.1.1 Erwerb beider Sprachen gleichzeitig
- 5.2.1.2 Erwerb beider Sprachen nacheinander
- 5.2.1.3 Gescheiterter Versuch des bilingualen Spracherwerbs
- 5.2.2 Das Verhältnis der Sprachen
- 5.2.3 Fragen zum Ausmaß der Sprachbeherrschung
- 5.2.4 Persönliches Verhältnis zur Zwei- und Mehrsprachigkeit
- 6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
- 7 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND OFFENE FRAGEN
- Begriffsklärung Bilingualismus: Definitionen, Arten und Modelle
- Spracherwerb des Kindes: Der Ablauf, die sprachliche Kompetenz und der doppelte Spracherwerb
- Spracherwerbsmodelle für die zweisprachige Kindererziehung: "Eine Person - eine Sprache", situationsbedingte Sprachtrennung, Familiensprache – Umgebungssprache
- Probleme bei zweisprachiger Kindererziehung: Mischsprache, Interferenz, Semilingualismus, Sprachverweigerung, Schule und Kindergarten
- Sprachförderung durch die Eltern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der mehrsprachigen Kindererziehung. Ziel ist es, Einblicke in den Spracherwerb und die Probleme in gemischtsprachlichen Familien zu gewinnen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs „Bilingualismus“ und beleuchtet verschiedene Arten und Modelle. Anschließend wird der Spracherwerb des Kindes im Allgemeinen und der doppelte Spracherwerb im Speziellen behandelt. Es werden verschiedene Spracherwerbsmodelle für die zweisprachige Kindererziehung vorgestellt, die sich in ihrer Funktionsweise und Konsequenzen unterscheiden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Problemen, die in gemischtsprachlichen Familien auftreten können, darunter Mischsprache, Interferenz und Semilingualismus, sowie Sprachverweigerung. Die Rolle von Schule und Kindergarten wird ebenfalls analysiert. Die Arbeit schließt mit einer Umfrage und einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Mehrsprachige Kindererziehung, Bilingualismus, Spracherwerb, Doppelter Spracherwerb, Spracherwerbsmodelle, Familiensprache, Umgebungssprache, Sprachprobleme, Mischsprache, Interferenz, Semilingualismus, Sprachverweigerung, Sprachförderung.
- Quote paper
- Alexandra Reinhardt (Author), 2008, Mehrsprachige Kindererziehung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153163