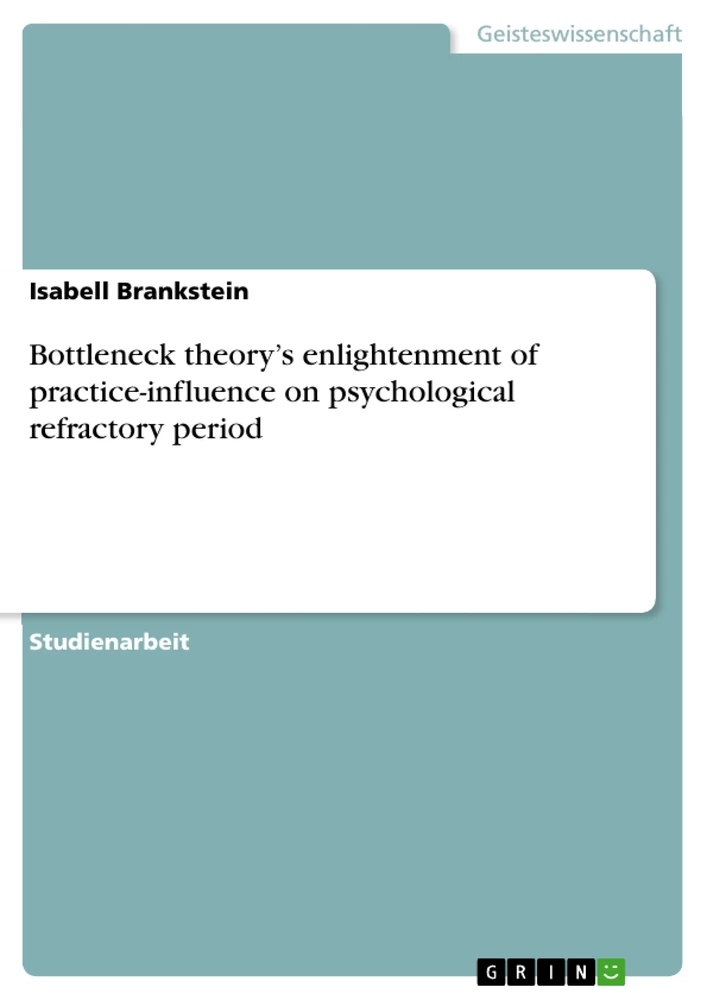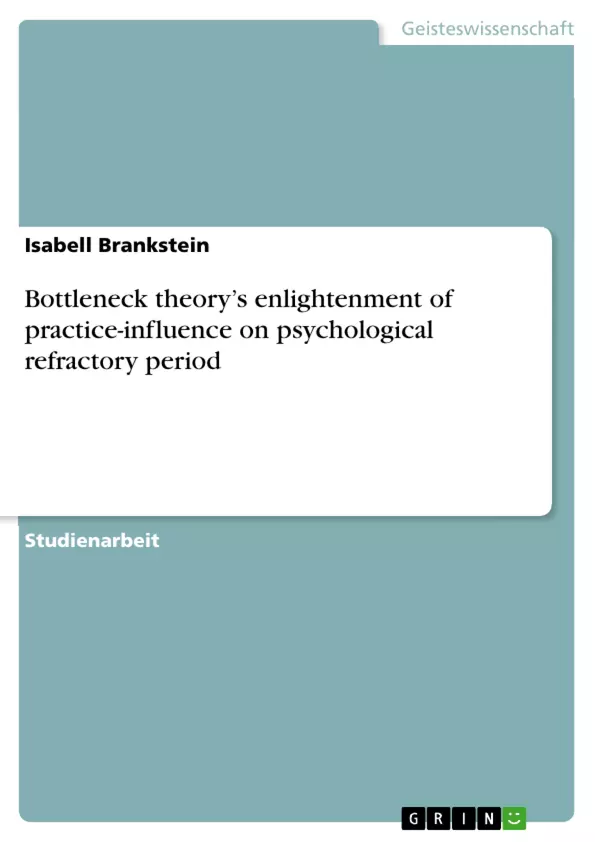Stunning limiting mechanisms of the humans information processing, of perceiving abilities, working memory performance, sensomotoric reactions upon receiving point, can be classified as phenomenon, giving feedback about the humans assessment of reality. The psychological refractory period effect (PRP) is one of these phenomenon, representing the aspects of delayed reactions, two speed tasks are performed in rapid succession with resulting delay to the second task response (Craik, 1947, 1948; Hick, 1948; Telford, 1931). This increasing delay of the second task response is the high, the short the interval between the two tasks, task 1 and 2, is (Pashler, 1994). This PRP – effect can be observed even when modalities of the tasks (e.g. sensory, motor-driven) are distinct (Pashler, 1994).
Severely theories have tried to build up the PRP-effect’s underlying mechanisms. Following work will focus on one of those, the central bottleneck, trying to illuminate the influence of practice on PRP-effect.
Inhaltsverzeichnis
- Neurophysiologische Kapazitätsgrenzen menschlicher Informationsverarbeitung
- Der zentrale Engpass
- Strukturelle und strategische Engpassthesorien
- Der Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die neurophysiologischen Kapazitätsgrenzen menschlicher Informationsverarbeitung, insbesondere den Effekt der psychologischen Refraktärperiode (PRP). Das Hauptziel ist es, den Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt im Lichte verschiedener Engpassthesorien zu beleuchten.
- Der zentrale Engpass als Erklärungsmodell für den PRP-Effekt
- Vergleich struktureller und strategischer Engpassthesorien
- Der Einfluss von Übung auf die Dauer zentraler Verarbeitungsprozesse
- Die Rolle der Modalität der Aufgaben bei Übungseffekten
- Automatisierung und Verkürzung von Verarbeitungsphasen durch Übung
Zusammenfassung der Kapitel
Neurophysiologische Kapazitätsgrenzen menschlicher Informationsverarbeitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der psychologischen Refraktärperiode (PRP) ein, welche die Verzögerung der Reaktionszeit auf eine zweite Aufgabe beschreibt, wenn diese kurz nach einer ersten Aufgabe präsentiert wird. Es werden verschiedene Studien und Theorien zur Erklärung dieses Phänomens vorgestellt, die auf begrenzte Verarbeitungskapazitäten des menschlichen Gehirns hinweisen. Der PRP-Effekt wird als ein Indikator für die Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung und Wahrnehmungsfähigkeit dargestellt, der Aufschluss über die menschliche Realitätsbewertung gibt. Die verschiedenen Limitationen im menschlichen Informationsverarbeitungsystem werden als Phänomene eingeordnet, deren eines die PRP ist. Die Arbeit fokussiert sich darauf, den Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt zu untersuchen, unter dem Aspekt des zentralen Engpasses.
Der zentrale Engpass: Dieses Kapitel beschreibt das Modell des zentralen Engpasses, das die menschliche Informationsverarbeitung in drei aufeinanderfolgende Stufen unterteilt: präzentral, zentral und postzentral. Der zentrale Engpass wird als die begrenzte Kapazität der zentralen Stufe identifiziert, die zu einer Verzögerung der Verarbeitung der zweiten Aufgabe führt, wenn die zentrale Stufe der ersten Aufgabe noch aktiv ist. Neurobiologische Befunde werden vorgestellt, die das Modell unterstützen, indem sie Korrelationen zwischen Aktivitäten in bestimmten Hirnregionen (lateral und medial frontaler Kortex) und der Stärke des PRP-Effekts zeigen.
Strukturelle und strategische Engpassthesorien: Hier werden zwei konkurrierende Theorien zur Erklärung des zentralen Engpasses vorgestellt: die strukturelle und die strategische Engpassthesorie. Die strukturelle Theorie postuliert ein absolutes Limit der parallelen Verarbeitungskapazität in der zentralen Stufe, während die strategische Theorie parallel verlaufende Prozesse zulässt, jedoch einen zentralen Exekutivprozess postuliert, der die Prozesse koordiniert und um Fehler zu vermeiden, parallel verlaufende Prozesse unterbindet. Der Unterschied liegt in der Annahme von Parallelität versus Serialität zentraler Verarbeitungsprozesse.
Der Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt: Dieses Kapitel widmet sich der zentralen Forschungsfrage nach dem Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt. Es werden widersprüchliche Befunde aus der Literatur diskutiert, wobei einige Studien einen geringen, andere einen starken Übungseffekt zeigen. Mögliche Erklärungen für diese Diskrepanzen werden analysiert, wie z.B. die Aufgabenkomplexität (Anzahl der Stimuli und Reaktionsalternativen) und die Modalität der Aufgaben (unimodal vs. multimodal). Die Rolle der Automatisierung von Teilaufgaben, sowie die Verkürzung der Dauer zentraler Stufen durch Übung, werden als mögliche Erklärungen für beobachtete Übungseffekte untersucht. Die Bedeutung der Modalität der Aufgaben für das Verständnis der dualen Aufgabenverarbeitung wird herausgestellt. Verschiedene Hypothesen wie die Automatisierungshypothese und die Stufenverkürzungshypothese werden diskutiert und bewertet. Die Arbeit unterstreicht den Bedarf an weiterer Forschung, um die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen.
Schlüsselwörter
Psychologische Refraktärperiode (PRP), zentraler Engpass, strukturelle Engpassthesorie, strategische Engpassthesorie, duale Aufgabenverarbeitung, Informationsverarbeitung, Übungseffekt, Aufgabenmodalität, Automatisierung, Reaktionszeit, neurophysiologische Kapazitätsgrenzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Neurophysiologische Kapazitätsgrenzen menschlicher Informationsverarbeitung
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die neurophysiologischen Kapazitätsgrenzen menschlicher Informationsverarbeitung, mit besonderem Fokus auf den Effekt der psychologischen Refraktärperiode (PRP). Sie analysiert den Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt im Kontext verschiedener Engpassthesorien.
Was ist die psychologische Refraktärperiode (PRP)?
Die PRP beschreibt die Verzögerung der Reaktionszeit auf eine zweite Aufgabe, wenn diese kurz nach einer ersten Aufgabe präsentiert wird. Sie ist ein Indikator für die begrenzten Verarbeitungskapazitäten des menschlichen Gehirns.
Welche Theorien werden zur Erklärung des PRP-Effekts herangezogen?
Die Arbeit behandelt das Modell des zentralen Engpasses, welches die Informationsverarbeitung in prä-, zentrale und postzentrale Stufen unterteilt. Der zentrale Engpass wird als begrenzte Kapazität der zentralen Stufe identifiziert. Weiterhin werden strukturelle und strategische Engpassthesorien verglichen, die sich in ihren Annahmen über die Parallelität oder Serialität zentraler Verarbeitungsprozesse unterscheiden.
Wie wird der Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt untersucht?
Die Arbeit analysiert widersprüchliche Befunde aus der Literatur zum Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt. Mögliche Erklärungen für Diskrepanzen, wie Aufgabenkomplexität und Modalität (unimodal vs. multimodal), werden diskutiert. Die Rolle von Automatisierung von Teilaufgaben und die Verkürzung zentraler Verarbeitungsphasen durch Übung werden untersucht. Hypothesen wie die Automatisierungshypothese und die Stufenverkürzungshypothese werden bewertet.
Welche Rolle spielt die Aufgabenmodalität?
Die Modalität der Aufgaben (unimodal vs. multimodal) spielt eine wichtige Rolle im Verständnis der dualen Aufgabenverarbeitung und der Übungseffekte auf den PRP-Effekt. Die Arbeit hebt die Bedeutung der Modalität für die Interpretation der Ergebnisse hervor.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Psychologische Refraktärperiode (PRP), zentraler Engpass, strukturelle Engpassthesorie, strategische Engpassthesorie, duale Aufgabenverarbeitung, Informationsverarbeitung, Übungseffekt, Aufgabenmodalität, Automatisierung, Reaktionszeit, neurophysiologische Kapazitätsgrenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu den neurophysiologischen Kapazitätsgrenzen, dem zentralen Engpass, strukturellen und strategischen Engpassthesorien und dem Einfluss von Übung auf den PRP-Effekt.
Welche konkreten neurobiologischen Befunde werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert neurobiologische Befunde, die Korrelationen zwischen Aktivitäten in bestimmten Hirnregionen (lateral und medial frontaler Kortex) und der Stärke des PRP-Effekts zeigen und das Modell des zentralen Engpasses unterstützen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit unterstreicht den Bedarf an weiterer Forschung, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Übung, Aufgabenmodalität und dem PRP-Effekt besser zu verstehen. Sie analysiert verschiedene Theorien und widersprüchliche Forschungsergebnisse, um ein umfassenderes Bild der menschlichen Informationsverarbeitung zu liefern.
- Quote paper
- Isabell Brankstein (Author), 2010, Bottleneck theory’s enlightenment of practice-influence on psychological refractory period, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/149258