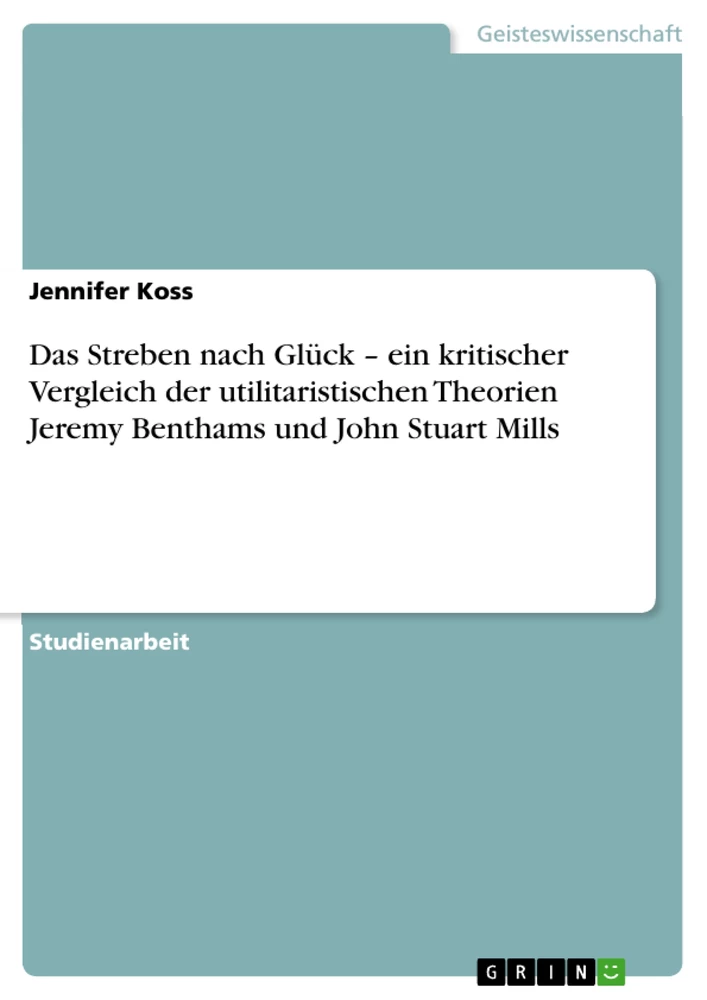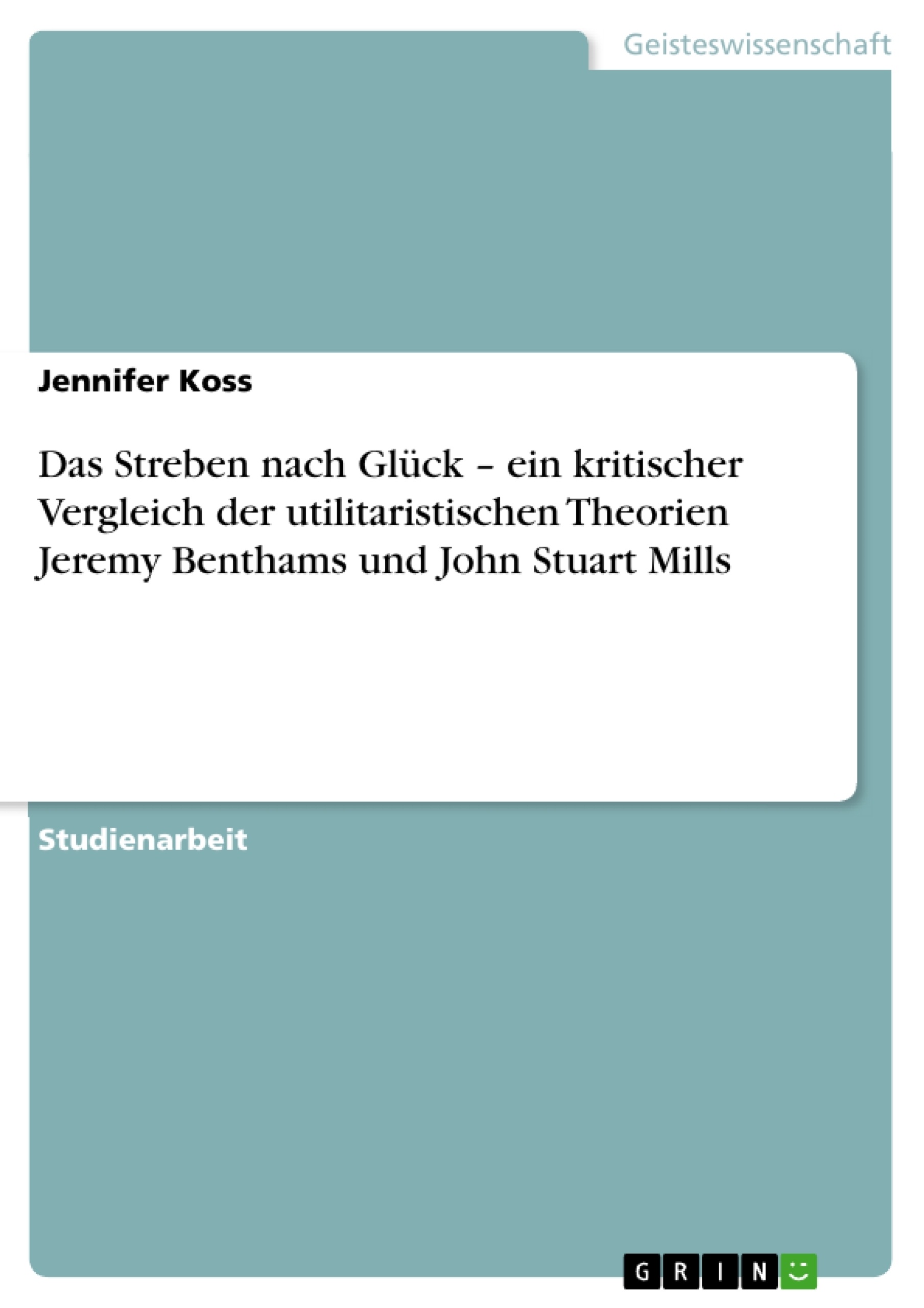Durch welche Motive werden Menschen geleitet, eine funktionierende Gesellschaft anzustreben? Und wie funktioniert eine Gesellschaft? Diese Fragestellungen haben die folgende Arbeit angeleitet. Die Ethik beschäftigt sich mit der Frage, was wir tun sollen. Sie lehrt, „die jeweilige Situation zu beurteilen, um das ethisch (sittlich) richtige Handeln zu ermöglichen.“ Ethische Vorstellungen und Werte unterliegen einer Ordnung, „eine[r] Wertpyramide, deren Basis von den unbewusst verwirklichten Vitalwerten […] gebildet wird, [und] an deren Spitze der höchste denkbare Wert steht.“ Innerhalb eines Teilgebiets der Ethik, dem Utilitarismus, wird das Streben nach Glück als der höchste denkbare Wert angesehen. Diese Grundidee des Utilitarismus, das höchste Ziel des Menschen sei das Streben nach Glück oder Glückseligkeit, lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Bereits Aristoteles (384-322 v. Chr.) spricht in seiner Abhandlung Nikomachische Ethik von einem gemeinsamen Ziel der Menschen: „[…] da alles Wissen und Wollen nach einem Gute zielt, […], welches man als das Zielgut der Staatskunst bezeichnen muß, und welches im Gebiete des Handelns das höchste Gut ist. Im Namen stimmen hier wohl die meisten überein: Glückseligkeit nennen es die Menge und die feineren Köpfe […]“ . Der Utilitarismus ist die Theorie, nach der eine Handlung danach beurteilt wird, inwiefern sie das Glück der meisten Menschen fördert. Utilitaristische Momente finden sich in der Handlungstheorie des „Epikureismus, bei Bernhard de Mandeville, den schottischen Moralphilosophen und in der französischen Revolution“ , als geschlossenes System innerhalb der Ethik wurde der Utilitarismus jedoch von Jeremy Bentham (1748 – 1834) entwickelt und später von John Stuart Mill (1806 – 1873) ausdifferenziert. ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jeremy Bentham - Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung (1789)
- John Stuart Mill – Utilitarismus (1861)
- Kritik an den utilitaristischen Theorien Benthams und Mills
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht und vergleicht die utilitaristischen Theorien von Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Ziel ist es, die Grundprinzipien beider Philosophen darzulegen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und die Kritik an Benthams Theorie zu beleuchten. Dabei wird auch Mills Weiterentwicklung des Utilitarismus analysiert.
- Das Prinzip der Nützlichkeit und das Streben nach Glück als höchster Wert
- Benthams hedonistisches Nutzenkalkül und seine Kritik
- Mills Weiterentwicklung und Modifikation des utilitaristischen Ansatzes
- Vergleich der Theorien Benthams und Mills
- Die Bedeutung des Utilitarismus für die heutige Moralphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Utilitarismus ein und stellt die zentralen Forschungsfragen nach den Motiven menschlichen Handelns und dem Funktionieren einer Gesellschaft. Sie verortet den Utilitarismus innerhalb der Ethik und erwähnt seine historische Entwicklung von der Antike bis zu Bentham und Mill, wobei das Streben nach Glück als höchster Wert hervorgehoben wird. Die Arbeit kündigt die Darstellung der Theorien Benthams und Mills an, inklusive einer kritischen Auseinandersetzung und einem Ausblick auf die heutige Relevanz des Utilitarismus.
Jeremy Bentham - Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung (1789): Dieses Kapitel beschreibt Benthams utilitaristisches System, das auf dem Prinzip des größtmöglichen Glücks der größtmöglichen Zahl basiert. Bentham entwickelt ein hedonistisches Nutzenkalkül, um Freude und Leid zu quantifizieren und eine Gesamtbilanz des menschlichen Glücks zu erstellen. Er identifiziert Leid und Freude als die grundlegenden Motive menschlichen Handelns und definiert Nützlichkeit als die Eigenschaft eines Objekts, Glück zu erzeugen oder Leid zu verhindern. Bentham unterscheidet vier Sanktionen (politisch, moralisch, physisch, religiös) als Quellen von Leid und Freude und beschreibt sieben Umstände zur Bewertung von Freude und Leid (Intensität, Dauer, Gewissheit, Nähe, Folgenträchtigkeit, Reinheit, Ausmaß). Die moralisch richtige Handlung maximiert das Glück aller Betroffenen. Das Kapitel legt den Grundstein für den Vergleich mit Mills Werk und die anschließende Kritik.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Glück, Prinzip der Nützlichkeit, hedonistisches Nutzenkalkül, Moralphilosophie, Ethik, Leid, Freude, Nutzenmaximierung, Kritik des Utilitarismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Utilitaristische Theorien von Bentham und Mill
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die utilitaristischen Theorien von Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Sie beschreibt die Grundprinzipien beider Philosophen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede und analysiert die Kritik an Benthams Theorie sowie Mills Weiterentwicklung des Utilitarismus. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Bentham und Mill, eine Kritik der Theorien und eine Schlussbetrachtung.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Grundprinzipien des Utilitarismus nach Bentham und Mill darzulegen. Sie untersucht das Prinzip der Nützlichkeit und das Streben nach Glück als höchster Wert, Benthams hedonistisches Nutzenkalkül und dessen Kritik, Mills Modifikationen des utilitaristischen Ansatzes und den Vergleich beider Theorien. Schließlich wird die Bedeutung des Utilitarismus für die heutige Moralphilosophie beleuchtet.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind das Prinzip der Nützlichkeit, das Streben nach Glück, Benthams hedonistisches Nutzenkalkül mit seinen sieben Umständen zur Bewertung von Freude und Leid (Intensität, Dauer, Gewissheit, Nähe, Folgenträchtigkeit, Reinheit, Ausmaß) und die vier Sanktionen (politisch, moralisch, physisch, religiös), Mills Weiterentwicklung des Utilitarismus und ein Vergleich der beiden Philosophen. Die Kritik an den utilitaristischen Theorien und deren heutige Relevanz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wie wird Benthams Utilitarismus dargestellt?
Benthams Utilitarismus basiert auf dem Prinzip des größtmöglichen Glücks der größtmöglichen Zahl. Er entwickelt ein hedonistisches Nutzenkalkül zur Quantifizierung von Freude und Leid, um eine Gesamtbilanz des menschlichen Glücks zu erstellen. Leid und Freude sind die grundlegenden Motive menschlichen Handelns. Nützlichkeit wird als die Fähigkeit eines Objekts definiert, Glück zu erzeugen oder Leid zu verhindern. Die moralisch richtige Handlung maximiert das Glück aller Betroffenen.
Wie wird Mills Utilitarismus dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Mills Weiterentwicklung und Modifikation des utilitaristischen Ansatzes im Vergleich zu Benthams Theorie. Konkrete Details zu Mills Ansatz werden jedoch nicht im Überblick aufgeführt.
Welche Kritikpunkte an den utilitaristischen Theorien werden behandelt?
Die Arbeit erwähnt die Kritik an Benthams Theorie, jedoch werden konkrete Kritikpunkte im Überblick nicht detailliert dargestellt.
Welche Bedeutung hat der Utilitarismus für die heutige Moralphilosophie?
Die Arbeit deutet die Bedeutung des Utilitarismus für die heutige Moralphilosophie an, geht aber nicht im Detail darauf ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Utilitarismus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Glück, Prinzip der Nützlichkeit, hedonistisches Nutzenkalkül, Moralphilosophie, Ethik, Leid, Freude, Nutzenmaximierung, Kritik des Utilitarismus.
- Citation du texte
- Jennifer Koss (Auteur), 2009, Das Streben nach Glück – ein kritischer Vergleich der utilitaristischen Theorien Jeremy Benthams und John Stuart Mills , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148939