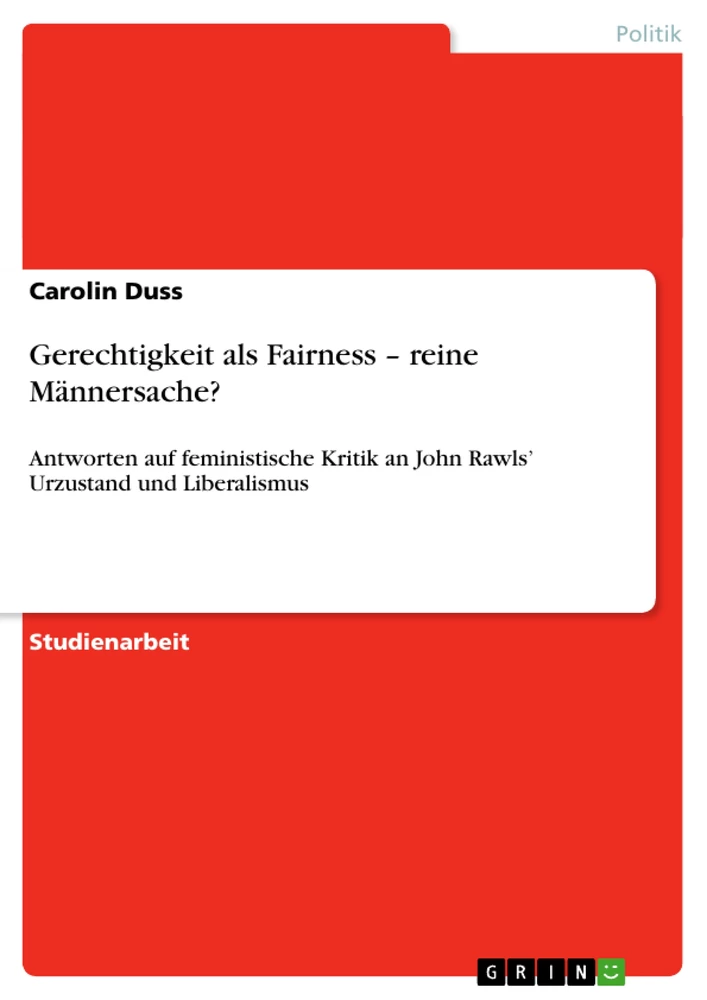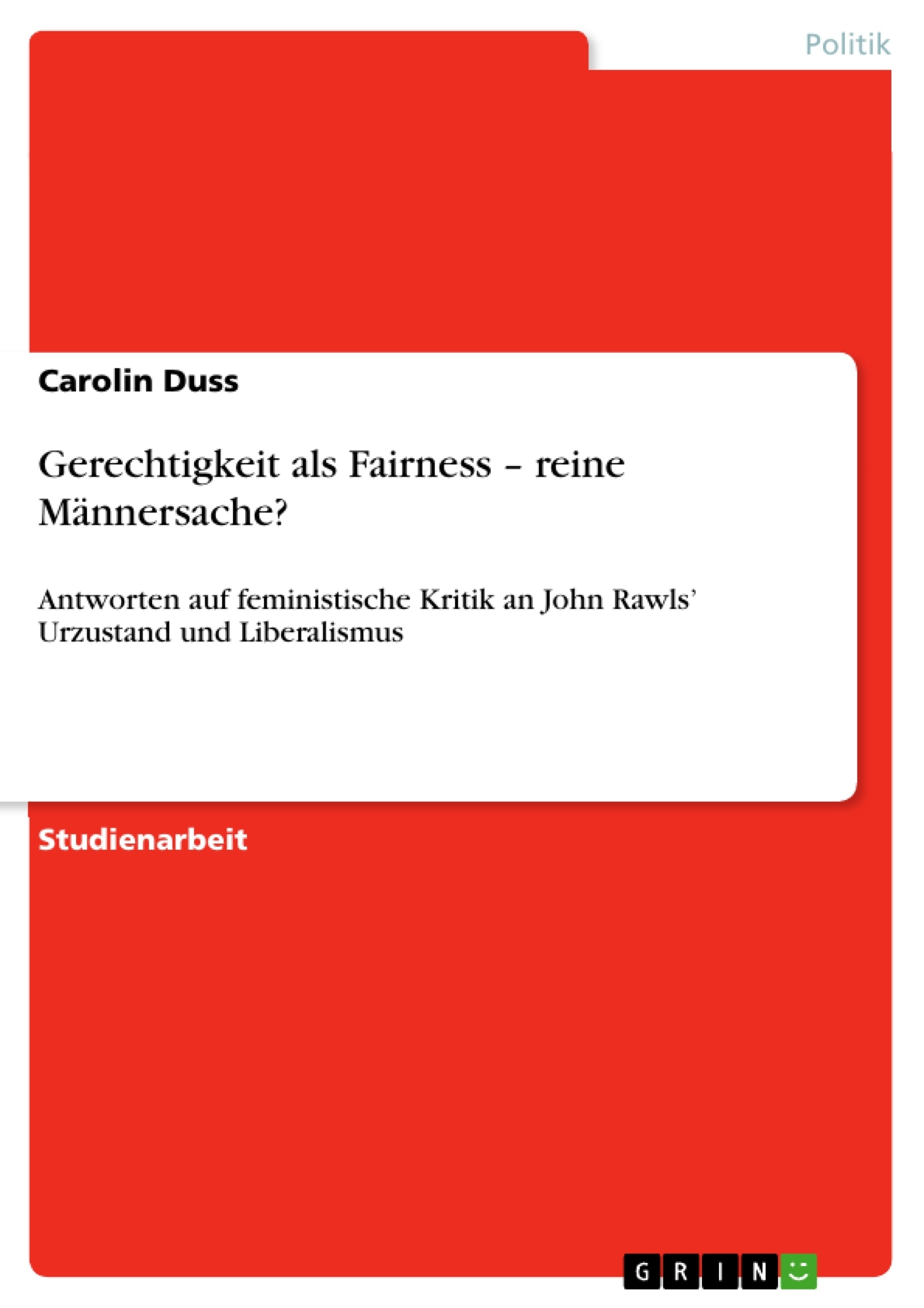Eine gerechte und für alle Mitglieder akzeptable Gesellschaftsform – wie ist sie möglich? Nach welchem Muster soll eine Gesellschaft allgemein strukturiert sein und wie sollen im Besonderen soziale Institutionen organisiert sein, damit es eine solche Gesellschaftsform geben kann? Diese Grundfragen der politischen Philosophie versucht John Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit (1975) und den darauf aufbauenden Werken zu lösen. Gegenstand der Gerechtigkeit ist bei Rawls die Grundstruktur der Gesellschaft, welche definiert ist durch „die Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen Grundrechte und -pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen“ (1975: 23).
Die Basis einer politischen Gerechtigkeitskonzeption muss laut Rawls ein Gesellschaftsvertrag sein. Dies begründet er damit, dass ein Unterwerfen unter bestimmte Mechanismen oder soziale Institutionen nur fair sein kann, wenn sich die Betroffenen theore-tisch auf die Prinzipien geeinigt hätten, nach denen sie handeln sollen (Rawls 1975: 28, 33).
In dieser Arbeit sollen vor allem die weiblichen Betroffenen im Vordergrund stehen. Sie werden vertreten durch eine Vielzahl feministischer Autorinnen, die bezweifeln, ob die von Rawls konzipierte Gerechtigkeit als Fairness sowie die durch diese Gerechtigkeitskonzeption wohlgeordnete Gesellschaft aus weiblicher Perspektive uneingeschränkt annehmbar ist. Ist diese Theorie annehmbar, wenn man von einer spezifisch männlichen und weiblichen Moral ausgeht? Gewährt Rawls einer weiblichen Moral, die angeblich mehr auf Gemeinschafts- als auf Gerechtigkeitswerten basiert, genügend Raum? Beachtet er in ausreichendem Maße konkrete weibliche moralische Erfahrungen und Dilemmata bei der Aufstellung von Prinzipien, die auf die Grundstruktur der Gesellschaft angewandt werden sollen? Spiegelt sich in der von einem Mann verfassten Konzeption von moralischen Subjekten eine typisch männliche Auffassung von Rationalität wider? Welchen Bezug nimmt Rawls’ Theorie zur realen Benachteiligung von Frauen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären, besonders im privaten Bereich? Rechtfertigt der Rawlssche Liberalismus eine atomistische Gesellschaft ohne Solidarität, einhergehend mit Situationen der Abhängigkeit, Ungerechtigkeit und Ungleichheit in Bezug auf die Geschlechter?
Allgemein gesprochen: Kann der universale Anspruch der Rawlsschen Theorie feministischer Kritik standhalten?
Diese Fragen werden in dieser Arbeit beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die These von den zwei Moralen
- 1. Geschlechtsspezifische Moral und ihre Bedeutung für soziale Gemeinschaften
- 2. Kritische Einordnung der These von den zwei Moralen
- III. Vernachlässigung der „weiblichen Stimme“ in Rawls' Urzustand?
- 1. Eine hypothetische Versammlung vernünftiger, aneinander desinteressierter Wesen
- 2. Feministische Kritik an Rawls' Konzeption des Urzustands
- 2.1 Helds Plädoyer für die Einbeziehung der weiblichen moralischen Erfahrungswelt
- 2.2 Benhabibs Plädoyer für die Einbeziehung der „konkreten Anderen“ im Urzustand
- 3. Replik auf die feministische Kritik auf epistemologischer Ebene
- 3.1 Der Urzustand als Gedankenexperiment
- 3.2 Gegen ein Lüften des Schleiers in Sachen Geschlecht
- 3.3 Rawls' Urzustandsubjekte: egoistisch und altruistisch zugleich?
- 4. Replik auf die feministische Kritik auf normativer Ebene
- 4.1 Unterschiedliche Motivationen in Urzustand und wohlgeordneter Gesellschaft
- 4.2 Abgrenzung und Zusammenspiel von Rationalität und Vernunft
- IV. Rawls' Liberalismus – Atomismus pur plus Unterdrückung der Frau?
- 1. Politischer Liberalismus à la Rawls
- 2. Feministische Kritik an Rawls' politischem Liberalismus
- 2.1 Ohne Fürsorgeethik keine Solidargemeinschaft
- 2.2 Gerechtigkeit innerhalb der sozialen Institution der Familie
- 3. Replik auf feministische Kritik am Rawlsschen Liberalismus
- 3.1 Autonomie als Selbstbestimmung, Individualismus als Chance
- 3.2 Vorzüge eines Vorrangs des Rechten vor dem Guten
- 3.3 Interdependenz, gegenseitige Achtung und Besorgnis – auch bei Rawls
- 3.4 Gerechtigkeit durch Rawls' Prinzipien – auch innerhalb der Familie?
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die feministische Kritik an John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit, insbesondere seine Konzeption des Urzustands und seinen politischen Liberalismus. Sie analysiert die Kritikpunkte, die die Vernachlässigung weiblicher Erfahrungen und Perspektiven in Rawls' Theorie bemängeln, und setzt diese mit Rawls' eigenen Argumenten und Repliken in Beziehung.
- Geschlechtsspezifische Moral und ihre Bedeutung für soziale Gemeinschaften
- Kritik an Rawls' Urzustand und seiner Definition der moralischen Subjekte
- Feministische Kritik an Rawls' politischem Liberalismus und die Frage nach der Rolle von Fürsorge und Solidarität
- Die Vereinbarkeit von Rawls' Theorie mit einer gerechten Gesellschaft, die die Belange von Frauen berücksichtigt
- Der Einfluss von Gilligans These der "zwei Moralen" auf die feministische Kritik an Rawls
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II widmet sich der These von den zwei Moralen, die Carol Gilligan in ihrem Werk "In a different voice" (1982) formuliert. Gilligan beschreibt eine "feminine" Moral der Fürsorge und Anteilnahme, die sich von der "maskulinen" Moral der Gerechtigkeit und Pflichten unterscheidet. Die Autorin diskutiert die Relevanz dieser Unterscheidung für das Verständnis sozialer Gemeinschaften und die Entwicklung moralischer Orientierungen.
Kapitel III analysiert die feministische Kritik an Rawls' Urzustand. Die Kritikpunkte fokussieren auf die vermeintliche Vernachlässigung der weiblichen Erfahrungswelt und der spezifisch weiblichen Moral in Rawls' Konzeption des Urzustands. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Argumente, wie zum Beispiel Helds Plädoyer für die Einbeziehung der weiblichen Moral und Benhabibs Forderung nach der Einbeziehung der "konkreten Anderen" im Urzustand.
Kapitel IV untersucht die feministische Kritik an Rawls' politischem Liberalismus. Die Kritik argumentiert, dass Rawls' Theorie einen atomistischen Individualismus fördert, der die Bedeutung von Fürsorge und Solidarität in der Gesellschaft vernachlässigt. Die Arbeit betrachtet die Kritikpunkte im Kontext der traditionellen Geschlechterrollen und der Frage nach einer gerechten Gestaltung der Familieninstitution.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind: John Rawls, Theorie der Gerechtigkeit, Feministische Kritik, Urzustand, Politischer Liberalismus, Geschlechtsspezifische Moral, Fürsorgeethik, Solidarität, Atomismus, Gerechte Gesellschaft, Carol Gilligan, "In a different voice".
Häufig gestellte Fragen
Was versteht John Rawls unter „Gerechtigkeit als Fairness“?
Es ist eine Theorie, nach der Gerechtigkeitsprinzipien in einem fairen Urzustand unter einem „Schleier des Nichtwissens“ gewählt werden, um eine neutrale Grundstruktur der Gesellschaft zu schaffen.
Was ist die zentrale feministische Kritik an Rawls' Theorie?
Feministinnen kritisieren, dass Rawls spezifisch weibliche moralische Erfahrungen, die Sphäre des Privaten (Familie) und Werte wie Fürsorge und Solidarität vernachlässigt.
Was besagt Carol Gilligans These der „zwei Moralen“?
Gilligan unterscheidet zwischen einer „maskulinen“ Gerechtigkeitsmoral und einer „femininen“ Fürsorgeethik, die stärker auf Beziehungen und Empathie basiert.
Berücksichtigt Rawls die Gerechtigkeit innerhalb der Familie?
Kritikerinnen werfen Rawls vor, die Familie als private Institution weitgehend aus seinen Gerechtigkeitsprinzipien auszuklammern, was bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zementieren könne.
Was bedeutet der „Schleier des Nichtwissens“?
Es ist ein Gedankenexperiment, bei dem die Entscheider ihre eigene soziale Stellung, ihr Geschlecht und ihre Talente nicht kennen, um unvoreingenommene Gerechtigkeitsprinzipien festzulegen.
- Quote paper
- Carolin Duss (Author), 2009, Gerechtigkeit als Fairness – reine Männersache?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145579