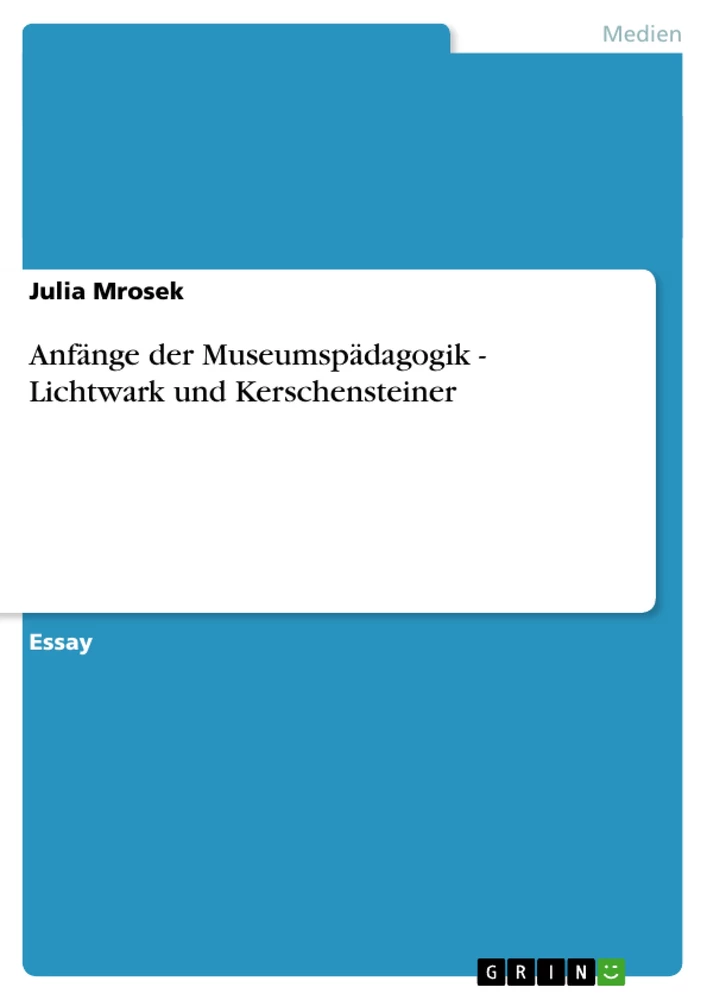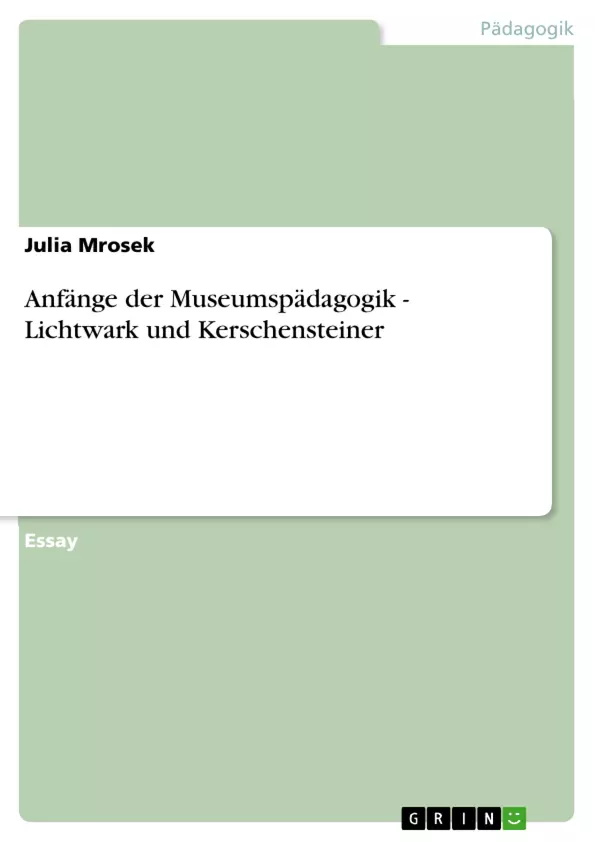Bis ins 19. Jahrhundert ist der Zugang zu originalen Kunstwerken dem Adel vorbehalten und erst als die damaligen Fürsten den Bürgern erlauben, ihre eigenen Sammlungen anzusehen, werden sie so der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Alfred Lichtwark, der deutsche Kunsthistoriker und Museumsleiter in Hamburg, holt Schulklassen ins Museum und schafft einen Anfang zur Entwicklung einer Museumspädagogik, deren eigentliche Blütezeit in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts anzusiedeln ist. Die Intention seiner Idee ist es, das Bürgertum an die Kunst heranzuführen und gleichzeitig die Erziehung des Auges der Schüler zu gewährleisten. Seine Schüler sollten Dilettanten, unter diese man damals „Kenner und Liebhaber“ der Kunst fasste, werden, die sich mit Kunst auskennen und sie fördern und sich zugleich kritisch der Industrieproduktion zuwenden. Heutzutage spielt die Freizeitgestaltung in der Museumspädagogik eine größere Rolle, wobei der Bildungsauftrag zu sehr in den Hintergrund rückt. Aus dem Band Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken kann man entnehmen, wie Lichtwarks Museumsführungen mit den Schülern anliefen:
Er führte die Klasse geschlossen durch seine Ausstellung, wobei er nur ausgewählte realistische und naturalistische Originale zeitgenössischer Kunst näher betrachtete und besprach. Dabei stellte er selbst Fragen und die Schüler antworteten ihm.
Bis ins 19. Jahrhundert ist der Zugang zu originalen Kunstwerken dem Adel vorbehalten und erst im 19. Jahrhundert, als die damaligen Fürsten den Bürgern erlauben, ihre eigenen Sammlungen anzusehen, werden sie so der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Alfred Lichtwark, der deutsche Kunsthistoriker und Museumsleiter in Hamburg, holt Schulklassen ins Museum und schafft einen Anfang zur Entwicklung einer Museumspädagogik, deren eigentliche Blütezeit in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts anzusiedeln ist. Die Intention seiner Idee ist es, das Bürgertum an die Kunst heranzuführen und gleichzeitig die Erziehung des Auges der Schüler zu gewährleisten. Seine Schüler sollten Dilettanten, unter diese man damals „Kenner und Liebhaber“ der Kunst fasste, werden, die sich mit Kunst auskennen und sie fördern und sich zugleich kritisch der Industrieproduktion zuwenden. Heutzutage spielt die Freizeitgestaltung in der Museumspädagogik eine größere Rolle, wobei der Bildungsauftrag zu sehr in den Hintergrund rückt. Aus dem Band Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken kann man entnehmen, wie Lichtwarks Museumsführungen mit den Schülern anliefen:
Er führte die Klasse geschlossen durch seine Ausstellung, wobei er nur ausgewählte realistische und naturalistische Originale zeitgenössischer Kunst näher betrachtete und besprach. Dabei stellte er selbst Fragen und die Schüler antworteten ihm.
Besonderen Wert legte er bei der Besprechung der inhaltlichen Aspekte der Werke. Sie wurden als Dokumente historischer Begebenheiten gesehen, die mit Hilfe des Dialogs in das geschichtliche Umfeld eingebettet wurden. Der Gedanke der Nationalerziehung stand im Vordergrund. Hauptsächlich wurden die Werke deutscher Maler, insbesondere Hamburgs, betrachtet, obwohl sich in seiner Sammlung auch die Werke französischer Maler, wie Monet oder Vuillard, befanden. Weiterhin stand die Schulung der Wahrnehmung im Vordergrund; auf die stilistische Einordnung oder Künstlerbiografien ging er nicht ein.
Des weiteren gründet Lichtwark in Hamburg einen Verein der Amateurfotografen um auch dem Volk einen praktischen Umgang mit Kunst zu ermöglichen. Die Verwendung des Fotos als künstlerisches Medium setzt sich immer mehr durch.
Neben Lichtwark leistet auch Georg Kerschensteiner, Gründer der Berufsschule, Fortschritte auf dem Gebiet der ästhetischen Erziehung.
Sein Ziel ist es, brauchbare Staatsbürger mit Fleiß, Durchhaltevermögen, Teamgeist und Sauberkeit heranzuziehen. 1903 leitet er den 2. Kunsterziehungstag, 1905 ist er Vorsitzender auf dem Kunsterziehungstag in Hamburg und 1908 tritt er dem deutschen Werkbund als Mitglied bei. Den herkömmlichen Zeichenunterricht, der unter anderem geometrisches Zeichnen und Stigmenzeichnen beinhaltet, und wissenschaftsorientierten Unterricht lehnt er ab und fordert eine Neugestaltung des Zeichenunterrichts. Als Stadtschulrat in München hat er einfachen Zugriff auf Kinderzeichnungen, was ihm ermöglicht, eine Massenuntersuchung zum bildnerischen Gestalten von Schülern durchzuführen. 4 Jahre lang sammelt er insgesamt 500000 Kinderzeichnungen und wertet sie unter drei verschiedenen Aspekten aus:
1. Wie entwickelt sich die graphische Ausdrucksfähigkeit des unbeeinflussten Kindes vom primitiven Schema zur vollendeten Raumdarstellungsfähigkeit?
2. Welche Qualität der Ausdrucksfähigkeit kann bei Kindern von 6 bis 14 Jahren erwartet werden?
3. Wie verhält sich das Kind zum Ornament?
Die Kinder waren angehalten, sich mit Themen wie zum Beispiel Mensch, Tier, Pflanze Straßenbahn oder auch Ereignissen wie eine Schneeballschlacht auseinanderzusetzen. In seinem Werk Die Entwicklung der zeichnerischen Begabung, welches im Jahre 1905 erscheint, hält er anschließend seine Ergebnisse zur Untersuchung fest.
Er stellt 4 Stufen der Entwicklung auf:
1. Schema
2. Schema vermischt mit Erscheinungsgemäßem
3. Die erscheinungsgemäße Darstellung
4. Die formgemäße Darstellung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Der Text behandelt die Entwicklung der Museumspädagogik und der Kunsterziehung in Deutschland bis ins frühe 20. Jahrhundert. Er beschreibt, wie der Zugang zu Kunstwerken allmählich für die breite Öffentlichkeit geöffnet wurde und wie Kunsthistoriker und Pädagogen begannen, Kunst in die Bildung einzubeziehen.
Wer waren Alfred Lichtwark und Georg Kerschensteiner und welche Rolle spielten sie?
Alfred Lichtwark war ein deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter, der Schulklassen ins Museum holte und den Grundstein für die Museumspädagogik legte. Er wollte das Bürgertum an die Kunst heranführen und die Wahrnehmung der Schüler schulen. Georg Kerschensteiner war ein Pädagoge, der sich für die ästhetische Erziehung einsetzte und den Zeichenunterricht reformieren wollte. Er führte eine Massenuntersuchung von Kinderzeichnungen durch, um die Entwicklung der zeichnerischen Fähigkeiten zu erforschen.
Was waren Lichtwarks Ansätze in der Museumspädagogik?
Lichtwark führte Schulklassen durch Ausstellungen und besprach ausgewählte realistische und naturalistische Originale zeitgenössischer Kunst. Er legte Wert auf die inhaltlichen Aspekte der Werke und betrachtete sie als Dokumente historischer Begebenheiten. Er förderte den Dialog über die Werke und bettete sie in den geschichtlichen Kontext ein. Er gründete auch einen Verein für Amateurfotografen, um den praktischen Umgang mit Kunst zu ermöglichen.
Was waren Kerschensteiners Ziele und Methoden in der Kunsterziehung?
Kerschensteiner wollte brauchbare Staatsbürger erziehen und lehnte den herkömmlichen Zeichenunterricht ab. Er forderte eine Neugestaltung des Zeichenunterrichts und führte eine Massenuntersuchung von Kinderzeichnungen durch. Er analysierte die Entwicklung der graphischen Ausdrucksfähigkeit von Kindern und stellte vier Stufen der Entwicklung auf: Schema, Schema vermischt mit Erscheinungsgemäßem, die erscheinungsgemäße Darstellung und die formgemäße Darstellung.
Welche Kritik gab es an Kerschensteiners Untersuchung von Kinderzeichnungen?
Die Kritik bemängelte Fehler in der wissenschaftlichen Untersuchung und bezweifelte, dass Kinderzeichnungen gänzlich frei von äußeren Beeinflussungen sein könnten.
- Citation du texte
- Julia Mrosek (Auteur), 2006, Anfänge der Museumspädagogik - Lichtwark und Kerschensteiner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142438