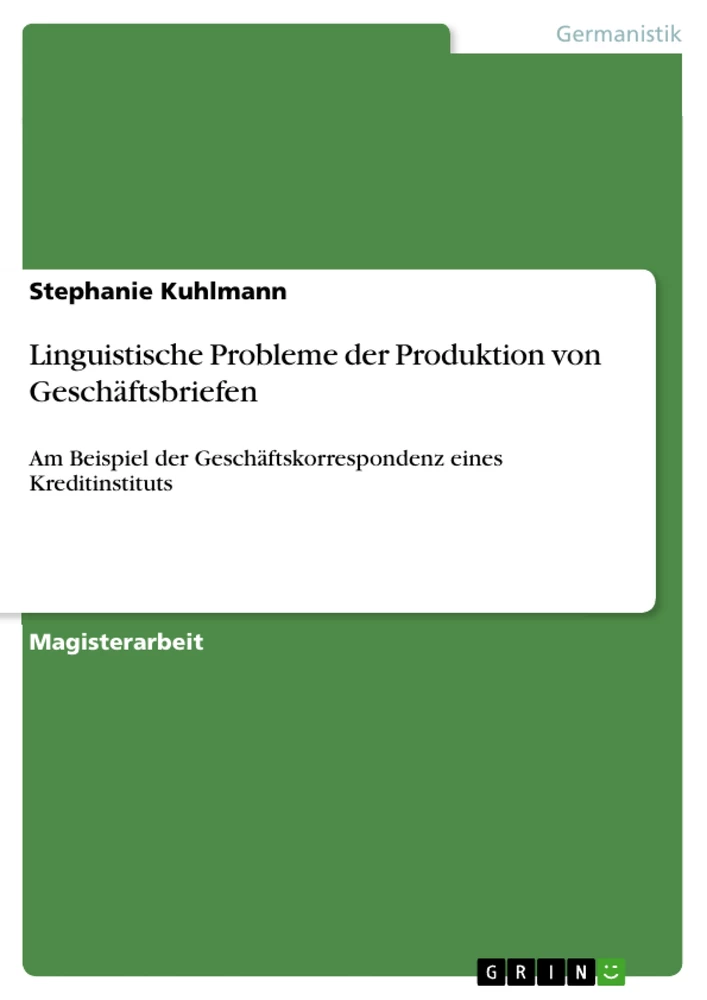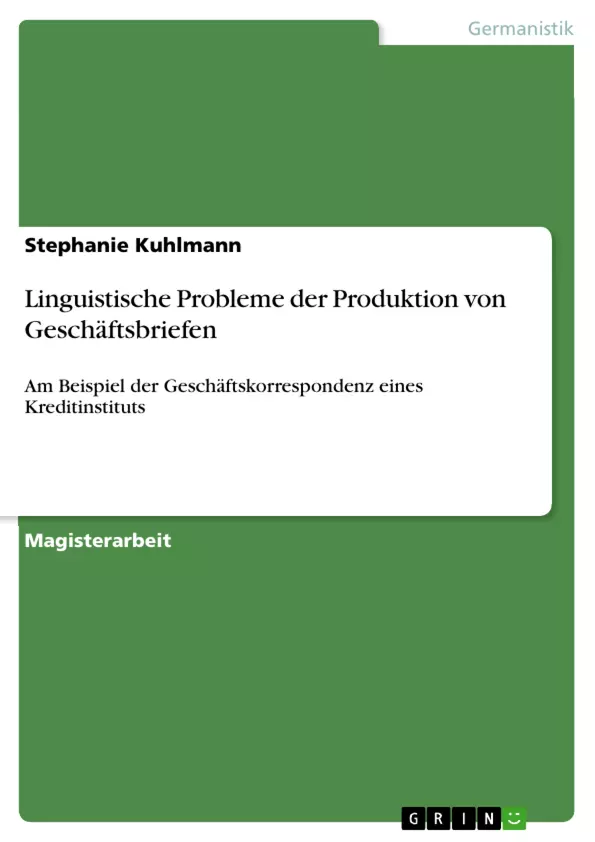Optimale Kundenkommunikation beginnt bei der Geschäftskorrespondenz. Noch immer werden Briefe nicht kundenorientiert geschrieben, sondern eher im behördlichen Stil oder zu direkt, sodass sie unhöflich sind. Die Kommunikation wird dadurch gestört. Diese Magisterarbeit befasst sich mit den linguistischen Problemen bei der Produktion von Geschäftsbriefen, sie untersucht Praxisbeispiele der Sparkasse Aachen und enthält einen Leitfaden zur optimalen Korrespondenz, der ebenfalls bei der Sparkasse Aachen entwickelt wurde. Diese Arbeit wurde mit der Note sehr gut vom Professor für Linguistik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen bewertet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Kapitel 1: Die Entwicklung des Konzepts
- Kapitel 2: Anwendung des Konzepts in der Praxis
- Kapitel 3: Kritik und Weiterentwicklung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Entwicklung, Anwendung und Kritik eines bestimmten Konzepts. Sie verfolgt das Ziel, das Konzept in seiner historischen und aktuellen Bedeutung zu beleuchten sowie seine praktische Relevanz zu analysieren.
- Die Entstehung und Entwicklung des Konzepts
- Die Anwendung des Konzepts in verschiedenen Kontexten
- Kritik an dem Konzept und seine Weiterentwicklung
- Die Bedeutung des Konzepts für die Gegenwart
- Mögliche zukünftige Entwicklungen des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Konzepts und beschreibt seine Entwicklung über die Zeit. Das zweite Kapitel zeigt anhand praktischer Beispiele die Anwendung des Konzepts in verschiedenen Bereichen. Das dritte Kapitel analysiert kritisch die Vor- und Nachteile des Konzepts und diskutiert verschiedene Möglichkeiten, es weiterzuentwickeln.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept, seiner Entstehung, Anwendung, Kritik und Weiterentwicklung. Wichtige Schlüsselwörter sind daher: Konzept, Entwicklung, Anwendung, Kritik, Weiterentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten linguistischen Probleme in Geschäftsbriefen?
Häufige Probleme sind ein veralteter "behördlicher" Stil, mangelnde Kundenorientierung, eine zu direkte (unhöfliche) Ausdrucksweise oder unklare Formulierungen, die die Kommunikation stören.
Wie sieht eine optimale kundenorientierte Korrespondenz aus?
Optimale Korrespondenz ist wertschätzend, klar strukturiert und auf die Bedürfnisse des Empfängers zugeschnitten. Sie vermeidet Floskeln und komplizierte Schachtelsätze.
Warum ist der Schreibstil für Unternehmen wie Banken so wichtig?
Der Geschäftsbrief ist oft die erste oder wichtigste Schnittstelle zum Kunden. Ein professioneller und freundlicher Stil stärkt das Vertrauen und das Image des Unternehmens (z. B. der Sparkasse Aachen).
Gibt es einen Leitfaden für bessere Geschäftsbriefe?
Ja, die Arbeit enthält einen praxisnahen Leitfaden, der linguistische Erkenntnisse nutzt, um Mitarbeitern dabei zu helfen, verständlicher und sympathischer zu kommunizieren.
Wie beeinflusst die Linguistik die Produktion von Briefen?
Linguistische Analysen helfen dabei, Missverständnisse in der Textstruktur oder Wortwahl zu identifizieren und Regeln für eine gelungene schriftliche Interaktion aufzustellen.
- Citar trabajo
- Stephanie Kuhlmann (Autor), 1998, Linguistische Probleme der Produktion von Geschäftsbriefen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1322681