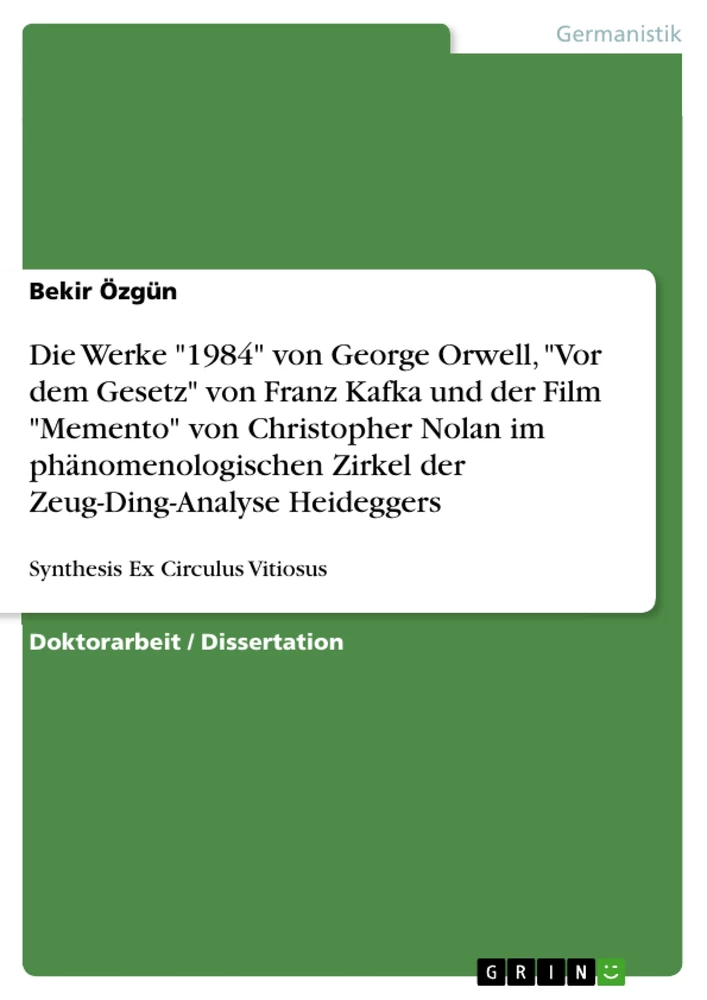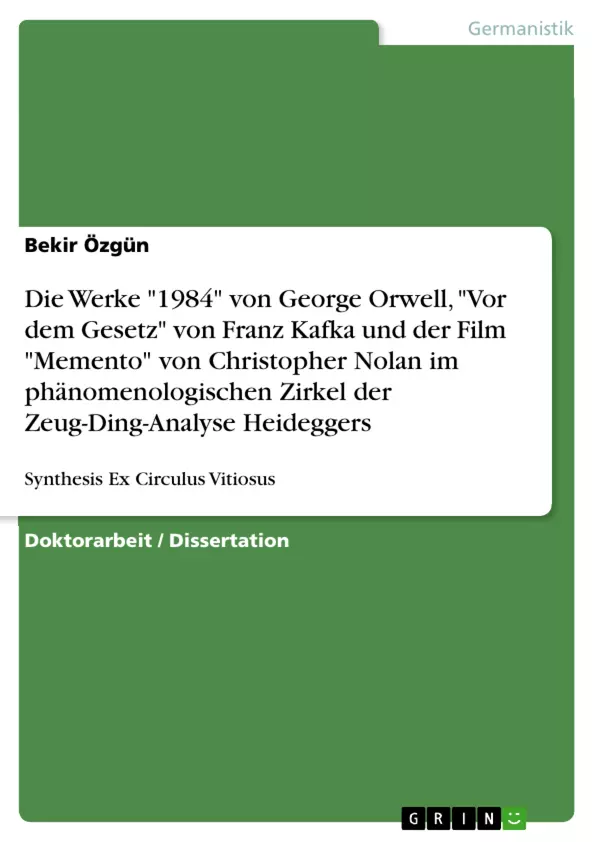Die Gegenüberstellung der Werke "1984" (1949) von George Orwell, "Vor dem Gesetz" (1915) von Franz Kafka und "Memento" (2000) von Christopher Nolan zeigte uns die verblüffende Ähnlichkeit des Plots, was vor allem die affektive Verfassung der Protagonisten und ihren Werdegang betraf. Angst, Verzweiflung, Schmerz, Verlust, Verrat und Tod sind Zustände, die dem Mann vom Lande in der Parabel "Vor dem Gesetz", Winston Smith in dem Roman "1984" und Leonard Shelby in dem Film "Memento" widerfahren. Dies alles sind Stimmungen, die den Menschen und sein Leben betreffen. Wir brachten daher die Gedanken des Existentialismus in Anwendung. Der Fokus auf die Existenz des Menschen und seiner Daseinsmöglichkeiten in der Welt war für diese Arbeit ausschlaggebend. Dabei tritt der phänomenologische Ansatz des deutschen Philosophen Martin Heidegger aus "Sein und Zeit" (1927) hinzu. Die Phänomenologie ist eine philosophische Strömung, die die Lehre "vom Sichzeigenden" besagt. In seinem Hauptwerk führt Heidegger eine Zeug-Ding-Analyse durch, die wir gebrauchten, um eine tiefere Deutungsmöglichkeit der Werke zu schaffen. Des Weiteren wurde die Methode des Vergleichs aus der komparatistischen Disziplin angewandt, um eine Reflexion der Erlebnisse und Erfahrungen aus den drei unterschiedlichen Handlungssträngen zu ziehen, sodass ein tieferes Verständnis der Werke gewährleistet wurde. Auf die Intermedialität der Komparatistik wurde ebenfalls eingegangen, da wir in dieser Arbeit auch eine Brücke zwischen dem Film "Memento" und den literarischen Werken "1984" und "Vor dem Gesetz" geschlagen haben. Nebenbei deuteten wir auf den gegenseitigen Effekt der Literatur mit der Philosophie. Da wir die Literatur aus dem Lichte der Philosophie interpretierten, bedienten wir uns der literaturphilosophischen Methode. Sie lieferte uns ebenfalls eingehende Interpretationsmöglichkeiten, die zum Beleuchten der ausgewählten Werke führten.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- 2.1 Heideggers Zeug-Ding-Analyse
- 2.2 Existentielle Phänomenologie
- Kapitel 3: Analyse von "1984"
- Kapitel 4: Analyse von "Vor dem Gesetz"
- Kapitel 5: Analyse von "Memento"
- Kapitel 6: Vergleichende Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Doktorarbeit untersucht die existentielle Erfahrung von Individuen in totalitären und absurden Welten. Sie analysiert, wie die literarischen Werke "1984" von George Orwell und "Vor dem Gesetz" von Franz Kafka sowie der Film "Memento" von Christopher Nolan das Konzept der Zeit und des Seins im Lichte von Heideggers Zeug-Ding-Analyse beleuchten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der menschlichen Existenz in diesen drei Werken aufzuzeigen.
- Existenzielle Erfahrung in totalitären Systemen
- Heideggers Phänomenologie und die Wahrnehmung von Zeit und Sein
- Die Rolle der Erinnerung und des Vergessens
- Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
- Die Grenzen des menschlichen Wissens und der Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage. Es skizziert den methodischen Ansatz der vergleichenden existentiellen Reflexion und beschreibt die Auswahl der drei untersuchten Werke ("1984", "Vor dem Gesetz", "Memento"). Die Relevanz der gewählten Werke im Kontext der Heidegger'schen Phänomenologie wird begründet und die Struktur der Arbeit wird vorgestellt.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt detailliert Heideggers Zeug-Ding-Analyse aus "Sein und Zeit" und erläutert deren Relevanz für das Verständnis der existentiellen Erfahrung. Die Konzepte von Sein, Zeit, Dasein und die Bedeutung der ontologischen Differenz werden ausführlich diskutiert, um ein solides Fundament für die anschließende Analyse der literarischen und filmischen Werke zu schaffen. Es werden zudem die relevanten Aspekte der existentiellen Phänomenologie im Kontext des Themas erläutert.
Kapitel 3: Analyse von "1984": In diesem Kapitel wird George Orwells "1984" im Lichte der theoretischen Grundlagen analysiert. Die existenzielle Erfahrung des Protagonisten Winston Smith im totalitären System Ozeanias wird im Detail untersucht, wobei die Manipulation von Zeit, Erinnerung und Sprache im Fokus steht. Die Mechanismen der Macht und der Kontrollmechanismen werden erläutert und die Frage nach der Möglichkeit von Widerstand und Autonomie in einem solchen System behandelt. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung von Sprache und Wahrheit für die menschliche Existenz in Orwells dystopischer Welt.
Kapitel 4: Analyse von "Vor dem Gesetz": Dieses Kapitel konzentriert sich auf Franz Kafkas Parabel "Vor dem Gesetz". Die Analyse untersucht die existenzielle Situation des Mannes, der vor dem Gesetz steht und dessen unerfüllbarer Wunsch nach Zugang zum Recht im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Die Deutungsmöglichkeiten der Parabel im Hinblick auf die Themen Unzugänglichkeit, Machtstrukturen und der Sinnlosigkeit des Daseins werden ausgiebig erörtert. Die Verbindung zur Heidegger'schen Phänomenologie wird aufgezeigt, insbesondere im Bezug auf die Fragen nach dem Sein und dem Zugang zur Wahrheit.
Kapitel 5: Analyse von "Memento": Hier wird Christopher Nolans Film "Memento" analysiert. Der Fokus liegt auf der existentiellen Bedeutung des Gedächtnisses und des Vergessens für die Konstruktion von Identität und der Erfahrung von Zeit. Die besondere Struktur des Films mit seiner umgekehrten Chronologie wird im Kontext der Heidegger'schen Phänomenologie interpretiert. Die Analyse untersucht, wie die Hauptfigur Leonard Shelby durch die Fragmentierung seiner Erinnerung versucht, seine Identität zu rekonstruieren und mit seiner Vergangenheit zu ringen, wobei die Grenzen der Erinnerung und die Konstruktion von Identität im Mittelpunkt stehen.
Kapitel 6: Vergleichende Analyse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Einzelanalysen von "1984", "Vor dem Gesetz" und "Memento" vergleichend gegenübergestellt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der existentiellen Erfahrung werden herausgearbeitet und im Kontext der Heidegger'schen Phänomenologie interpretiert. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten, wie die drei Werke das Thema Zeit, Sein und die Grenzen des menschlichen Wissens erkunden. Die Unterschiede in den jeweiligen Darstellung der totalitären und absurden Welten werden diskutiert und die Bedeutung der drei Werke für das Verständnis der menschlichen Existenz im 21. Jahrhundert werden reflektiert.
Schlüsselwörter
Existenzielle Phänomenologie, Heidegger, Sein und Zeit, Zeug-Ding-Analyse, George Orwell, 1984, Franz Kafka, Vor dem Gesetz, Christopher Nolan, Memento, Zeit, Erinnerung, Vergessen, Totalitarismus, Absurdität, Individuum, Gesellschaft, Macht, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Doktorarbeit: Existentielle Erfahrung in totalitären und absurden Welten
Was ist das Thema der Doktorarbeit?
Die Doktorarbeit untersucht die existentielle Erfahrung von Individuen in totalitären und absurden Welten. Sie analysiert, wie die literarischen Werke "1984" von George Orwell und "Vor dem Gesetz" von Franz Kafka sowie der Film "Memento" von Christopher Nolan das Konzept der Zeit und des Seins im Lichte von Heideggers Zeug-Ding-Analyse beleuchten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der menschlichen Existenz in diesen drei Werken aufzuzeigen.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert George Orwells Roman "1984", Franz Kafkas Parabel "Vor dem Gesetz" und Christopher Nolans Film "Memento". Diese Werke wurden ausgewählt, da sie unterschiedliche Facetten der existentiellen Erfahrung in totalitären und absurden Kontexten darstellen und sich gut für eine vergleichende Analyse eignen.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf Heideggers Phänomenologie, insbesondere seiner Zeug-Ding-Analyse aus "Sein und Zeit". Konzepte wie Sein, Zeit, Dasein und die ontologische Differenz bilden das theoretische Fundament für die Interpretation der drei analysierten Werke.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Heidegger), drei Kapitel zur Einzelanalyse von "1984", "Vor dem Gesetz" und "Memento", und ein abschließendes Kapitel mit einer vergleichenden Analyse der drei Werke.
Was wird in Kapitel 3 ("1984") analysiert?
Kapitel 3 untersucht die existentielle Erfahrung von Winston Smith in Orwells "1984". Der Fokus liegt auf der Manipulation von Zeit, Erinnerung und Sprache im totalitären System Ozeanias, den Mechanismen der Macht und der Möglichkeiten von Widerstand.
Was wird in Kapitel 4 ("Vor dem Gesetz") analysiert?
Kapitel 4 analysiert Kafkas Parabel "Vor dem Gesetz" und untersucht die existenzielle Situation des Mannes vor dem Gesetz, die Unzugänglichkeit, Machtstrukturen und die Sinnlosigkeit des Daseins. Die Verbindung zur Heidegger'schen Phänomenologie wird herausgestellt.
Was wird in Kapitel 5 ("Memento") analysiert?
Kapitel 5 analysiert Nolans Film "Memento" und konzentriert sich auf die existentielle Bedeutung von Gedächtnis und Vergessen für die Konstruktion von Identität und die Erfahrung von Zeit. Die umgekehrte Chronologie des Films wird im Kontext der Heidegger'schen Phänomenologie interpretiert.
Was ist das Ergebnis der vergleichenden Analyse (Kapitel 6)?
Kapitel 6 vergleicht die Ergebnisse der Einzelanalysen und beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der existentiellen Erfahrung in den drei Werken. Es wird die Bedeutung der drei Werke für das Verständnis der menschlichen Existenz im 21. Jahrhundert reflektiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Existentielle Phänomenologie, Heidegger, Sein und Zeit, Zeug-Ding-Analyse, George Orwell, 1984, Franz Kafka, Vor dem Gesetz, Christopher Nolan, Memento, Zeit, Erinnerung, Vergessen, Totalitarismus, Absurdität, Individuum, Gesellschaft, Macht, Identität.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, insbesondere für Leser mit Interesse an existentieller Phänomenologie, Literaturwissenschaft und Filmtheorie.
- Citation du texte
- Dr. phil. Bekir Özgün (Auteur), 2022, Die komparative-existenzielle Reflexion der literarischen Werke "1984" von George Orwell, "Vor dem Gesetz" von Franz Kafka und des Films "Memento" von Christopher Nolan im phänomenologischen Zirkel der Zeug-Ding-Analyse Heideggers in "Sein und Zeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1272882