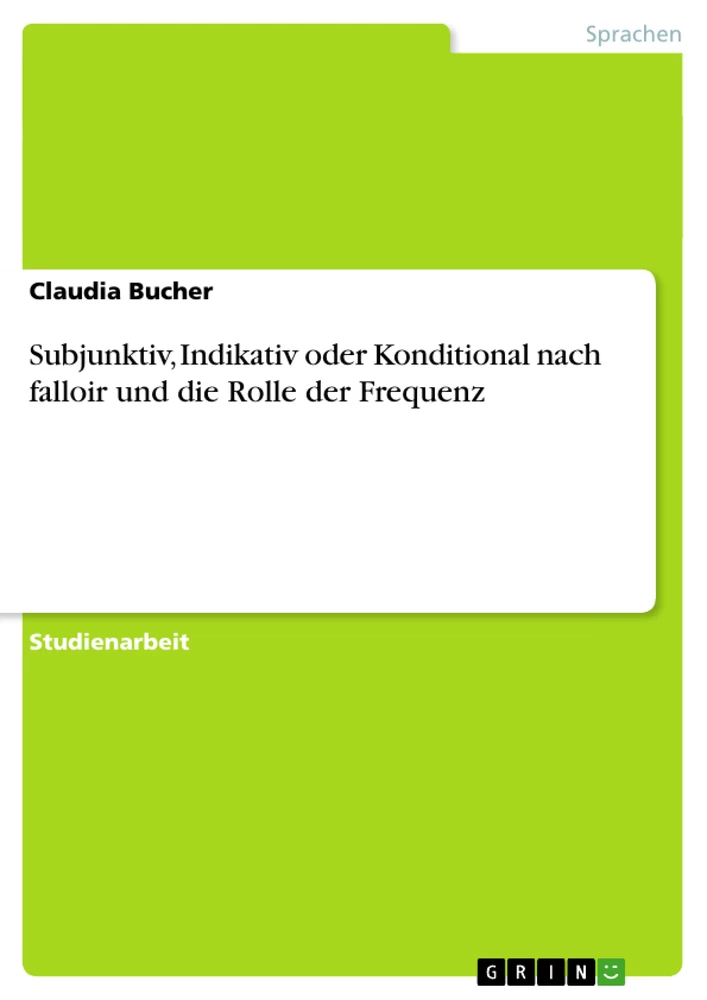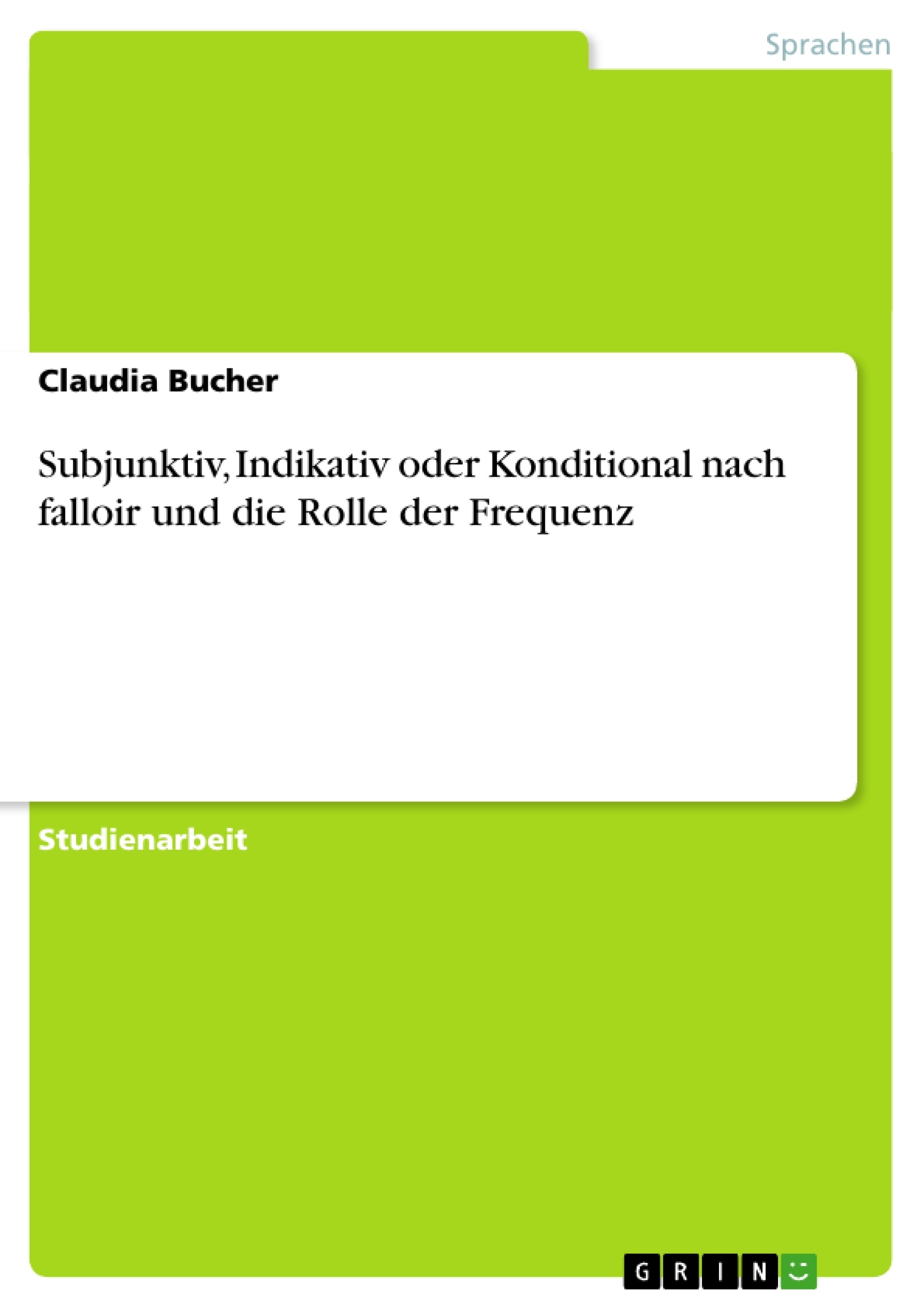[...] Die somit
in der Theorie recht durchschaubare Bildung und Anwendung des Subjunktivs wird erschüttert
durch den tatsächlichen Gebrauch dessen im gesprochenen Französisch: Einerseits
wird der Subjunktiv nach Konjunktionen verwendet, die ursprünglich keinen verlangen
(après que), andererseits ist bei immer mehr Verben, die ursprünglich den Subjunktiv verlangen,
ein Rückgang des Subjunktivs zu verzeichnen (z.B. bei verneinten Verben des Fühlens
und Denkens). Bei einigen wenigen der Subjunktiv fordernden Verben, wie z.B. falloir,
scheint er sich jedoch zu halten. Es kann angenommen werden, dass die Konservierung des
Subjunktivs bei diesen Verben mit der Frequenz der Verben selbst zusammenhängt. Was aber nun, wenn nach falloir nicht der Subjunktiv, sondern Indikativ oder Konditional
folgt?
Diese Frage soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Gegenüber stehen sie hierbei
der Konservierungseffekt (Subjunktiverhalt) und die Tendenz zu analogem Ausgleich (Indikativ-/
Konditionalgebrauch), wie er bei vielen Matrixverben bereits geschehen ist. Im Folgenden
wird untersucht, welche semantischen, pragmatischen und syntaktischen Bedingungen
erfüllt werden, dass nach falloir nicht der Subjunktiv folgt. Dabei soll diskutiert werden,
ob die Semantik des Matrixverbs, wie Poplack (1992) annimmt, keine Rolle beim Gebrauch
oder Nichtgebrauch des Subjunktivs spielt und der Ausdruck des Modus von morphosyntaktischen
Faktoren abhängt. Dies soll in Hinblick auf die Rolle der Frequenz bei Sprachwandelprozessen geschehen.
Wenn man davon ausgeht, dass der Gebrauch von sprachlichen Formen die Grammatik formt
(„language use shapes grammar“, Bybee und Thompson 2007: 269), so ist die Häufigkeit des
Gebrauchs einer sprachlichen Form und die folgende Verankerung derer (entrenchment) in
der mentalen Repräsentation des Sprechers von zentraler Bedeutung.
Die Rolle der Frequenz bei Sprachwandelprozessen wird in Kapitel 1 erläutert. Dabei wird
die Studie von Poplack zum Gebrauch des Subjunktivs im Kanadafranzösischen vorgestellt
und ihre Ergebnisse werden kritisch betrachtet. In Kapitel 2 folgt die Analyse des Indikativoder
Konditionalgebrauchs nach falloir im Französischen Europas. In Kapitel 3 wird diese
Untersuchung mit Poplacks Studie verglichen und die Rolle der Frequenz wird hinsichtlich
der Ergebnisse diskutiert. Kapitel 4 wird einen Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Frequenzeffekte
- Poplacks Studie zum Subjunktiv im Kanadafranzösischen
- Kritische Betrachtung von Poplacks Studie
- Empirische Untersuchung
- Daten
- Vorgehen und Auswertung der Daten
- Ergebnisse der Untersuchung
- IND-Gebrauch aufgrund von falloir als Diskurs strukturierender Marker
- IND-Gebrauch aufgrund von falloir als Einleitung konkurrierend mit anderen syntaktischen Strukturen
- Der IND als Vereinfachung der Informations- und syntaktischen Struktur
- KOND-Gebrauch aufgrund von Tendenz zur Zeitkonkordanz
- Synthese, Vergleich mit Poplacks Studie, Diskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Gebrauch von Indikativ und Konditional anstelle des Subjunktivs nach dem Verb falloir im Französischen. Sie analysiert die semantischen, pragmatischen und syntaktischen Bedingungen, die zu dieser Abweichung von der traditionellen Grammatik führen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rolle der Frequenz des Verbs falloir selbst und deren Einfluss auf den Sprachwandelprozess.
- Der Einfluss von Frequenzeffekten auf Sprachwandelprozesse
- Kritische Auseinandersetzung mit Poplacks Studie zum Subjunktiv im Kanadafranzösischen
- Analyse des Indikativ- und Konditionalgebrauchs nach falloir
- Vergleich der empirischen Ergebnisse mit den theoretischen Annahmen
- Die Rolle der Frequenz bei der Konservierung oder dem Wandel grammatischer Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Modalität im Französischen ein und stellt die Problematik des Subjunktivgebrauchs nach bestimmten Verben, insbesondere falloir, dar. Sie zeigt die Diskrepanz zwischen traditioneller Grammatik und aktuellem Sprachgebrauch auf und umreißt die Forschungsfrage: Warum wird nach falloir manchmal der Indikativ oder Konditional anstelle des erwarteten Subjunktivs verwendet? Die Arbeit kündigt die Untersuchung der semantischen, pragmatischen und syntaktischen Bedingungen an, die diesen Gebrauch erklären.
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es erklärt den Begriff der Frequenz im Kontext von Sprachwandel und differenziert zwischen Token- und Typefrequenz. Es beschreibt den Reduktions- und den Konservierungseffekt, wobei letzterer durch die erhöhte lexikalische Stärke und Verankerung (Entrenchment) hochfrequenter Formen erklärt wird. Es wird die Studie von Poplack (1992) zum Subjunktiv im Kanadafranzösischen vorgestellt, welche die Hypothese aufstellt, dass die Moduswahl nicht von der Semantik des Matrixverbs abhängt, sondern von morphosyntaktischen Faktoren bestimmt wird.
Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung des Indikativ- und Konditionalgebrauchs nach falloir im europäischen Französisch. Es erläutert die verwendeten Daten, die Methode der Datenanalyse und die gewonnenen Ergebnisse. Die Ergebnisse werden in verschiedenen Kategorien präsentiert, die den unterschiedlichen Funktionen des Indikativ- und Konditionalgebrauchs nach falloir entsprechen.
Schlüsselwörter
Frequenz, Sprachwandel, Subjunktiv, Indikativ, Konditional, falloir, Modalität, Morphosyntax, Semantik, Pragmatik, Kanadafranzösisch, Poplack, Entrenchment.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: Gebrauch von Indikativ und Konditional statt Subjunktiv nach "falloir" im Französischen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Gebrauch von Indikativ und Konditional anstelle des Subjunktivs nach dem Verb falloir im Französischen. Sie analysiert die semantischen, pragmatischen und syntaktischen Bedingungen, die zu dieser Abweichung von der traditionellen Grammatik führen und konzentriert sich auf den Einfluss der Frequenz des Verbs falloir auf den Sprachwandel.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Die Studie untersucht den Einfluss von Frequenzeffekten auf Sprachwandelprozesse, setzt sich kritisch mit Poplacks Studie zum Subjunktiv im Kanadafranzösischen auseinander, analysiert den Indikativ- und Konditionalgebrauch nach falloir, vergleicht empirische Ergebnisse mit theoretischen Annahmen und beleuchtet die Rolle der Frequenz bei der Konservierung oder dem Wandel grammatischer Strukturen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Theorien zum Sprachwandel und Frequenzeffekten, inklusive der Unterscheidung zwischen Token- und Typefrequenz sowie den Konzepten des Reduktions- und Konservierungseffekts. Die Studie von Poplack (1992) zum Subjunktiv im Kanadafranzösischen dient als wichtiger Vergleichspunkt.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund, eine empirische Untersuchung, eine Synthese mit Vergleich zu Poplacks Studie und Diskussion sowie einen Ausblick. Der theoretische Teil erläutert Frequenzeffekte und Poplacks Studie kritisch. Die empirische Untersuchung beschreibt Daten, Methode und Ergebnisse zum IND- und KOND-Gebrauch nach falloir, kategorisiert nach unterschiedlichen Funktionen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die empirischen Ergebnisse werden in Kategorien präsentiert, die den unterschiedlichen Funktionen des Indikativ- und Konditionalgebrauchs nach falloir entsprechen. Diese beinhalten den IND-Gebrauch als diskursstrukturierenden Marker, als konkurrierende Einleitung zu anderen syntaktischen Strukturen und als Vereinfachung der Informations- und syntaktischen Struktur. Der KOND-Gebrauch wird im Zusammenhang mit der Tendenz zur Zeitkonkordanz betrachtet.
Wie werden die Ergebnisse mit Poplacks Studie verglichen?
Die Studie vergleicht die empirischen Ergebnisse mit den theoretischen Annahmen und insbesondere mit den Ergebnissen von Poplacks Studie zum Subjunktiv im Kanadafranzösischen. Dieser Vergleich bildet einen zentralen Bestandteil der Synthese und Diskussion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frequenz, Sprachwandel, Subjunktiv, Indikativ, Konditional, falloir, Modalität, Morphosyntax, Semantik, Pragmatik, Kanadafranzösisch, Poplack, Entrenchment.
- Quote paper
- Claudia Bucher (Author), 2009, Subjunktiv, Indikativ oder Konditional nach falloir und die Rolle der Frequenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126956