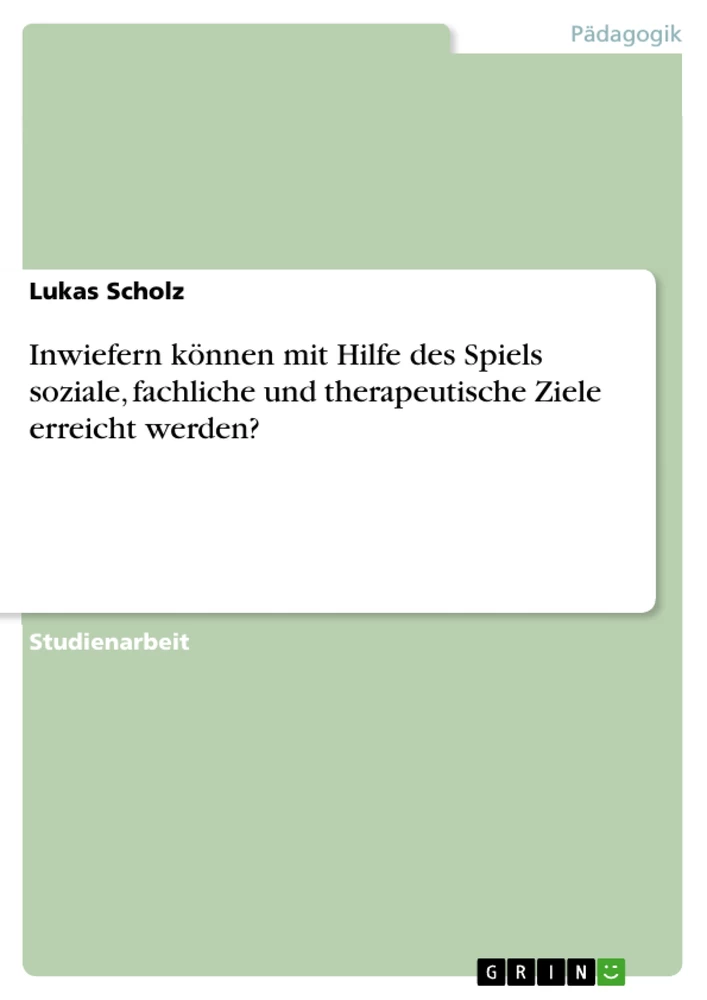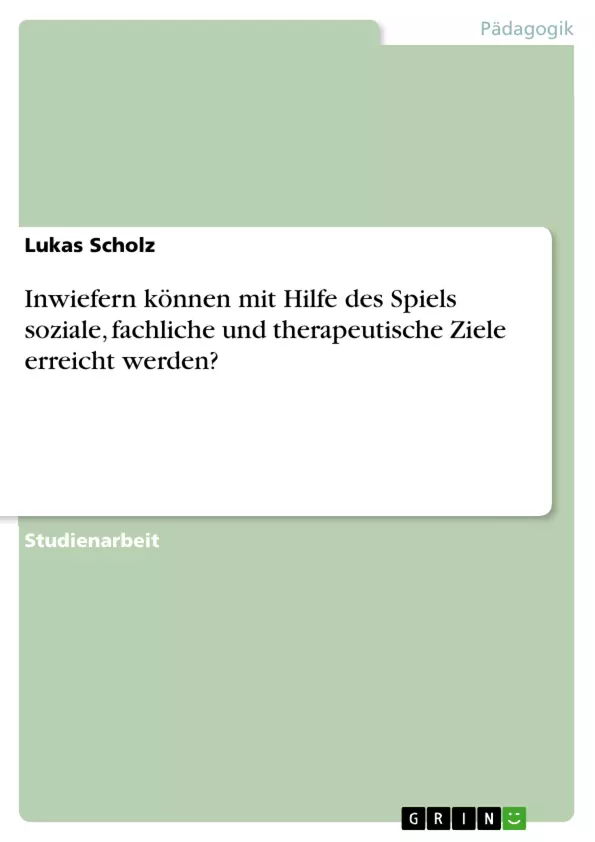Fragt man ein Kind, ob es gerne spielt, so ist die häufigste Antwort:
Ja, weil es Spaß macht!
Wie darf diese Aussage verstanden werden? Das Kind, welches in der gewöhnlichen
Lebenssituation nicht handeln kann wie es der Erwachsene vollzieht, schafft sich
durch das Spiel eine fiktive Wirklichkeit, welche die Befriedigung seiner eigenen
Bedürfnisse ermöglicht. Dem gegenüber steht eine Wirklichkeitskategorie, die nie
aufhört zu sein – der reale Alltag.
Im Spiel ist ein Bereich gefunden, der sich von der „ernsthaften“, festgelegten und
festlegenden Wirklichkeit und ihrem hohen Wirklichkeits- und
Verbindlichkeitscharakter abhebt. Spielen ist eine andere Wirklichkeit mit anderen
Funktionen und Wirkungen, d. h. es ist unverbindlicher, freier sowie offener.
Das Kind realisiert sein Bedürfnis auf verschiedene Art und Weise, d. h. es kann
Lehrer, Elternteil, Arzt, ... werden, während es in seinem Leben und im realen Alltag
zu keiner Zeit eine dieser Personen werden könnte. Weil das Kind sich den
Verhaltensprinzipien der genannten Personen unterstellt, erlernt es die Normen der
Gesellschaft, wobei es sich diesen unterordnet. Es versetzt sich in eine Rolle.
Mit „Rollenspiel“ ist das Spielen der Kinder im frühkindlichen bzw.
vorschulischen Alter gemeint, bei dem die Kinder Personen darstellen,
die sie in ihrem Alltag selber nicht sind.1
Durch die Fähigkeit des Perspektivenwechsels bereitet das Spiel das Kind auf das
Gesellschaftsleben vor, da das Kind nur das tut, was ihm Spaß und Freude bereitet.
Eng damit verbunden ist der bedeutsame Anteil der Phantasie, durch welchen es zur
Umwandlung und Neuschaffung der Wirklichkeit kommt. Diese Art schöpferischen
Spiels trägt eine selbstständige Erkenntnisleistung in sich, da Wirklichkeit neu
bewertet, erkannt und gestaltet wird.
In Anbetracht meiner späteren Lehrertätigkeit möchte ich anhand der Hausarbeit
aufzeigen, dass in jedem Spiel ein Stück Sozialisation stattfindet, als auch dass der
schulische Lernprozess durch Spielen aufgelockert werden kann, wobei durch Spiele
Lernstoff vermittelt wird. Bei der pädagogischen Betrachtungsweise sollte nicht die
Therapie durch Spielen vergessen werden, da einige Schularten auch verhaltens- bzw.
entwicklungsgestörte Kinder in ihren Reihen sitzen haben. Abgerundet werden soll
die Betrachtung durch den Blick in eines der bekanntesten Kinderbücher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spiel und Normen > Ist Spiel und Spielvorgang als ein „Spiegel“ von Weltbegebenheit zu sehen?
- Lernen und Spielen > In welcher Form kann Spielen im Unterricht nutzbar gemacht werden?
- Therapie durch Spielen ◇ Wie dient die Spieltheorie als Mittel zur Kommunikations- und Identitätsförderung?
- Das „gewisse“ Kinderbuch mit sozialem Effekt
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie das Spielen als Mittel zur Erreichung sozialer, fachlicher und therapeutischer Ziele dienen kann. Sie betrachtet das Spiel als eine eigenständige Wirklichkeit, die es Kindern ermöglicht, eigene Bedürfnisse zu befriedigen und Normen der Gesellschaft zu erlernen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Spiels im schulischen Lernprozess und in der pädagogischen Begleitung von Kindern mit Verhaltens- oder Entwicklungsstörungen.
- Die Funktion des Spiels als Spiegel der Weltbegebenheit und die Rolle von Normen und Werten
- Der Einsatz des Spiels im Unterricht zur Vermittlung von Lernstoff und zur Förderung der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt
- Die Bedeutung der Spieltherapie für die Kommunikation und Identitätsentwicklung von Kindern
- Die Sozialisationsfunktion von Spielen und die Auseinandersetzung mit sozialen und moralischen Normen
- Das Spiel als Werkzeug zur Förderung von Kreativität, Fantasie und Problemlösungsfähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Spiels als eigenständige Wirklichkeit ein. Sie stellt die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung und das Lernen von Kindern heraus und betont die Relevanz des Spiels in der Sozialisation und im schulischen Kontext.
- Spiel und Normen: Dieses Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen dem Spiel und der Weltbegebenheit, indem es die temporäre Dimension des Spiels und die Rolle von Normen und Werten im Spielprozess untersucht. Es wird ein „Drei-Welten-Modell“ von Popper vorgestellt, um die Interaktion zwischen Spielenden, Spielräumen und gesellschaftlichen Normen zu verdeutlichen.
- Lernen und Spielen: Hier wird untersucht, wie das Spielen im Unterricht genutzt werden kann, um Lernprozesse zu fördern. Das Kapitel beleuchtet die Rolle des Spiels in der Vermittlung von Lerninhalten, der Entwicklung von Kompetenzen und der Förderung von Kreativität und Fantasie.
- Therapie durch Spielen: Dieses Kapitel fokussiert auf die Bedeutung der Spieltherapie als Mittel zur Kommunikations- und Identitätsförderung bei Kindern. Es beleuchtet die Rolle des Spiels in der Bewältigung von Problemen, der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten und der Förderung von Selbstvertrauen.
Schlüsselwörter
Das Spiel, Sozialisation, Normen, Lernen, Unterricht, Therapie, Kinderbuch, Entwicklung, Pädagogik, Spieltheorie, Kommunikationsförderung, Identitätsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hilft das Spiel Kindern beim Erlernen von Normen?
Im Rollenspiel unterwerfen sich Kinder den Verhaltensprinzipien der dargestellten Personen und erlernen so spielerisch gesellschaftliche Normen und Werte.
Kann Spielen im Schulunterricht sinnvoll eingesetzt werden?
Ja, Spiele können den Lernprozess auflockern und dazu dienen, komplexen Lernstoff motivierend und handlungsorientiert zu vermitteln.
Was versteht man unter Spieltherapie?
Sie nutzt das Spiel als Medium zur Kommunikation und Identitätsförderung, insbesondere bei Kindern mit Verhaltens- oder Entwicklungsstörungen.
Warum ist die Phantasie im Spiel so wichtig?
Durch Phantasie wandeln Kinder die Wirklichkeit um, was eine eigenständige Erkenntnisleistung darstellt und die Problemlösefähigkeit fördert.
Was ist der "Perspektivenwechsel" im Kinderspiel?
Kinder schlüpfen in Rollen (z.B. Arzt, Lehrer), was sie darauf vorbereitet, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und soziale Interaktionen zu verstehen.
- Quote paper
- Lukas Scholz (Author), 2001, Inwiefern können mit Hilfe des Spiels soziale, fachliche und therapeutische Ziele erreicht werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12055