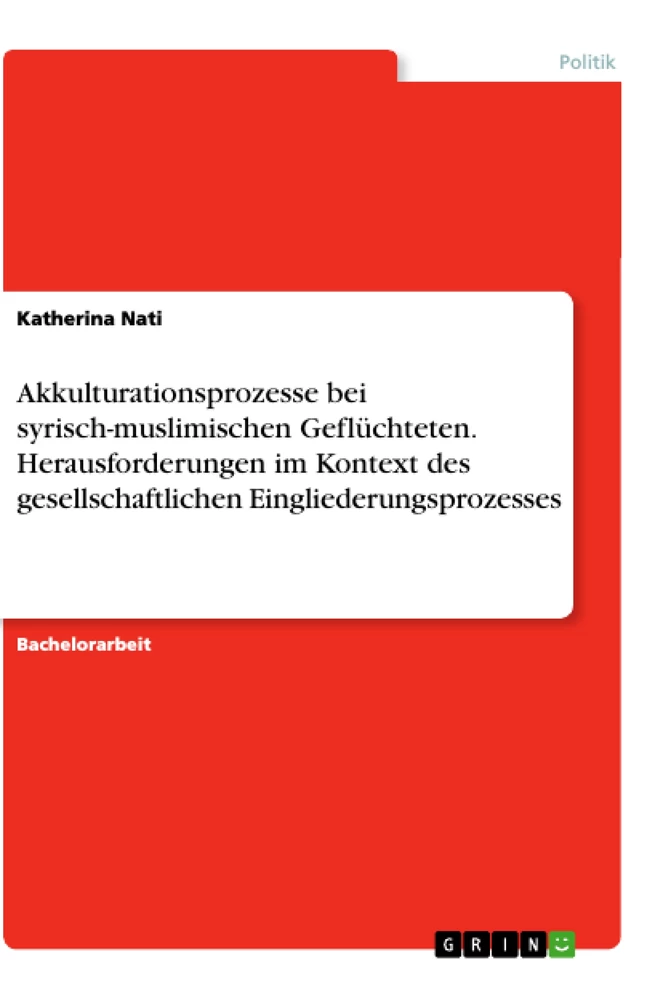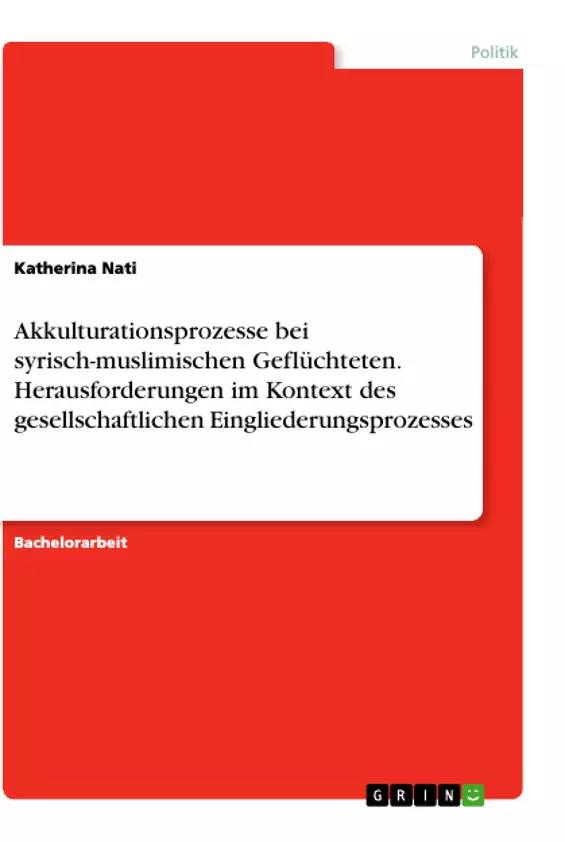Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Akkulturationsprozesse bei syrisch-muslimischen Geflüchteten zu analysieren und die Herausforderungen dieser Thematik zu erkennen. Dazu wird die folgende Forschungsfrage formuliert: „Wie lassen sich die Herausforderungen und Mechanismen der Akkulturation syrisch-muslimischer Geflüchteter in Bezug auf ihren religiösen Wertvorstellungen in Deutschland durch das Akkulturationsmodell nach Esser beschreiben?“. Um die Forschungsfrage dieser Arbeit zu beantworten, wurden Experteninterviews mit Menschen, die durch ihre Berufstätigkeit seit ca. 2015 einen direkten Kontakt zu geflüchteten syrisch-muslimischen Menschen haben, durchgeführt.
Bei der Datenauswertung wird auf das Verfahren der Inhaltsanalyse nach Philip Mayring zurückgegriffen und die Analyse der ausgewerteten Daten wird mit Hinblick auf das Integrationsmodell von Hartmut Esser geführt. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die religiösen Wertvorstellungen insgesamt einen Einfluss auf die Integration haben, vor allem zeigt sich in jeglichen Beobachtungen der Experten eine Segmentation, Assimilation, aber auch eine Mehrfach-Integration. Dies lässt aber nicht ausschließen, dass es von Individuum zu Individuum einen gewissen Effekt auf jegliche Situationen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Geflüchtete
- Integration
- Religiöse Wertvorstellung
- Ableitung der Forschungsfrage
- Methodisches Vorgehen
- Erhebungsinstrument
- Gestaltung des Leitfadens
- Auswahl und Charkterisierung der Experten
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Güte der Forschung
- Erstellung des Kategoriensystems
- Analyse
- Kategorie 1: Herausforderungen seitens des Staates/ der Gesellschaft
- Kategorie 2: Herausforderungen allgemein (intrinsisch)
- Kategorie 3: Chancen seitens des Staates/ der Gesellschaft
- Kategorie 4: Chancen allgemein (intrinsisch)
- Kategorie 5: Herausforderungen aufgrund der religiösen Wertvorstellungen
- Kategorie 6: Individualität
- Beantwortung der Forschungsfrage
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert Akkulturationsprozesse bei syrisch-muslimischen Geflüchteten und identifiziert die damit verbundenen Herausforderungen. Die Forschungsfrage lautet: „Wie lassen sich die Herausforderungen und Mechanismen der Akkulturation syrisch-muslimischer Geflüchteter in Bezug auf ihre religiösen Wertvorstellungen in Deutschland durch das Akkulturationsmodell nach Esser beschreiben?“.
- Akkulturationsprozesse syrisch-muslimischer Geflüchteter
- Herausforderungen der Integration
- Religiöse Wertvorstellungen und ihre Bedeutung im Integrationsprozess
- Anwendung des Akkulturationsmodells nach Esser
- Experteninterviews als Forschungsmethode
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Akkulturationsprozesse bei syrisch-muslimischen Geflüchteten ein und formuliert die Forschungsfrage. Das Kapitel „Theoretische Grundlagen“ beleuchtet zentrale Begriffe wie Geflüchtete, Integration und religiöse Wertvorstellungen und erläutert das Akkulturationsmodell nach Esser. Das Kapitel „Methodisches Vorgehen“ beschreibt die Forschungsmethodik, die Experteninterviews als Erhebungsinstrument und die Anwendung der Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Analyse präsentiert die Ergebnisse der Experteninterviews und diskutiert die Herausforderungen und Chancen im Integrationsprozess aus verschiedenen Perspektiven. Die Beantwortung der Forschungsfrage setzt die Ergebnisse der Analyse in den Kontext des Akkulturationsmodells nach Esser und zieht Schlussfolgerungen. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Akkulturation, Integration, syrisch-muslimische Geflüchtete, religiöse Wertvorstellungen, Akkulturationsmodell nach Esser, Experteninterviews, Inhaltsanalyse, Herausforderungen, Chancen, Segmentation, Assimilation, Mehrfach-Integration
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Akkulturationsmodell nach Hartmut Esser?
Ein soziologisches Modell, das Integrationsprozesse in Dimensionen wie kognitive, strukturelle, soziale und identifikative Integration unterteilt.
Welchen Einfluss haben religiöse Werte auf die Integration?
Die Studie zeigt, dass religiöse Wertvorstellungen bei syrisch-muslimischen Geflüchteten sowohl eine Brücke als auch eine Hürde im Akkulturationsprozess sein können.
Was versteht man unter „Mehrfach-Integration“?
Dies beschreibt den Zustand, in dem sich Individuen sowohl in die Aufnahmegesellschaft integrieren als auch starke Bindungen zu ihrer Herkunftskultur bewahren.
Wie wurden die Daten für diese Bachelorarbeit erhoben?
Es wurden Experteninterviews mit Personen durchgeführt, die seit 2015 beruflich in direktem Kontakt mit syrischen Geflüchteten stehen.
Was ist das Ergebnis der Inhaltsanalyse nach Mayring?
Die Analyse identifizierte sechs Kategorien von Herausforderungen und Chancen, die von staatlichen Rahmenbedingungen bis hin zu individuellen Wertvorstellungen reichen.
- Citar trabajo
- Katherina Nati (Autor), 2020, Akkulturationsprozesse bei syrisch-muslimischen Geflüchteten. Herausforderungen im Kontext des gesellschaftlichen Eingliederungsprozesses, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1174189