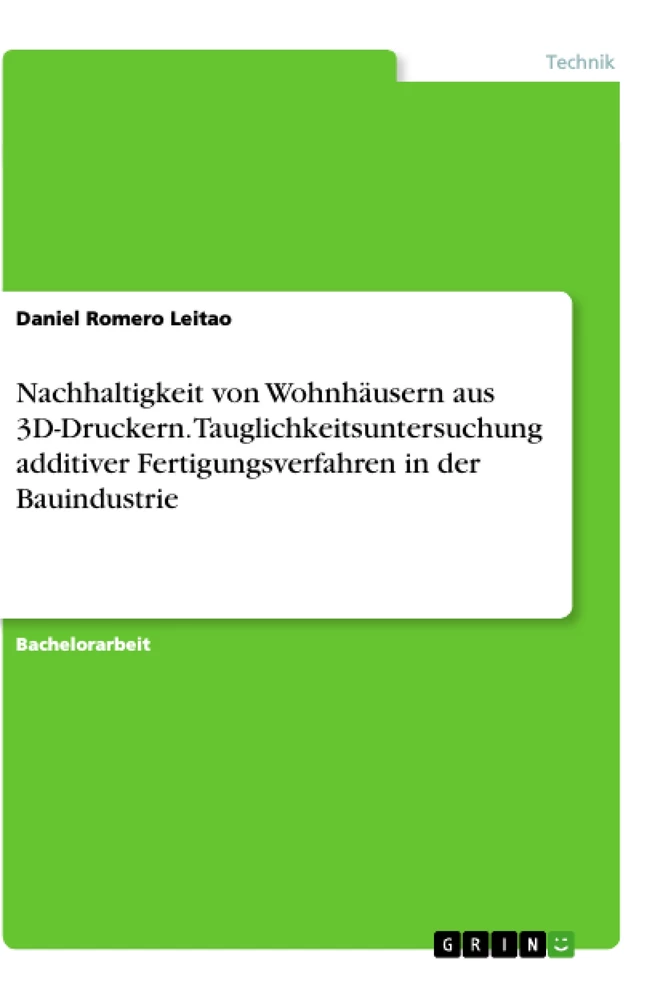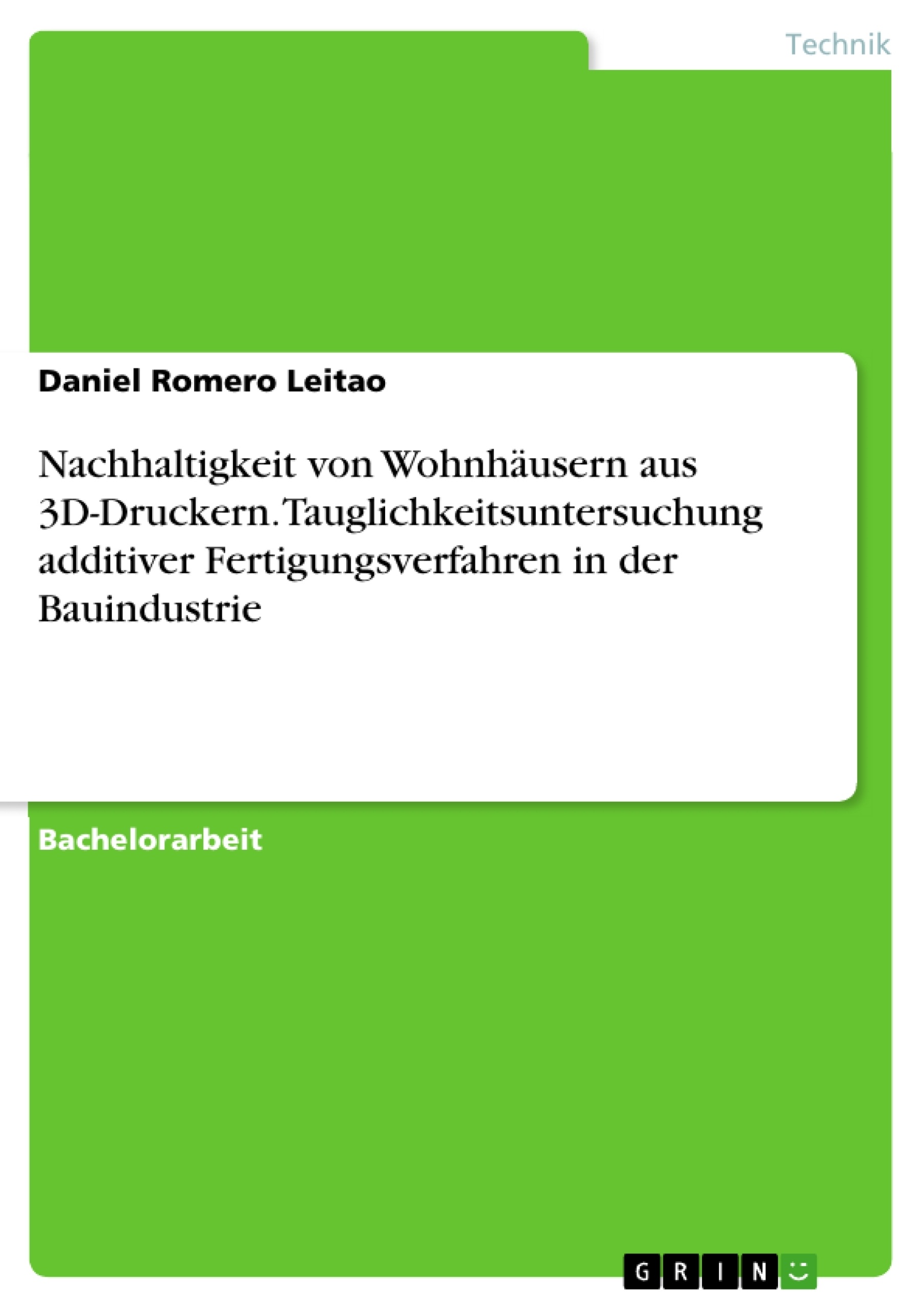Das Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Funktionsweise von additiven Fertigungsverfahren in der Bauindustrie vorzustellen und ihre möglichen Potenziale zu analysieren. Dazu wird zunächst der aktuelle Forschungsstand von additiven Fertigungsverfahren beschrieben. Hierfür wird auf die geschichtliche Entwicklung des 3D-Druckens im Allgemeinen eingegangen und welche Stellung diese gegenwärtig in der Industrie einnimmt. Es folgt eine anschließende Übersicht der etabliertesten Fertigungsverfahren mit einer kurzen Erläuterung der Funktionsweise.
Der nächste Teil behandelt die im Bauwesen eingesetzten additiven Fertigungsverfahren und klassifiziert diese nach ihrer Verfahrensweise und ihrem Aufbau. Zusätzlich werden in diesem Kapitel namhafte Hersteller von 3D-Druckern, samt ihrer bisherigen Pilotprojekte vorgestellt. Im nächsten Kapitel wird näher auf die Materialien eingegangen, die beim Druckprozess zum Einsatz kommen und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Auch wird in diesem Kapitel das Schwinden und mögliche Rissbildung von 3D-gedruckten Bauteilen behandelt. Abschließend werden noch Themen wie die Integrierung einer Bewehrung und Forschungsergebnisse zu alternativen Baustoffen aufgeführt.
Zudem wird auf das Thema Software eingegangen. Hier werden die technischen Schritte analysiert, welche notwendig sind, um ein Gebäude drucken zu können. Auch wird auf neue Möglichkeiten eingegangen, welche Bauteile in Hinblick ihrer Eigenschaften optimieren könnten. Im Anschluss wird die Nachhaltigkeit von additiven Fertigungsverfahren analysiert. Dafür wird zunächst der Begriff der Nachhaltigkeit definiert, bevor auf mögliche Auswirkungen dieser Technologie eingegangen wird. Das nächste Kapitel betrachtet die Wirtschaftlichkeit von 3D-gedruckten Gebäuden. Mit Hilfe eines Rechenbeispiels werden Baukosten und Ausführungszeiten der unterschiedlichen 3D-Drucker berechnet und diese im Anschluss dem klassischen Mauerwerksbau gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation und Relevanz
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Methodik
- 1.4 Aufbau der Bachelorarbeit
- 2 Stand der Forschung
- 2.1 Die geschichtliche Entwicklung des 3D‐Druckens
- 2.2 Anwendung und Potenziale
- 2.3 Architektur und Bauindustrie
- 2.4 Klassifizierung additiver Fertigungsverfahren
- 2.5 Verfahrensübersicht (in Anlehnung an VDI 3405)
- 2.5.1 3‐D‐Drucken (3DP)
- 2.5.2 Digital Light Processing (DLP)
- 2.5.3 Elektronen‐Strahlschmelzen, Electron Beam Melting (EBM)
- 2.5.4 Film Transfer Imaging (FTI)
- 2.5.5 Fused Layer Modeling/Fused Deposition Modeling (FDM)
- 2.5.6 Laminated Object Modeling/Layer Laminated Manufacturing (LLM)
- 2.5.7 Poly‐Jet Modelling (PJM)
- 2.5.8 Scan‐LED‐Technologie (SLT)
- 2.5.9 Selektives Laser Sintern/Selective Laser Sintering (SLS)
- 2.5.10 Selektives Laserstrahlenschmelzen/Selective Laser Melting (SLM)
- 2.5.11 Stereolithografie/Stereolithography (SL)
- 3 Additive Fertigungsverfahren im Bauwesen
- 3.1 Klassifizierung additiver Fertigungsverfahren im Betonbau nach Verfahren
- 3.1.1 Selektives Binden
- 3.1.2 Extrusionsverfahren
- 3.1.3 Spritzbetonverfahren
- 3.1.4 Gleitschalungsverfahren
- 3.2 Aufteilung der 3D‐Drucker nach Typen
- 3.2.1 Portalsystem
- 3.2.2 Gelenkarmroboter
- 3.2.3 Delta System
- 3.2.4 Autobetonpumpen mit Verteilermast
- 3.3 Klassifizierung additiver Fertigungsverfahren im Bauwesen nach Typen
- 3.4 Hersteller von 3D Betondruckern + Pilotprojekte
- 3.4.1 Apis Cor
- 3.4.2 ICON Vulcan II
- 3.4.3 BOD 2
- 3.4.4 Big Delta WASP
- 3.4.5 CONPrint 3D
- 3.5 Etablierung von additiven Fertigungsverfahren seit Entdeckung
- 3.5.1 Projekte die mit 3D‐Betondruck umgesetzt wurden
- 4 Materialauswahl für additive Fertigung in der Bauindustrie
- 4.1 Zementbasierte Materialien
- 4.2 Anforderungen an Frischbeton
- 4.3 Anforderungen an Festbeton
- 4.4 Machbarkeitsuntersuchung der TU Dresden
- 4.4.1 Bewertungsparameter
- 4.4.2 Zement
- 4.4.3 Zusatzstoffe
- 4.4.4 Gesteinskörnung
- 4.4.5 Zusatzmittel
- 4.4.6 Bewehrung
- 4.4.7 Ergebnisse der Druck‐ und Biegezugfestigkeitsversuche
- 4.4.8 Pumptechnik für 3D druckbaren Beton
- 4.4.9 Doppelkolbenpumpe
- 4.4.10 Rotorpumpe
- 4.5 Schwinden und Rissbildung
- 4.6 Bewehrung der gedruckten Bauteile
- 4.7 Alternative Baustoffe
- 4.7.1 Geopolymere
- 4.7.2 Holzleichtbeton
- 5 Software von 3D Betondruckern
- 5.1 Datenstrukturen und Datenmanagement
- 5.2 Erzeugung des digitalen 3‐D‐Modells
- 5.3 Überführung der CAD‐Datei in neutrales Format
- 5.4 Slicen
- 5.5 Exportieren in G‐Code
- 5.6 Eine Datei auf Druckbarkeit prüfen
- 5.7 Topologieoptimierung
- 6 Nachhaltiges Bauen mit additiver Fertigung
- 6.1 Begriffsdefinition
- 6.2 Drei‐Säulen‐Modell
- 6.3 Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit
- 6.4 Einfluss von additiven Fertigungsverfahren in der Bauindustrie
- 6.4.1 Ökologische und ökonomische Auswirkungen
- 6.4.2 Soziale Auswirkungen
- 6.5 Zwischen Fazit
- 7 Kostenvergleich 3D Betondruck
- 7.1 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- 7.2 Vorgehensweise
- 7.3 Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizient beider Bauweisen
- 7.4 Berechnung Gerätekosten nach BGL für 3D‐Drucker
- 7.5 Berechnung Baukosten und Zeitaufwand additive Fertigung
- 7.6 Vergleich zwischen den Drucktypen
- 7.7 Berechnung Baukosten und Zeitaufwand konventionelle Bauweise
- 7.8 Bewertung traditioneller Massivbau
- 7.9 Vergleich zwischen 3D‐Druckverfahren und traditionellen Massivbau
- 7.10 Kritische Betrachtung
- 8 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Tauglichkeit additiver Fertigungsverfahren, insbesondere den 3D-Betondruck, im Wohnungsbau. Ziel ist es, verschiedene Verfahren vorzustellen, ihre Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum traditionellen Mauerwerksbau zu analysieren und ihre Auswirkungen auf Nachhaltigkeit zu bewerten.
- Wirtschaftlichkeitsvergleich verschiedener 3D-Druckverfahren und traditioneller Bauweisen
- Analyse der verschiedenen additiven Fertigungsverfahren im Betonbau
- Bewertung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit des 3D-Betondrucks
- Untersuchung geeigneter Materialien und Software für den 3D-Betondruck
- Auswirkungen auf die Bauindustrie und das Handwerk
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein, indem es die Ausgangssituation des deutschen Wohnungsmarktes mit steigenden Mietpreisen und Fachkräftemangel beschreibt. Es wird die Relevanz additiver Fertigungsverfahren als mögliche Lösung für diese Probleme hervorgehoben und die Zielsetzung sowie Methodik der Arbeit dargelegt. Der Aufbau der Bachelorarbeit wird abschließend skizziert.
2 Stand der Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema 3D-Druck. Es beschreibt die historische Entwicklung, die Anwendungsmöglichkeiten und Potenziale der Technologie in verschiedenen Industriezweigen, mit einem Schwerpunkt auf Architektur und Bauindustrie. Verschiedene additive Fertigungsverfahren werden klassifiziert und detailliert erläutert.
3 Additive Fertigungsverfahren im Bauwesen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung additiver Fertigungsverfahren im Bauwesen, insbesondere im Betonbau. Es klassifiziert die Verfahren nach verschiedenen Kriterien (Verfahren, Typ) und stellt namhafte Hersteller von 3D-Betondruckern und ihre Pilotprojekte vor. Die Entwicklung und Verbreitung dieser Technologie in der Bauindustrie wird ebenfalls diskutiert.
4 Materialauswahl für additive Fertigung in der Bauindustrie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Materialauswahl für den 3D-Betondruck. Es erläutert die Anforderungen an Frisch- und Festbeton und beschreibt detailliert eine Machbarkeitsstudie der TU Dresden, die verschiedene Zementtypen, Zusatzstoffe, Gesteinskörnungen und Bewehrungsarten untersucht. Schließlich werden alternative Baustoffe wie Geopolymere und Holzleichtbeton betrachtet.
5 Software von 3D Betondruckern: Dieses Kapitel beschreibt den Software-Aspekt des 3D-Betondrucks. Es erklärt die notwendigen Schritte von der Datenstruktur und dem Datenmanagement über die Erzeugung des 3D-Modells und die Überführung in ein neutrales Format (STL) bis zum Slicen und der Generierung von G-Code. Die Prüfung der Druckbarkeit und die Möglichkeiten der Topologieoptimierung werden ebenfalls behandelt.
6 Nachhaltiges Bauen mit additiver Fertigung: Dieses Kapitel analysiert die Nachhaltigkeit von additiven Fertigungsverfahren im Bauwesen. Es definiert den Begriff „Nachhaltigkeit“, erläutert das Drei-Säulen-Modell und bewertet die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen des 3D-Betondrucks. Ein Zwischenfazit fasst die Potenziale und Herausforderungen dieser Technologie zusammen.
7 Kostenvergleich 3D Betondruck: Dieses Kapitel präsentiert einen detaillierten Kostenvergleich zwischen 3D-Betondruck und traditionellem Mauerwerksbau anhand eines konkreten Beispiels. Es werden die Baukosten (Lohn-, Geräte-, Materialkosten) und der Zeitaufwand für verschiedene 3D-Druckertypen berechnet und mit den entsprechenden Werten des konventionellen Baus verglichen. Eine kritische Betrachtung der Ergebnisse und der zugrundeliegenden Annahmen rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
3D-Betondruck, additive Fertigung, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bauindustrie, Materialauswahl, Software, Topologieoptimierung, Kostenvergleich, Mauerwerksbau, Ökologie, Ökonomie, Soziales, Pilotprojekte, Fachkräftemangel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Additiver Fertigungsverfahren im Wohnungsbau
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Eignung additiver Fertigungsverfahren, insbesondere den 3D-Betondruck, für den Wohnungsbau. Es wird ein Vergleich mit traditionellen Bauweisen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit durchgeführt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert verschiedene 3D-Druckverfahren im Betonbau, bewertet deren Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum konventionellen Mauerwerksbau und untersucht die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen des 3D-Betondrucks. Zusätzlich werden geeignete Materialien und Software für den 3D-Betondruck untersucht.
Welche additiven Fertigungsverfahren werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt eine Vielzahl additiver Fertigungsverfahren, darunter 3DP, DLP, EBM, FTI, FDM, LLM, PJM, SLT, SLS, SLM und Stereolithografie. Im Kontext des Bauwesens werden Verfahren wie selektives Binden, Extrusionsverfahren, Spritzbetonverfahren und Gleitschalungsverfahren klassifiziert und im Detail betrachtet.
Welche Hersteller von 3D-Betondruckern werden genannt?
Die Arbeit nennt mehrere Hersteller von 3D-Betondruckern und deren Pilotprojekte, darunter Apis Cor, ICON (Vulcan II), BOD 2, Big Delta WASP und CONPrint 3D.
Welche Materialien werden für den 3D-Betondruck untersucht?
Die Arbeit untersucht zementbasierte Materialien, wobei die Anforderungen an Frisch- und Festbeton detailliert beschrieben werden. Eine Machbarkeitsstudie der TU Dresden zu verschiedenen Zementtypen, Zusatzstoffen, Gesteinskörnungen, Zusatzmitteln und Bewehrungsarten wird vorgestellt. Alternative Baustoffe wie Geopolymere und Holzleichtbeton werden ebenfalls betrachtet.
Welche Softwareaspekte werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt den Softwareprozess vom Datenmanagement über die Erstellung des 3D-Modells (CAD), die Konvertierung in ein neutrales Format (STL), das Slicen und die Generierung von G-Code bis hin zur Druckbarkeitsprüfung und Topologieoptimierung.
Wie wird die Nachhaltigkeit des 3D-Betondrucks bewertet?
Die Nachhaltigkeit wird anhand des Drei-Säulen-Modells (ökologisch, ökonomisch, sozial) bewertet. Die Arbeit analysiert die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen des 3D-Betondrucks auf die Umwelt und die Wirtschaft sowie die sozialen Auswirkungen auf die Bauindustrie und das Handwerk.
Wie wird der Kostenvergleich durchgeführt?
Der Kostenvergleich zwischen 3D-Betondruck und traditionellem Mauerwerksbau erfolgt anhand eines konkreten Beispiels. Es werden die Baukosten (Lohn-, Geräte-, Materialkosten) und der Zeitaufwand für verschiedene 3D-Druckertypen berechnet und mit den Werten des konventionellen Baus verglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: 3D-Betondruck, additive Fertigung, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bauindustrie, Materialauswahl, Software, Topologieoptimierung, Kostenvergleich, Mauerwerksbau, Ökologie, Ökonomie, Soziales, Pilotprojekte, Fachkräftemangel.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Stand der Forschung, Additive Fertigungsverfahren im Bauwesen, Materialauswahl, Software, Nachhaltiges Bauen, Kostenvergleich und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Daniel Romero Leitao (Autor:in), 2021, Nachhaltigkeit von Wohnhäusern aus 3D-Druckern. Tauglichkeitsuntersuchung additiver Fertigungsverfahren in der Bauindustrie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163496