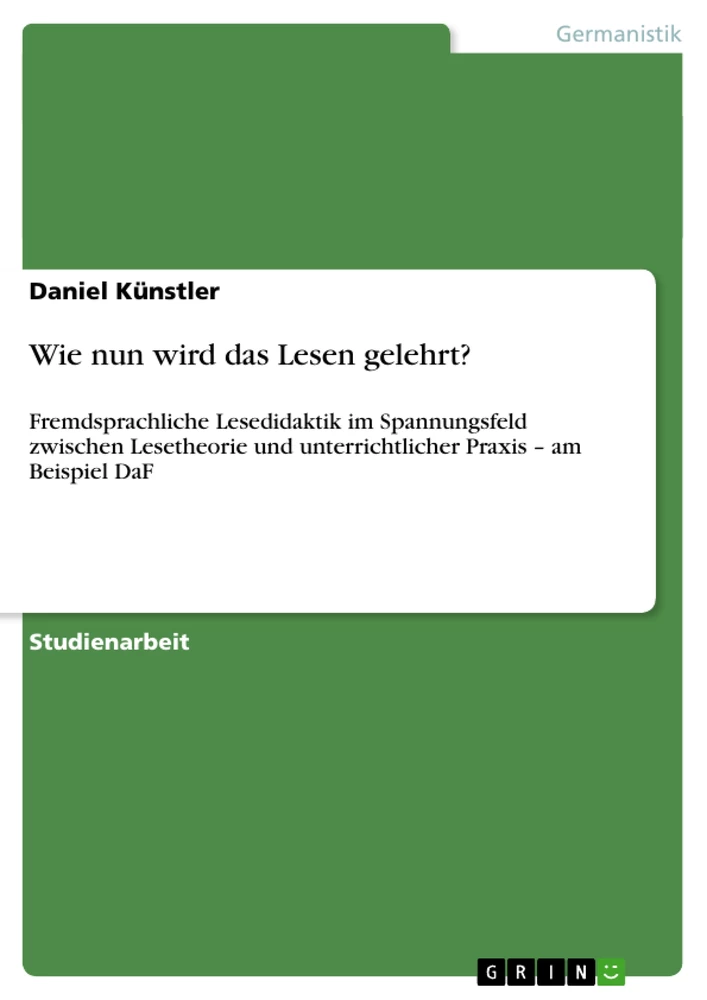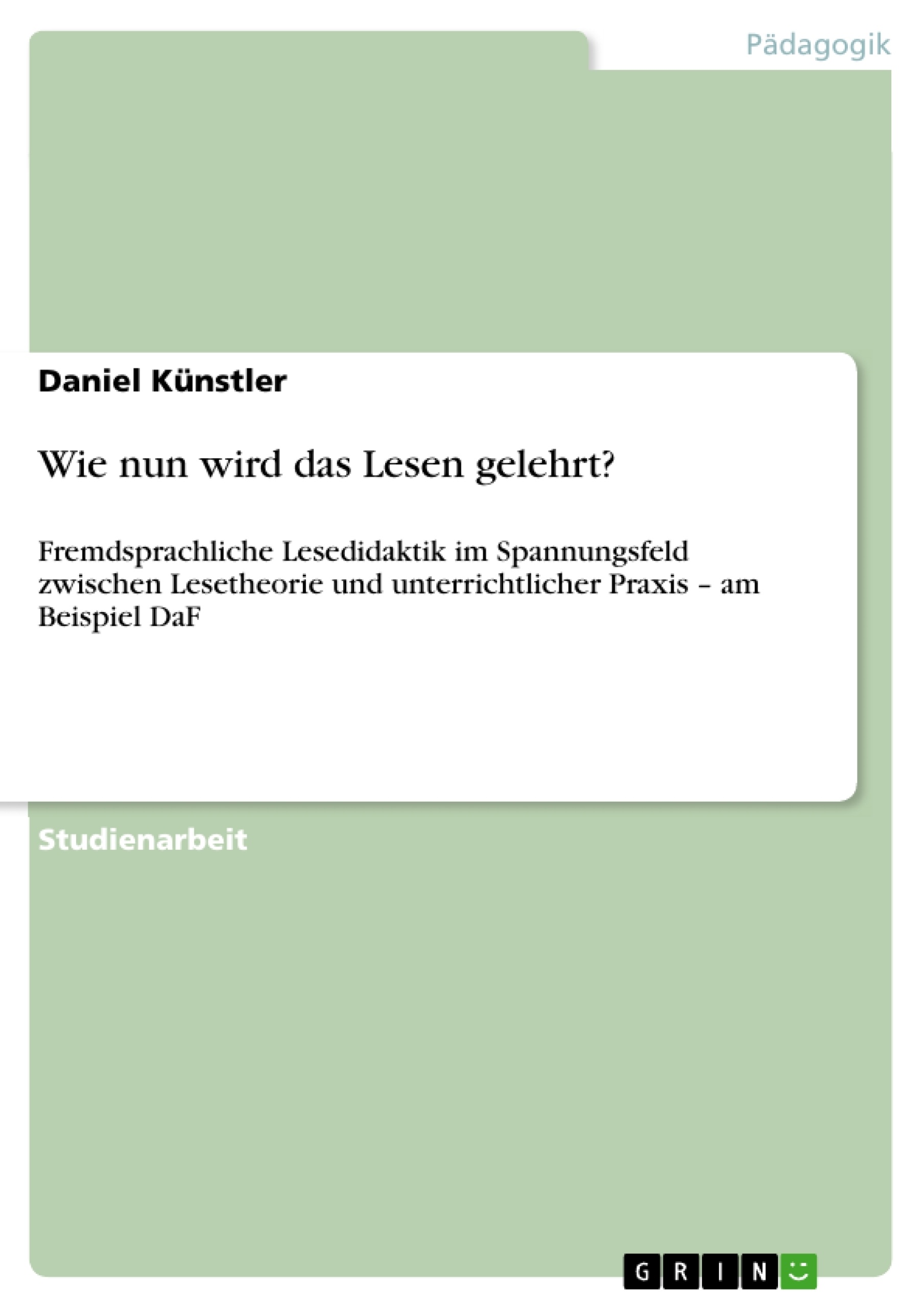In der vorliegenden Hausarbeit zum Seminar „Lesedidaktik“ sollen die folgenden Fragen erörtert werden: In wie weit zeigt sich die Lesedidaktik DaF durch die in der Leseforschung diskutierten lesetheoretischen Modelle zum muttersprachlichen Lesen beeinflusst und inwiefern erscheinen direkte lesedidaktische Ableitungen von spekulative Modellen des L1-Lesens für den L2-Leseunterricht überhaupt sinnvoll?
Es soll im ersten Teil anhand der Darstellung einiger gängiger theoretischer Lesemodelle gezeigt werden, dass die lesetheoretische Forschung beim Beschreiben des hochkomplexen Leseprozesses in der Muttersprache zu vielen verschiedenen und oft widersprüchlichen empirischen Ergebnissen und Konzeptualisierungen kommt, und diese daher als eher spekulativ angesehen werden können. Im zweiten Teil werden auf die „specifica differentia“ des fremdsprachlichen Lesens eingegangen. Danach im abschließenden dritten Teil soll aufgezeigt werden, dass zwischen den Modellen der Lesetheorie und den Anforderungen der Lesedidaktik DaF eine erhebliche Diskrepanz besteht. Die sich daraus ergebende Frage nach der Relevanz der Lesetheorie für die DaF-Lesedidaktik soll abschließend exemplarisch anhand eines Vergleichs zweier bekannter und einflussreicher Didaktisierungsversuche aus dem Bereich DaF von Gerard Westhoff und Madline Lutjeharms diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lesetheorie
- Leseprozessmodelle
- Bottom-up-Modell
- Top-down-Modell
- Interaktive Modelle
- Modulares vs. konnektionistisches Modell
- Lesen in der Fremdsprache
- Unterschiede im Forschungsstand L1 und L2
- Der fremdsprachige Leser
- Zwei Hypothesen über den L2-Leser
- Sprachliche Schwellenhypothese
- Sprachliche Interdependenzhypothese
- Eigendynamik des fremdsprachlichen Lesens
- Diskrepanz zwischen Leseforschung und Lesedidaktik
- Lesedidaktische Relevanz der Lesetheorie
- Zwei unterschiedliche lesedidaktische Ansätze? - Gerard Westhoff vs. Madeline Lutjeharms
- Schlussbetrachtung
- Analyse gängiger Leseprozessmodelle (Bottom-up, Top-down, interaktive Modelle)
- Unterschiede im fremdsprachigen Lesen im Vergleich zum muttersprachlichen Lesen
- Die Diskrepanz zwischen theoretischen Modellen und didaktischer Umsetzung im DaF-Unterricht
- Vergleich verschiedener didaktischer Ansätze im DaF-Unterricht
- Die Relevanz der Lesetheorie für die DaF-Lesedidaktik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss lesetheoretischer Modelle des muttersprachlichen Lesens auf die Lesedidaktik im DaF-Unterricht. Sie hinterfragt die Sinnhaftigkeit direkter Übertragung von L1-Modellen auf den L2-Kontext. Die Arbeit analysiert gängige Leseprozessmodelle, beleuchtet die spezifischen Herausforderungen des fremdsprachigen Lesens und untersucht die Diskrepanz zwischen Leseforschung und didaktischer Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss lesetheoretischer Modelle auf die DaF-Lesedidaktik und die Sinnhaftigkeit direkter Übertragungen von L1- auf L2-Kontexte. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: Die Darstellung gängiger Lesemodelle, die Betrachtung spezifischer Aspekte des fremdsprachigen Lesens und die Analyse der Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis im DaF-Unterricht, exemplarisch anhand eines Vergleichs zweier didaktischer Ansätze.
Lesetheorie: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Lesetheorie, beginnend mit den psychologischen Grundlagen des 19. Jahrhunderts bis zur kognitiven Wende in den 1970er Jahren. Es betont die Komplexität des Leseprozesses und die Vielzahl widersprüchlicher empirischer Ergebnisse, was dazu führt, dass viele Modelle als spekulativ einzustufen sind. Der Fokus liegt auf der interdisziplinären Natur der Leseforschung und der Schwierigkeit, ein singuläres Modell für den komplexen Lesevorgang zu entwickeln. Die Zitate von Gibson und Levin (1976) unterstreichen die Vielfalt von Leseprozessen abhängig von Leser, Text, Leseziel und Situation.
Lesen in der Fremdsprache: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Besonderheiten des fremdsprachigen Lesens und unterscheidet es vom muttersprachlichen Lesen. Es werden zwei Hypothesen zum fremdsprachigen Leser (Sprachliche Schwellenhypothese und Sprachliche Interdependenzhypothese) vorgestellt und die "Eigendynamik" des fremdsprachigen Lesens diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen, die sich aus den sprachlichen Unterschieden ergeben und wie diese den Leseprozess beeinflussen.
Diskrepanz zwischen Leseforschung und Lesedidaktik: Dieser Abschnitt analysiert die Kluft zwischen den Erkenntnissen der Leseforschung und ihrer Umsetzung in der Lesedidaktik des DaF-Unterrichts. Er beleuchtet die lesedidaktische Relevanz der Lesetheorie und vergleicht exemplarisch zwei unterschiedliche didaktische Ansätze (Gerard Westhoff und Madeline Lutjeharms), um die Herausforderungen der Anwendung theoretischer Modelle in der Praxis aufzuzeigen. Die Diskrepanz entsteht durch die Komplexität der Forschungsergebnisse und der Schwierigkeit, diese in handlungsorientierte didaktische Konzepte zu übersetzen.
Schlüsselwörter
Lesedidaktik DaF, Lesetheorie, Leseprozessmodelle, Bottom-up, Top-down, Fremdsprachenlernen, L1, L2, Sprachliche Schwellenhypothese, Sprachliche Interdependenzhypothese, kognitive Linguistik, Leseunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit über Lesetheorie und DaF-Lesedidaktik
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von lesetheoretischen Modellen des muttersprachlichen Lesens auf die Lesedidaktik im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Sie hinterfragt, ob Modelle aus der Muttersprache (L1) sinnvoll auf den Kontext der Fremdsprache (L2) übertragen werden können. Die Arbeit analysiert gängige Leseprozessmodelle, beleuchtet die Herausforderungen des fremdsprachigen Lesens und untersucht die Diskrepanz zwischen Leseforschung und didaktischer Praxis.
Welche Leseprozessmodelle werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Leseprozessmodelle, darunter Bottom-up-Modelle, Top-down-Modelle und interaktive Modelle. Sie betrachtet auch den Unterschied zwischen modularen und konnektionistischen Modellen.
Welche Unterschiede zwischen muttersprachlichem und fremdsprachigem Lesen werden behandelt?
Die Seminararbeit beleuchtet die Besonderheiten des fremdsprachigen Lesens im Vergleich zum muttersprachlichen Lesen. Zwei Hypothesen zum fremdsprachigen Leser werden vorgestellt: die Sprachliche Schwellenhypothese und die Sprachliche Interdependenzhypothese. Die "Eigendynamik" des fremdsprachigen Lesens, also die spezifischen Prozesse und Herausforderungen, die im L2-Kontext auftreten, wird ebenfalls diskutiert.
Wie wird die Diskrepanz zwischen Leseforschung und Lesedidaktik untersucht?
Die Arbeit analysiert die Kluft zwischen den Erkenntnissen der Leseforschung und ihrer Umsetzung in der DaF-Lesedidaktik. Die lesedidaktische Relevanz der Lesetheorie wird beleuchtet und exemplarisch werden zwei unterschiedliche didaktische Ansätze (Gerard Westhoff und Madeline Lutjeharms) verglichen, um die Schwierigkeiten der Anwendung theoretischer Modelle in der Praxis aufzuzeigen. Die Gründe für die Diskrepanz liegen in der Komplexität der Forschungsergebnisse und der Schwierigkeit, diese in handlungsorientierte didaktische Konzepte zu übersetzen.
Welche Schlüsselthemen werden in der Seminararbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind: Lesedidaktik DaF, Lesetheorie, Leseprozessmodelle (Bottom-up, Top-down, Interaktive), Fremdsprachenlernen (L1, L2), Sprachliche Schwellenhypothese, Sprachliche Interdependenzhypothese, kognitive Linguistik und Leseunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Lesetheorie (inkl. Leseprozessmodelle), Lesen in der Fremdsprache, Diskrepanz zwischen Leseforschung und Lesedidaktik und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Welche Forschungsfrage wird in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss lesetheoretischer Modelle auf die DaF-Lesedidaktik und die Sinnhaftigkeit direkter Übertragungen von L1- auf L2-Kontexte.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die Kernaussagen und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant zusammenfasst.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Implikationen für die DaF-Lesedidaktik. Sie beleuchtet die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung von Theorie und Praxis.
- Citation du texte
- Daniel Künstler (Auteur), 2008, Wie nun wird das Lesen gelehrt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116346