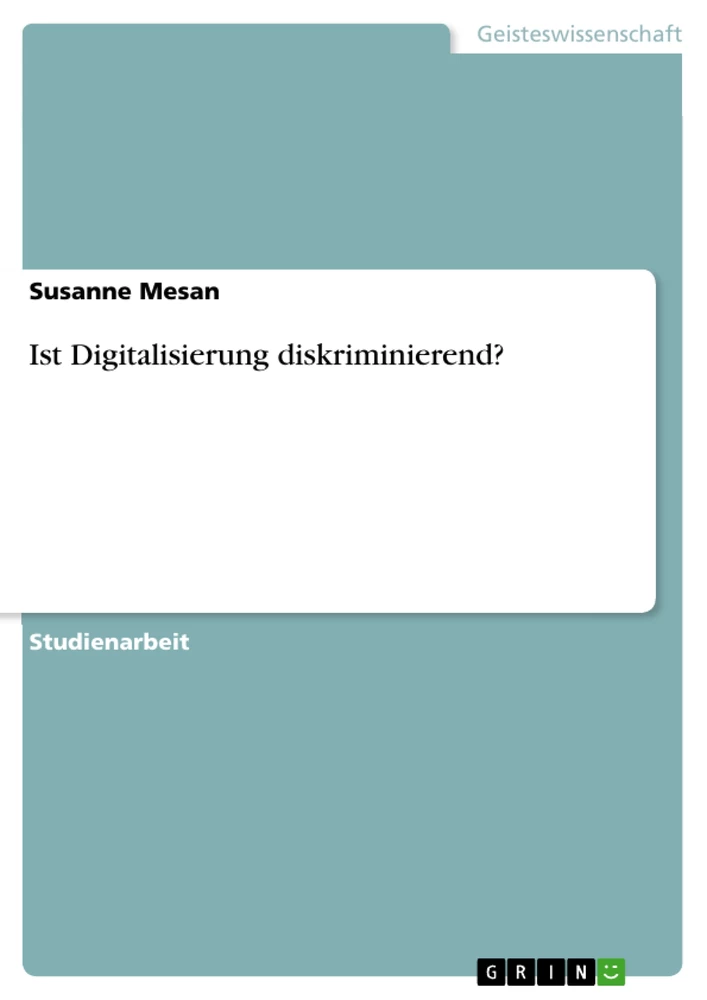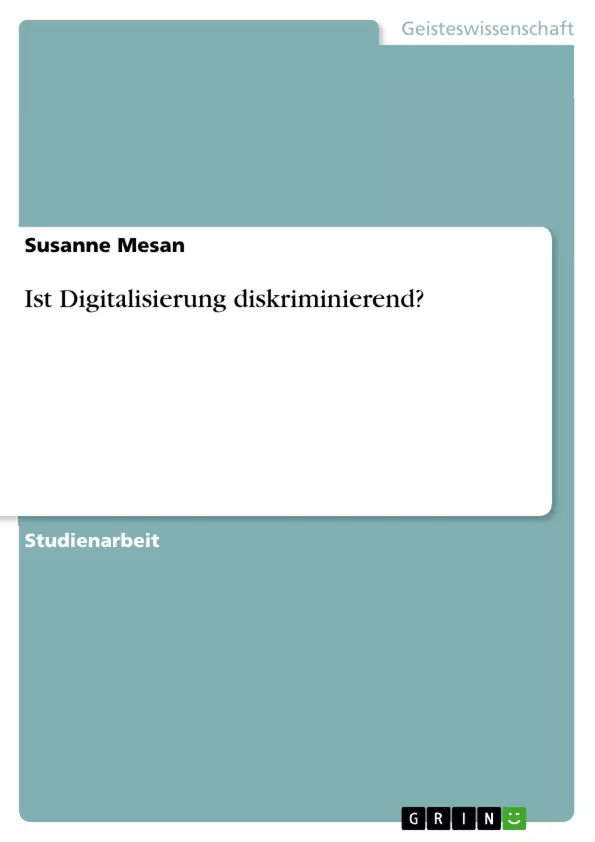Corona stellte die Gesellschaft unter ein Brennglas und zeigte unter anderem auf, dass die digitale Welt auch ausgrenzend sein kann. Diese Thematik wird in der folgenden Studienarbeit aufgegriffen. Untersuchungsgegenstand soll die Frage, ob die Digitalisierung diskriminierend ist, sein. Hierbei werden verschiedene Formen der Diskriminierung aufgegriffen und anhand von Beispielen die jeweils angeführten Hypothesen erläutert. Mittels anschließenden Interviews mit Expert*innen verschiedener Fachgebiete werden die aufgestellten Hypothesen überprüft. In einem abschließenden Fazit soll die Leitfrage nach den diskriminierenden Elementen der Digitalisierung beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinitionen
- 2.1 Digitalisierung
- 2.2 Diskriminierung
- 2.2.1 Rassismus
- 2.2.2 Ableismus
- 2.2.3 Klassismus
- 3 Methode der Studie
- 4 Hypothesenaufstellung
- 4.1 Je stärker die Digitalisierung voranschreitet, desto mehr wird Klassismus verstärkt
- 4.2 Wenn digitale Inventionen von weißen, in der westlichen Gesellschaft sozialisierten Menschen entwickelt werden, reproduzieren die Entwicklungen die in der dortigen Gesellschaft herrschenden Rassismen.
- 4.3 Wenn Menschen eine Behinderung haben, grenzt sie das aus der Digitalen Welt aus.
- 5 Fazit
- 5.1 Chancen und Vorteile
- 5.2 Wandel in der Branche
- 5.3 Schwierigkeiten
- 6 Schluss
- 7 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Frage, ob und inwiefern die Digitalisierung diskriminierend wirkt. Ziel ist es, verschiedene Formen der Diskriminierung im Kontext der Digitalisierung zu beleuchten und anhand von Beispielen und Experteninterviews die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen. Die Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis der Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit leisten.
- Die Auswirkungen der Digitalisierung auf bestehende soziale Ungleichheiten (Klassismus, Rassismus, Ableismus).
- Die Rolle von Technologieentwicklung und -design bei der Reproduktion von Diskriminierung.
- Die Analyse spezifischer Beispiele, wie digitale Technologien zu Ausgrenzung führen können.
- Die Erforschung von Möglichkeiten, die Digitalisierung inklusiver und gerechter zu gestalten.
- Die Bewertung von Chancen und Risiken der Digitalisierung in Bezug auf soziale Gerechtigkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Forschungsfrage, die sich mit der diskriminierenden Wirkung der Digitalisierung auseinandersetzt. Ausgehend von den Erfahrungen während der Corona-Pandemie, welche die sozialen Ungleichheiten im Umgang mit digitalen Technologien offenlegte (z.B. ungleicher Zugang zu Technologie und Online-Unterricht), wird der Forschungsansatz begründet. Die Arbeit skizziert die Methode der qualitativen Forschung mit Experteninterviews und kündigt die Struktur der Untersuchung an, die die Hypothesenbildung und -prüfung umfasst.
2 Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen zentraler Begriffe wie „Digitalisierung“ und „Diskriminierung“, wobei letztere in ihren verschiedenen Ausprägungen – Rassismus, Ableismus und Klassismus – erläutert wird. Die unterschiedlichen Verständnisweisen und die komplexe Natur dieser Konzepte werden herausgestellt, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Analyse zu schaffen. Es werden verschiedene Perspektiven und theoretische Ansätze präsentiert, um die Komplexität der Begriffe zu verdeutlichen und mögliche Missverständnisse zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Vielschichtigkeit der Diskriminierungsformen und ihrer Bedeutung im Kontext der Forschungsfrage.
3 Methode der Studie: Dieses Kapitel beschreibt die gewählte qualitative Forschungsmethode, die auf Experteninterviews basiert. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte gezielt nach dem Kriterium der theoretischen Sättigung, um eine reichhaltige Datenbasis für die Beantwortung der Forschungsfrage zu gewährleisten. Der Auswahlprozess der Proband*innen, die Durchführung und die Auswertung der Interviews werden detailliert dargestellt. Die Kapitel beschreibt die angewandten Methoden der Datenerhebung und -analyse.
Schlüsselwörter
Digitalisierung, Diskriminierung, Rassismus, Ableismus, Klassismus, soziale Ungleichheit, qualitative Forschung, Experteninterviews, inklusive Technologien, Barrierefreiheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Diskriminierung durch Digitalisierung
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht, ob und wie die Digitalisierung diskriminierend wirkt. Sie beleuchtet verschiedene Diskriminierungsformen (Rassismus, Ableismus, Klassismus) im Kontext der Digitalisierung und prüft dies anhand von Beispielen und Experteninterviews.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern wirkt die Digitalisierung diskriminierend? Die Studie untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf bestehende soziale Ungleichheiten und die Rolle von Technologieentwicklung und -design bei der Reproduktion von Diskriminierung.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf Experteninterviews basiert. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte gezielt nach dem Kriterium der theoretischen Sättigung. Die Durchführung und Auswertung der Interviews werden detailliert beschrieben.
Welche Hypothesen werden aufgestellt und geprüft?
Die Studie stellt drei Hypothesen auf: 1. Je stärker die Digitalisierung, desto mehr verstärkt sich Klassismus. 2. Von weißen, westlich sozialisierten Menschen entwickelte digitale Erfindungen reproduzieren den dortigen Rassismus. 3. Menschen mit Behinderungen werden durch die digitale Welt ausgegrenzt. Diese Hypothesen werden im Laufe der Studie anhand der erhobenen Daten geprüft.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Studie definiert zentrale Begriffe wie "Digitalisierung", "Diskriminierung", "Rassismus", "Ableismus" und "Klassismus". Die komplexen und vielschichtigen Aspekte dieser Begriffe werden erläutert, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinitionen, Methode der Studie, Hypothesenaufstellung, Fazit (mit Chancen, Wandel und Schwierigkeiten), Schluss und Quellenverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Digitalisierung, Diskriminierung, Rassismus, Ableismus, Klassismus, soziale Ungleichheit, qualitative Forschung, Experteninterviews, inklusive Technologien, Barrierefreiheit.
Was ist das Fazit der Studie?
Das Fazit der Studie fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit. Es beleuchtet den Wandel in der Branche und benennt Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit der Thematik auftreten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, die Auswirkungen der Digitalisierung auf verschiedene Diskriminierungsformen zu untersuchen und einen Beitrag zum Verständnis der Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit zu leisten.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist für alle relevant, die sich mit den sozialen Auswirkungen der Digitalisierung, Fragen der sozialen Gerechtigkeit und Diskriminierung auseinandersetzen. Dies beinhaltet Wissenschaftler, Praktiker, politische Entscheidungsträger und alle Interessierten an diesem Thema.
- Citar trabajo
- Susanne Mesan (Autor), 2021, Ist Digitalisierung diskriminierend?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159856