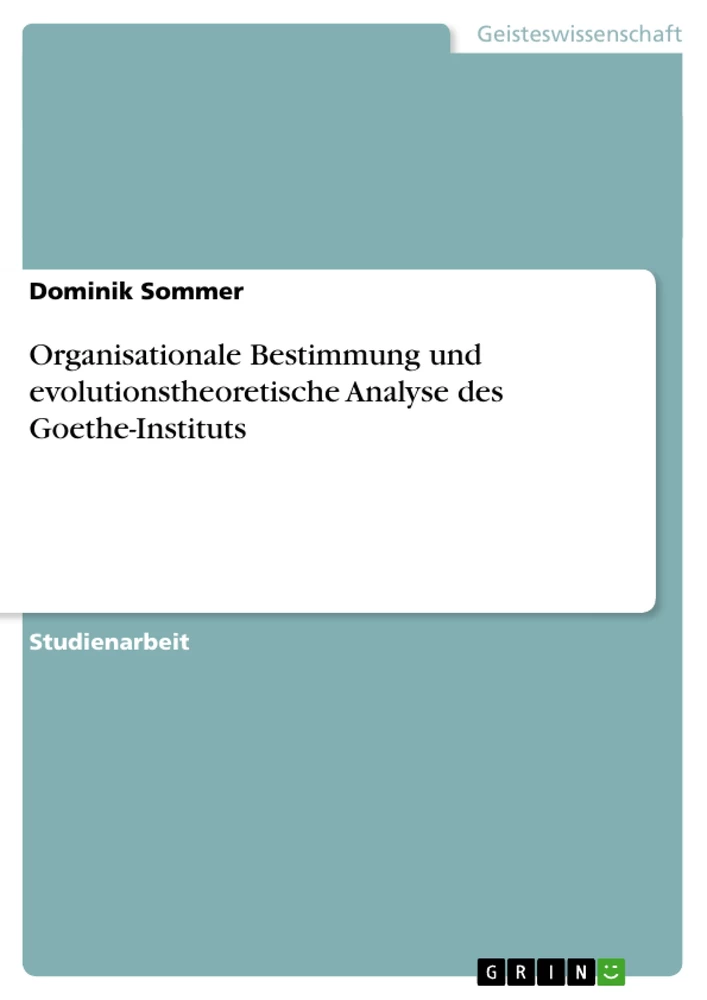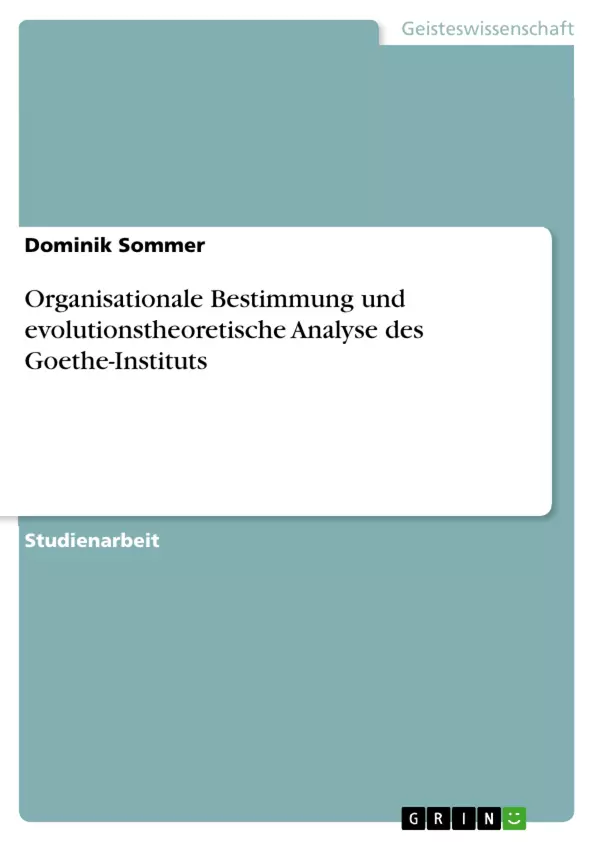Kurz nach seinem Amtsantritt unterrichtet Georg W.Bush die Welt relativ formlos darüber, dass die Geschäftsinteressen Amerikas Vorrang vor dem Umweltschutz haben und dass sich sein Land nicht an das Protokoll von Kyoto halten werde. Gesagt getan. Etwa zur gleichen Zeit kündigt er die einseitige Kündigung des ABM-Vertrags an. Der ABM-Vertrag steht Bush bei der Schaffung einer nationalen Raketenabwehr im Wege. Ein Jahr später wird der Vertrag dann tatsächlich gekündigt. Zusätzlich kreiert er, ebenfalls zum Beginn seiner Amtszeit, den Begriff der "Schurkenstaaten", den er zur Legitimation seines AMD-Programms braucht. Mit diesem semantischen Coup erschafft er die Bedrohung, die er als Legitimation für sein politisches Handeln braucht. So muss er auch die von Clinton und den koreanischen Staatsoberhäuptern begonnene Sonnenscheinpolitik abrupt beenden und kommt der von der Vorgängerregierung vereinbarten amerikanischen Kontrollfunktion bei nordkoreanischen Nuklearanlagen nicht mehr nach. Der Israelkonflikt eskaliert unter der Duldung der einzigen Großmacht USA.
Was sich bis hier hin anhört wie der Stoff für einen Politthriller, in dessen Plot nur noch der vor Action explodierende Höhepunkt fehlt, geht noch weiter.
Es kommt der 11. September. Der kriegerische Vergeltungsschlag gegen Afghanistan löst einen neuen Rüstungsschub in den Vereinigten Staaten aus. Am 29. Januar des zweiten Jahres seiner Präsidentschaft erklärt Bush die Staaten Iran, Irak und Nordkorea zur "Achse des Bösen"2. Der Einsatz von Atomwaffen in Angriffskriegen wird enttabuisiert. Es dominiert der Standpunkt in der Amerikanischen Regierung, dass militärische Macht den Primat haben muss und Krieg, im Zweifelsfall auch mit Atomwaffen, im 21.Jahrhundert ein selbstverständliches Mittel amerikanischer Außenpolitik bleibt.3
[...]
2 vgl. hierzu die Semantik Ronald Reagans, der 1980 die UdSSR als das "Reich des Bösen" bezeichnete.
3 Stand: 03/2002
Inhaltsverzeichnis
- X: Exkurs: Internationale Politik und das Goethe-Institut: Der Pluralismus und der Realismus als Strömungen in der aktuellen Außenpolitik der USA.
- A: Einleitung
- Thema, Erkenntnisinteresse und Methode
- B: Hauptteil
- I. Untersuchungsgegenstand: Goethe-Institut - seine organisationale Verortung
- 1. Einführender Abriss der Geschichte
- 1.1 Die Zeit vor 1951
- 1.2 Von den 50ern bis zur 68er Studentenrevolte
- 1.3 1968 und die Folgen
- 1.4 Nach der Öffnung Osteuropas
- 2. Verortung des Goethe-Instituts als Organisation
- 2.1 Ziel
- 2.2 Aufgaben
- 2.3 Struktur
- 2.4 Umwelt
- 2.5 Mitglieder
- 3. Durch die Umwelt gesetzte Rahmenbedingungen des Goethe-Instituts
- 3.1 Wirtschaft und Finanzen der BRD und finanzielle Zuwendungen an das Goethe-Institut
- 3.2 Politik
- 3.3 Der Kulturbegriff im gesellschaftlichen Diskurs
- 1. Einführender Abriss der Geschichte
- II. Evolutionstheoretischer Ansatz
- 1. Evolutionstheoretische Grundannahmen
- 2. Wandel, Menschenbild und Rationalität der Evolutionstheorie
- 3. Grundstruktur der synthetischen Evolutionstheorie
- 4. Konkretisierung des Population-Ecology-Ansatz von McKelvey
- III. Evolutionstheoretische Erklärungsversuche des Wandels des Goethe-Instituts in den 90er Jahren
- 1. Kulturbegriff und inhaltliche Veränderungen
- 2. Institutsnetz als Teil der organisationalen Struktur
- 3. Synthese des evolutionstheoretischen Teils
- I. Untersuchungsgegenstand: Goethe-Institut - seine organisationale Verortung
- C: Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den organisatorischen Wandel des Goethe-Instituts während der 1990er Jahre aus evolutionstheoretischer Perspektive. Ziel ist es, die Veränderungen des Instituts im Kontext seiner institutionellen Umgebung und seiner evolutionären Entwicklung zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet dabei die Rahmenbedingungen des Goethe-Instituts, seine Aufgaben und Ziele, sowie die relevanten theoretischen Ansätze der Evolutionstheorie.
- Die organisationale Verortung des Goethe-Instituts
- Die Veränderungen des Instituts im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
- Der Einfluss der Evolutionstheorie auf die Analyse des Wandels
- Die Anwendung des Population-Ecology-Ansatzes auf das Goethe-Institut
- Die Synthese der evolutionstheoretischen Analyse des Wandels des Goethe-Instituts
Zusammenfassung der Kapitel
- Exkurs: Internationale Politik und das Goethe-Institut: Der Pluralismus und der Realismus als Strömungen in der aktuellen Außenpolitik der USA: Dieser Exkurs analysiert die gegenwärtige amerikanische Außenpolitik und ordnet sie in die Theorien des Realismus und des Pluralismus ein. Er zeigt die Bedeutung dieser beiden Strömungen für das Verständnis des internationalen Geflechts, in dem das Goethe-Institut agiert.
- Einleitung: Hier wird das Thema, das Erkenntnisinteresse und die Methodik der Arbeit vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet den Wandel des Goethe-Instituts in den 1990er Jahren im Kontext der internationalen Politik und der evolutionstheoretischen Perspektive.
- Hauptteil I. Untersuchungsgegenstand: Goethe-Institut - seine organisationale Verortung: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Geschichte des Goethe-Instituts, seine Aufgaben und Ziele, sowie seine Struktur und seine Verortung in der politischen und gesellschaftlichen Umgebung. Er beleuchtet auch die Rahmenbedingungen des Instituts, wie z.B. die Finanzierung durch die Bundesrepublik Deutschland.
- Hauptteil II. Evolutionstheoretischer Ansatz: Dieser Teil der Arbeit stellt die Grundannahmen der Evolutionstheorie vor, besonders im Hinblick auf den Wandel, das Menschenbild und die Rationalität. Er erklärt die synthetische Evolutionstheorie und erläutert den Population-Ecology-Ansatz von McKelvey.
- Hauptteil III. Evolutionstheoretische Erklärungsversuche des Wandels des Goethe-Instituts in den 90er Jahren: Dieser Abschnitt analysiert die Veränderungen des Goethe-Instituts während der 1990er Jahre unter Anwendung der evolutionstheoretischen Ansätze, insbesondere des Kulturbegriffs und der Veränderungen im Institutsnetz.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen des organisatorischen Wandels, der Evolutionstheorie, der internationalen Politik und der Kulturvermittlung. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Goethe-Institut, organisationaler Wandel, Evolutionstheorie, Population-Ecology-Ansatz, Kulturbegriff, Realismus, Pluralismus, internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Analyse des Goethe-Instituts?
Die Arbeit untersucht den organisatorischen Wandel des Instituts in den 1990er Jahren aus einer evolutionstheoretischen Perspektive.
Was besagt der Population-Ecology-Ansatz?
Er ist ein Teil der Evolutionstheorie, der erklärt, wie sich Organisationen an ihre Umweltbedingungen anpassen oder durch diese selektiert werden.
Wie beeinflusst Politik das Goethe-Institut?
Die Arbeit beleuchtet die finanziellen Zuwendungen der BRD und den Einfluss internationaler Strömungen (Realismus/Pluralismus) auf die Kulturvermittlung.
Welche Rolle spielt der Kulturbegriff im Wandel?
Es wird analysiert, wie sich inhaltliche Veränderungen des Kulturbegriffs in den 90er Jahren auf die Struktur und das Netz des Instituts auswirkten.
Welche geschichtlichen Phasen werden betrachtet?
Die Zeit vor 1951, die 50er bis 68er Jahre, die Folgen der Studentenrevolte und die Phase nach der Öffnung Osteuropas.
- Quote paper
- Dominik Sommer (Author), 2002, Organisationale Bestimmung und evolutionstheoretische Analyse des Goethe-Instituts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10195