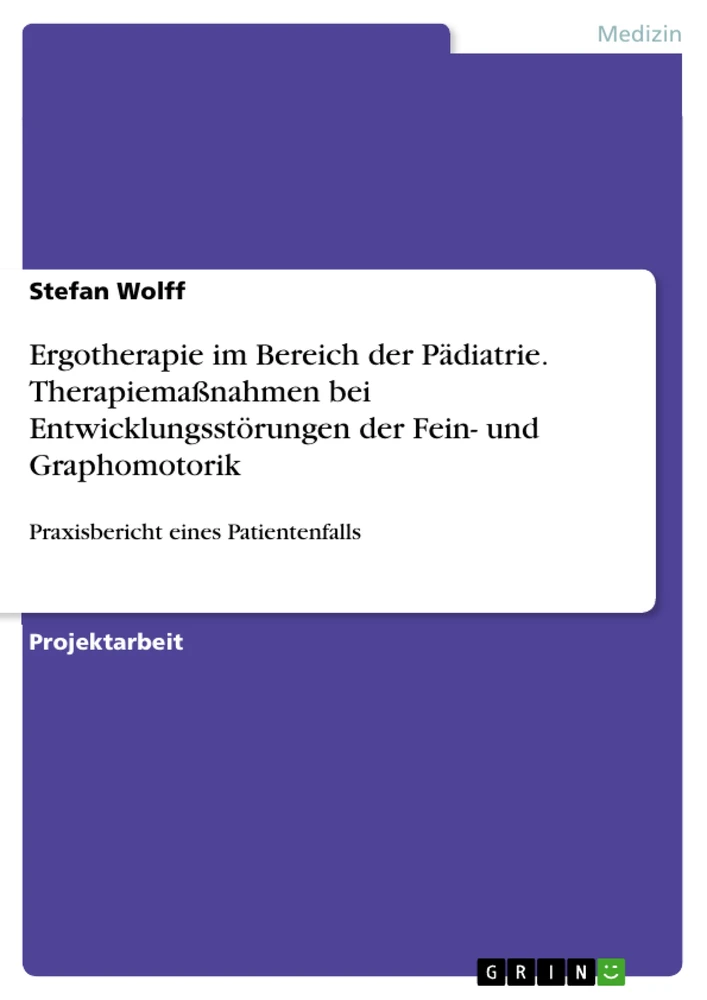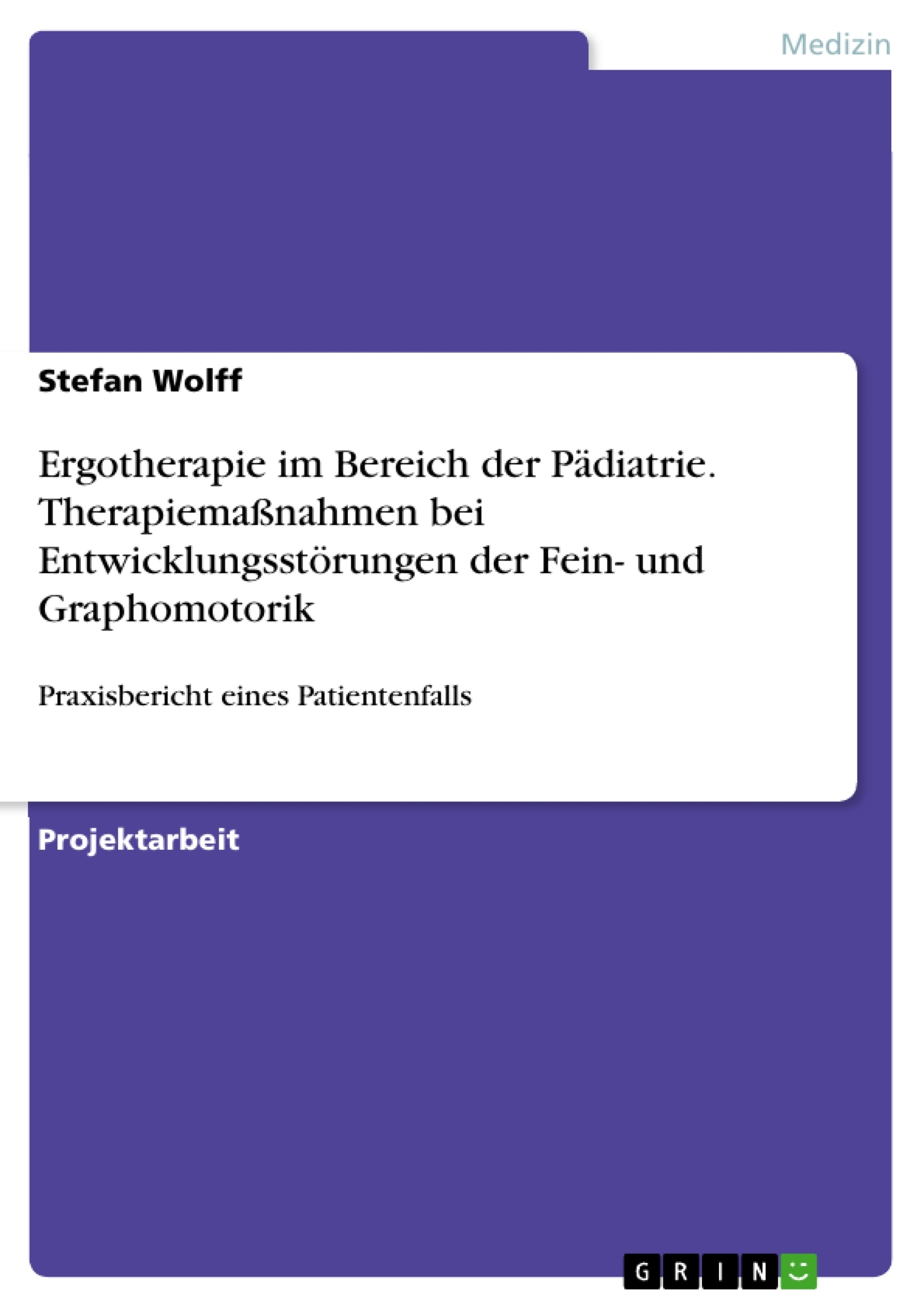Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Patientenfall, bei dem eine Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik vorliegt, und zeigt dabei die Herausforderungen, aber auch die Chancen, die eine Ergotherapie in so einem Fall bieten kann.
Die Ursachen für eine umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik sind weitestgehend unbekannt. Allerdings lässt sich festhalten, dass keine erkennbare Läsion des zentralen Nervensystems oder des peripheren Nervensystems vorliegt. Weitere mögliche Einflussfaktoren sind Störungen der Embryonalentwicklung im Mutterleib, Krankheiten der Mutter während der Schwangerschaft, Geburtskomplikationen oder Hirnerkrankungen in der Kindheit.
Ebenfalls kann die familiäre Komponente (sog. Mangel an motorischer Begabung) Einfluss auf das Krankheitsbild haben. Spezifische Störungen im Bereich der Perzeption, insbesondere einer Störung der Propriozeption (Tiefenwahrnehmung) aber auch eine Störung der taktilen Wahrnehmung über die Haut können Einfluss auf die Fein und Graphomotorik nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Beschreibung des Krankheitsbildes
- 1.1 Krankheitsbild
- 1.2 Definition „Störung der Fein- und Graphomotorik“
- 1.3 Ursachen
- 1.4 Risikofaktoren
- 1.5 Epidemiologie
- 1.6 Mögliche Symptome auf Ebene der Körperfunktionen (ICF)
- 1.7 Zu erwartende Auswirkungen der Erkrankung auf Ebene von Aktivitäten
- 1.8 Medizinische Diagnostik
- 1.9 Medizinische Maßnahmen
- 2. Daten des Klienten
- 3. Ergotherapeutischer Befund
- 3.1 Ersteindruck
- 3.2 Äußeres Erscheinungsbild
- 3.3 Personenbezogene Faktoren
- 3.4 Aktivitäten und Teilhabe
- 3.4.1 Lernen und Wissensanwendung
- 3.4.2 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
- 3.4.3 Kommunikation
- 3.4.4 Mobilität
- 3.4.5 Selbstversorgung
- 3.4.6 Häusliches Leben
- 3.4.7 Interaktion und Beziehung
- 3.4.8 Gemeinschaft und Freizeit
- 3.5 Körperfunktionen
- 3.5.1 Mentale Funktionen
- 3.5.2 Sinnesfunktion und Schmerz
- 3.5.3 Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen
- 3.6 Umweltfaktoren
- 3.6.1 Produkte und Technologien
- 3.6.2 Unterstützung und Beziehung
- 3.7 Evaluation des bisherigen Behandlungsverlaufes
- 4. Ergotherapeutische Problemstellung
- 5. Ergotherapeutische Zielsetzung
- 6. Planung der Sichtstunde
- 6.1 Zielsetzung für die Sichtstunde
- 6.2 Auswahl Aktivität / Betätigung und Art der ET-Intervention
- 6.3 Zeitliche Inhaltliche Planung / Therapeutisches Verhalten
- 6.4 Sozialform / Methode / Medium
- 6.5 Material / Werkzeug / Hilfsmittel
- 6.6 Arbeitsplatzgestaltung
- 7. Vorschläge für weiteres ergotherapeutisches Vorgehen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Praxisbericht beschreibt die ergotherapeutische Behandlung eines Kindes mit einer Störung der Fein- und Graphomotorik und einer emotionalen Störung. Ziel ist es, den ergotherapeutischen Befund, die Problemstellung, die Zielsetzung und die Planung einer Sichtstunde detailliert darzustellen und Vorschläge für das weitere Vorgehen zu formulieren. Der Bericht dient der Dokumentation und Reflexion des therapeutischen Prozesses.
- Störung der Fein- und Graphomotorik (F82.1G)
- Emotionale Störung mit sozialer und leistungsbezogener Unsicherheit (F93.9G)
- Ergotherapeutische Befunderhebung und -dokumentation
- Zielsetzung und Planung der Intervention
- Vorschläge für die weitere Therapie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Beschreibung des Krankheitsbildes: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Krankheitsbild der Störung der Fein- und Graphomotorik, inklusive Definition, Ursachen, Risikofaktoren und Epidemiologie. Es wird die ICD-10-Kodierung (F82.1G) erläutert und die verschiedenen Aspekte der Graphomotorik (Stifthaltung, Schreibfluss etc.) im Detail beleuchtet. Zusätzlich wird die Begleiterkrankung, eine emotionale Störung mit sozialer und leistungsbezogener Unsicherheit (F93.9G), kurz angerissen und deren Relevanz für die Therapie angesprochen. Die Ursachen werden als weitgehend unbekannt beschrieben, mögliche Einflussfaktoren wie pränatale Faktoren, Geburtskomplikationen und Bewegungsmangel werden jedoch diskutiert.
2. Daten des Klienten: Dieses Kapitel enthält die relevanten persönlichen Daten des Kindes, die für die ergotherapeutische Behandlung von Bedeutung sind. Aufgrund des Schutzes der Privatsphäre werden die Daten hier nicht weiter ausgeführt.
3. Ergotherapeutischer Befund: Hier wird der umfassende ergotherapeutische Befund des Kindes präsentiert. Der Ersteindruck, das äußere Erscheinungsbild und die personen-bezogenen Faktoren werden beschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Analyse der Aktivitäten und Teilhabe des Kindes in verschiedenen Lebensbereichen (Lernen, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung etc.). Die Untersuchung der Körperfunktionen (mentale Funktionen, Sinnesfunktionen, neuromuskuläre Funktionen) liefert wichtige Informationen über die Beeinträchtigungen des Kindes. Schließlich werden relevante Umweltfaktoren und die bisherigen Behandlungsverläufe evaluiert.
4. Ergotherapeutische Problemstellung: Basierend auf dem Befund werden in diesem Kapitel die zentralen ergotherapeutischen Probleme des Kindes prägnant und umfassend formuliert. Hier werden die relevanten Befundpunkte zusammengefasst, um eine klare und strukturierte Darstellung der Herausforderungen für die Therapie zu bieten.
5. Ergotherapeutische Zielsetzung: Dieses Kapitel legt die spezifischen, messbaren, erreichbaren, relevanten und zeitgebundenen (SMART) Ziele der ergotherapeutischen Intervention fest. Diese Ziele orientieren sich an den identifizierten Problemstellungen und zielen darauf ab, die Fähigkeiten und die Teilhabe des Kindes zu verbessern.
6. Planung der Sichtstunde: Die Planung der Sichtstunde wird detailliert beschrieben. Hier werden die Zielsetzung für die Sichtstunde, die gewählte Aktivität, die Art der Intervention, die zeitliche Planung, die Sozialform, die Methode, die verwendeten Materialien und die Arbeitsplatzgestaltung festgelegt. Die Planung orientiert sich an den übergeordneten Zielen der Therapie und zielt darauf ab, einen konkreten Einblick in den therapeutischen Prozess zu geben.
7. Vorschläge für weiteres ergotherapeutisches Vorgehen: Dieses Kapitel beinhaltet Vorschläge für die weitere ergotherapeutische Behandlung des Kindes. Es werden mögliche Therapieansätze, Übungen und Strategien diskutiert, um die zuvor definierten Ziele zu erreichen und den Fortschritt des Kindes nachhaltig zu unterstützen.
Schlüsselwörter
Feinmotorik, Graphomotorik, Entwicklungsstörung, Ergotherapie, Pädiatrie, ICF, emotionale Störung, soziale Unsicherheit, leistungsbezogene Unsicherheit, therapeutische Intervention, Befunddokumentation, Zielsetzung, Therapieplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Praxisbericht: Ergotherapeutische Behandlung eines Kindes mit Störung der Fein- und Graphomotorik
Was ist der Gegenstand dieses Praxisberichtes?
Der Praxisbericht dokumentiert die ergotherapeutische Behandlung eines Kindes mit einer Störung der Fein- und Graphomotorik (F82.1G) und einer emotionalen Störung (F93.9G). Er beschreibt detailliert den ergotherapeutischen Befund, die Problemstellung, die Zielsetzung und die Planung einer Sichtstunde. Zusätzlich werden Vorschläge für das weitere therapeutische Vorgehen formuliert.
Welche Kapitel umfasst der Bericht?
Der Bericht gliedert sich in sieben Kapitel: 1. Beschreibung des Krankheitsbildes, 2. Daten des Klienten, 3. Ergotherapeutischer Befund, 4. Ergotherapeutische Problemstellung, 5. Ergotherapeutische Zielsetzung, 6. Planung der Sichtstunde und 7. Vorschläge für weiteres ergotherapeutisches Vorgehen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Behandlung.
Was wird im Kapitel "Beschreibung des Krankheitsbildes" behandelt?
Dieses Kapitel definiert die Störung der Fein- und Graphomotorik (F82.1G), beschreibt Ursachen, Risikofaktoren und Epidemiologie. Es beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Graphomotorik (Stifthaltung, Schreibfluss etc.) und thematisiert die begleitende emotionale Störung (F93.9G) und deren Relevanz für die Therapie.
Welche Informationen enthält der ergotherapeutische Befund?
Der ergotherapeutische Befund (Kapitel 3) umfasst den Ersteindruck, das äußere Erscheinungsbild, personenbezogene Faktoren, eine detaillierte Analyse der Aktivitäten und Teilhabe des Kindes in verschiedenen Lebensbereichen (Lernen, Kommunikation, Mobilität etc.), die Untersuchung der Körperfunktionen (mentale Funktionen, Sinnesfunktionen, neuromuskuläre Funktionen) und relevante Umweltfaktoren. Der bisherige Behandlungsverlauf wird ebenfalls evaluiert.
Wie werden die ergotherapeutischen Probleme definiert?
In Kapitel 4 werden die zentralen ergotherapeutischen Probleme des Kindes basierend auf dem Befund prägnant und umfassend formuliert. Die relevanten Befundpunkte werden zusammengefasst, um eine klare Darstellung der Herausforderungen für die Therapie zu bieten.
Wie werden die Ziele der Therapie formuliert?
Kapitel 5 legt die spezifischen, messbaren, erreichbaren, relevanten und zeitgebundenen (SMART) Ziele der ergotherapeutischen Intervention fest. Diese Ziele orientieren sich an den identifizierten Problemstellungen und zielen auf die Verbesserung der Fähigkeiten und der Teilhabe des Kindes ab.
Wie wird die Sichtstunde geplant?
Kapitel 6 beschreibt detailliert die Planung der Sichtstunde: Zielsetzung, gewählte Aktivität, Art der Intervention, zeitliche Planung, Sozialform, Methode, Materialien und Arbeitsplatzgestaltung. Die Planung orientiert sich an den übergeordneten Therapiezielen.
Welche Vorschläge für das weitere Vorgehen werden gemacht?
Kapitel 7 beinhaltet Vorschläge für die weitere ergotherapeutische Behandlung des Kindes, einschließlich möglicher Therapieansätze, Übungen und Strategien zur Erreichung der definierten Ziele und zur nachhaltigen Unterstützung des Kindes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Bericht?
Schlüsselwörter sind: Feinmotorik, Graphomotorik, Entwicklungsstörung, Ergotherapie, Pädiatrie, ICF, emotionale Störung, soziale Unsicherheit, leistungsbezogene Unsicherheit, therapeutische Intervention, Befunddokumentation, Zielsetzung, Therapieplanung.
Welche Daten des Kindes werden im Bericht genannt?
Aufgrund des Schutzes der Privatsphäre werden die persönlichen Daten des Kindes nicht im Bericht ausgeführt.
- Quote paper
- Stefan Wolff (Author), 2020, Ergotherapie im Bereich der Pädiatrie. Therapiemaßnahmen bei Entwicklungsstörungen der Fein- und Graphomotorik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999903