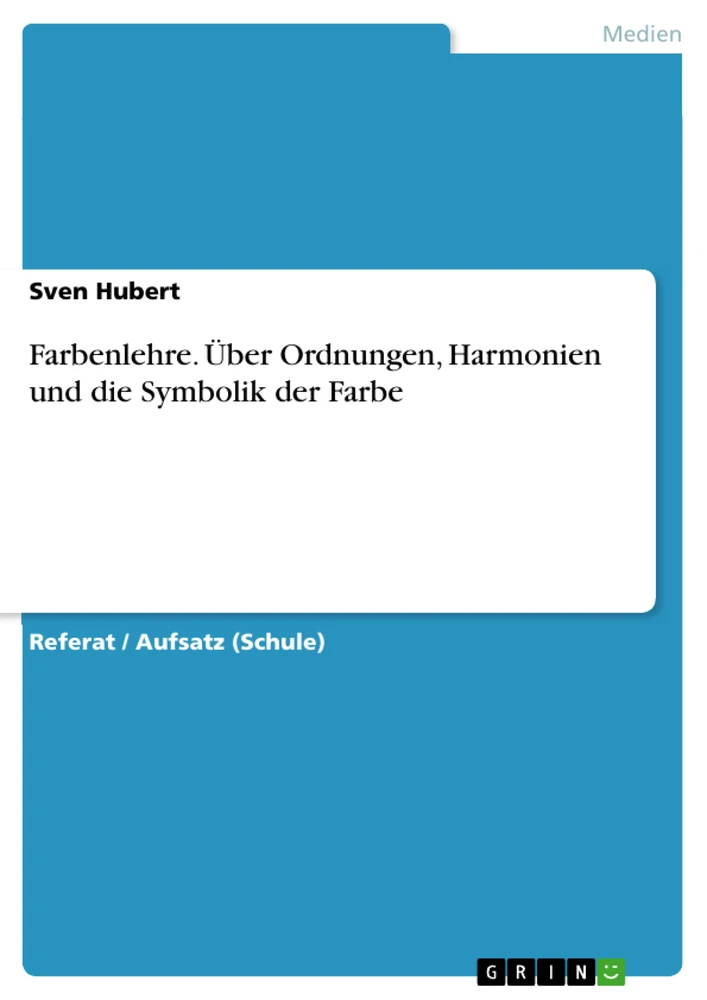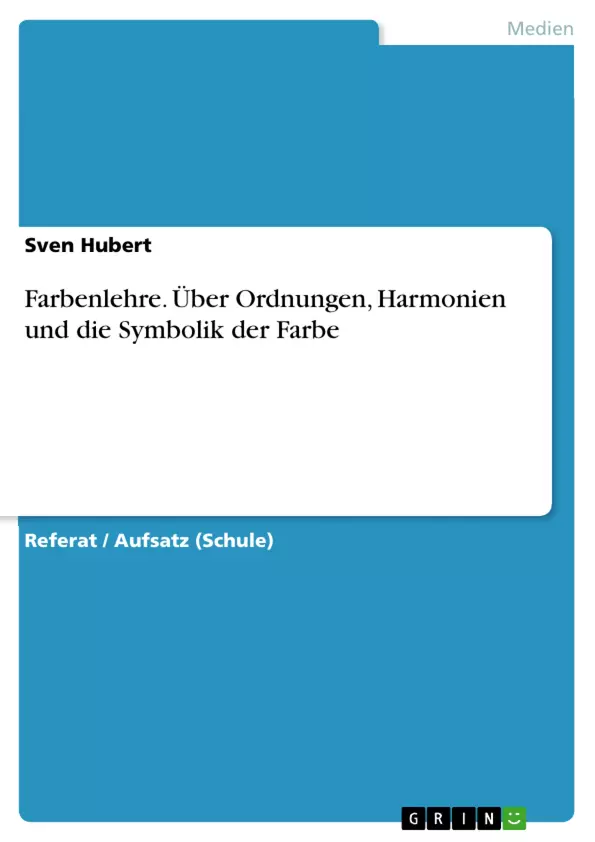Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit widmet sich dem Thema Farblehre und untersucht die vielfältigen Aspekte von Farbe in verschiedenen Bereichen wie Kunst, Psychologie, Physik und Chemie. Dabei werden Definitionen, Entstehung von Farbe, Farbmischung, Farbordnungen, Farbharmonie, Farbkontraste, Farb- und Luftperspektive, Symbolik der Farben, Veränderung der Farben, Farbfamilien, sowie Farbherstellung und ihre Anwendung in verschiedenen Bereichen beleuchtet.
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Bedeutung und Wirkung von Farben sowie ihre Anwendungsmöglichkeiten in Kunst, Architektur, Körperbemalung und Theater. Die Farblehre wird in ihren unterschiedlichen Facetten betrachtet und zeigt die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Farbe, Ästhetik, Kultur und Gesellschaft auf.
Mit einer detaillierten Analyse der Farbtheorie und ihrer Anwendungsbereiche bietet die Arbeit eine wertvolle Grundlage für ein tieferes Verständnis von Farbe und ihrer Bedeutung in verschiedenen Kontexten.
Farblehre
1. Begriff Farbe:
Der Begriff Farbe erfährt variierende Definitionen in den verschiedensten Bereichen. In der Chemie wird Farbe über die molekulare Zusammensetzung von Farbstoffen definiert, wohingegen in der Psychologie die Farbe als beeinflussendes Medium auf die Stimmung und das Befinden des Menschen angesehen wird.
Die Physik bzw. Strahlenoptik macht die Ursache von Farbe deutlich. Das vom Menschen sichtbare weiße Licht besteht in Wirklichkeit aus mehreren übereinanderliegenden Wellen mit differierenden Wellenlängen (Abb. 1.1.). Die einzelnen Strahlen werden je nach ihrer Wellenlänge vom Auge bzw. der Netzhaut in elektrische Impulse umgewandelt und vom Gehirn als die Farbe im eigentlichen Sinne interpretiert.
So entstehen die Gegenstandsfarbe - Ein Gegenstand reflektiert nur einen Teil des natürlichen weißen Lichts und hat so eine definierbare Farbe. - und die Erscheinungsfarbe - Bestrahlt man einen Gegenstand nur mit einigen Teilen des Lichts, so erscheint er in einer anderen Farbe.
In der Kunst ist die Farbe das wichtigste Ausdrucks- und Gestaltungsmittel der Malerei. Dabei wird das Wissen aus allen drei oben angeführten Bereichen angewendet. Die Physik als Grundlage. Die Chemie zur Herstellung bzw. Entwicklung verschiedener Farben. Die Psychologie, um die unterschiedlichsten Stimmungen in Bildern zum Ausdruck zu bringen.
2. Farbmischung
Generell unterscheidet man zwei Arten der Farbmischung. Zum einen die Mischung von Licht - die additive Farbmischung - und zum anderen die Mischung von Pigmenten - die subtraktive Farbmischung (Abb. 2.1.).
Mischt man die verschiedensten Farbpigmente (subtraktiv), so wird ein Großteil des Lichts absorbiert. So entsteht der Eindruck von Schwarz (kein Licht). Legt man hingegen Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen übereinander, so entsteht Weiß.
3. Unterscheidungsmerkmale einer Malfarbe
Eine Malfarbe kann nach ihrem Farbton, ihrer Helligkeit und Intensität eingeordnet werden. Jeder dieser Faktoren beeinflusst das Erscheinungsbild der entsprechenden Malfarbe.
Man sagt der Farbton bezeichnet die Farbe in ihrer Erscheinung als Gelb, Rot usw.. Die Farbhelligkeit beinhaltet die Aufhellung bzw. Verdunkelung der Farbe und die Intensität bezeichnet den Reinheitsgrad bzw. die Leuchtkraft einer Farbe.
4. Farbordnungen
Es gibt drei bedeutende Farbordnungen. Zum ersten wäre da derFarbkreisvon Johannes Itten (Abb. 4.1.) zu nennen.
Im Inneren des Kreises befinden sich die drei Primärfarben Blau, Gelb und Rot. Diese können nicht durch Mischen hergestellt werden. Um die Primärfarben herum sind die Sekundärfarben Violett (Blau + Rot), Orange (Gelb + Rot) und Grün (Gelb + Blau).
Die sich im Farbkreis gegenüberstehenden Farben sind Komplementärfarben. Sie ergeben einen Kontrast und bilden bei Mischung einen Grauton.
Im Außenbereich findet man neben den Sekundärfarben die Tertiärfarben, also Farben dritter Ordnung. Diese gehen aus der Mischung einer Sekundär- und einer Primärfarbe hervor.
Leider fehlen beim Ittenschen Farbkreis sehr viele Farbtöne, z.B. Erdfarben usw.. Auch die unbunten Farben Weiß, Schwarz, sowie Grautöne sind vernachlässigt.
Diesen Missstand behebt dieFarbkugelvon Philipp Otto Runge (Abb. 4.2.). Sie umfasst die 12 reinbunten Farben in Äquatorhöhe. An ihrer Oberfläche sind die Abstufungen jeder dieser Farben nach Schwarz und nach Weiß zu erkennen.
Somit ergibt sich als Achse zwischen Nord- und Südpol eine Grauwertskala. Bei einem gedachten Horizontalschnitt zeigen sich die Mischwerte zweier Komplementärfarben, wohingegen ein Vertikalschnitt sämtliche Trübungsstufen zeigt.
Diese Komplementärfarben sind wiederum die sich gegenüberliegenden
Farben auf der Kugeloberfläche. Dieses Ordnungssystem umfasste im Gegensatz zum Farbkreis theoretisch alle bunten und unbunten Farben.
Ein weiteres Ordnungssystem ist derElementarsternvon Paul Klee. Er stellt eine stark geometrisch anmutende Synthese aus Farbkreis und -kugel dar. Er ist aber sehr unübersichtlich und daher praktisch nur sehr schwer einsetzbar.
5. Farbharmonie
Durch Farben können subjektive Harmonieerlebnisse hervorgerufen, aber auch Aggressionen zum Ausdruck gebracht werden. Harmonie (Abb. 5.1.) kann durch Verwendung von Farbverwandtschaft, der Ähnlichkeit in Farben, Helligkeit und Intensität, sowie durch den Ausgleich von Kontrasten, z.B. Verwenden aller komplementären Farbpaare, geschaffen werden. Im Gegensatz dazu benutzt die Aggression (Abb. 5.2.) gezielt verschiedene Kontraste. Aber auch die Form und Quantität der Farbe spielt bei den Bildern eine wesentliche Rolle.
6. Farbkontraste
1. Farbe-an-sich-Kontrast
Der Farbe-an-sich-Kontrast wird durch den Gegensatz der unterschiedlichen Eigenfarbigkeit hervorgerufen. Er stellt den einfachsten und gleichzeitig stärksten Kontrast dar, da die verwendeten ungebrochenen Primär- und Sekundärfarben eine natürlich hohe Leuchtkraft besitzen.
2. Hell-Dunkel-Kontrast
Der Hell-Dunkel-Kontrast entsteht durch den Gegensatz von hellen und dunklen Farben. Am stärksten ist dabei der Kontrast zwischen Weiß und Schwarz. Dabei spielt die Eigenhelle der Farbe eine große Rolle (Gelb besitzt eine höhere Eigenhelle als Blau). In der Malerei spielt dieser Kontrast eine große Rolle. Er wird gezielt zur Tiefenwirkung, Körperlichkeit und zum Ausdruck von Stimmungen eingesetzt.
3. Kalt-Warm-Kontrast
Durch den Gegensatz warmer und kalter Farben entsteht ein weiterer Kontrast. Er beruht auf dem subjektiven Empfinden, dass warme Farben aktivierend und nah wirken (z.B. Gelb, Rotorange) und kalte Farben eher beruhigend und fern, ja eisig wirken (z.B. Blau, Blaugrün). Anwendung findet der Kalt-Warm- Kontrast vor allem in der Landschaftsmalerei um Farbperspektiven zu erzeugen.
4. Komplementärkontrast
Im Farbkreis gegenüberliegende Farben bilden einen Kontrast. Sie werden als Ausgleichsfarben betrachtet und ergeben bei Mischung einen Grauwert. So ergibt sich durch Ergänzung eine optische Harmonie.
5. Simultankontrast
Aus zwei geg. Farben entsteht der Eindruck der Mischfarbe, wenn diese in vielen kleinen benachbarten Flächen angeordnet sind. Eine Farbe überflutet sozusagen den benachbarten Bereich und überlagert sich mit einer anderen.
6. Qualitätskontrast
Der Qualitätskontrast beruht auf dem Gegensatz zwischen einer reinen Primärfarbe und einer getrübten Farbe. Er wird auch als Intensitätskontrast bezeichnet.
7. Quantitätskontrast
Der Quantitätskontrast wird durch bestimmte Mengenverhältnisse von Farben verursacht. Je stärker die Leuchtkraft einer Farbe, desto weniger Fläche braucht sie, um die gleiche Wirkung wie eine größere Fläche mit getrübter Farbe zu besitzen.
7. Farb- und Luftperspektive
In der Renaissance entdeckte man ein Mittel, um Tiefenräumlichkeit vorzutäuschen. Zum einen erkannte man, dass man durch Verblauung (von warm nach kalt), durch
Trübung (von leuchtend nach trüb) und durch Aufhellung (von dunkel nach hell), also mit der Farbperspektive Tiefe erzeugen konnte, aber zum anderen auch die Abnahme der Genauigkeit bzw. der Strukturen (von scharf nach unscharf), die Luftperspektive, den gewünschten Effekt erzielte.
8. Symbolik der Farbe
Farben besitzen in der Psychologie eine ganz bestimmte Bedeutung und Symbolik. Diese ist in folgender Tabelle dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9. Veränderung der Farbe
Eine reinbunte Farbe kann durch Aufhellen (mit Weiß), durch Abdunkeln (mit Schwarz) und durch Trüben (mit Grau) verändert werden. Dabei verliert die Farbe immer an Leuchtkraft. In den folgenden Abbildungen sind nun die verschiedenen Möglichkeiten am Beispiel der Farbe Rot dargestellt.
10. Farbfamilien
Farben können natürlich auch klassifiziert werden. Das kann nach den verschiedensten Gesichtspunkten geschehen - eben nach Farbton, Helligkeit und Intensität. Auf der folgenden Seite ist die Reihe der Brauntöne vereinfacht dargestellt (es wären natürlich viel mehr Farbtöne). Man erkennt, dass auf Basis der Mischfarbe Braun alle Abstufungen zu einzelnen Primär-, Sekundär- und nichtbunten Farben aufgezeigt werden.
11. Weitere Beispiele für Kontraste
Viele Künstler haben sich mit dem Thema Farbe und damit auch mit den möglichen Kontrasten auseinandergesetzt. Die Kontraste haben in den Werken einen besonders hohen Stellenwert, neben den Farben an sich und den Formen, der Linienführung, tragen sie mit zur Aussagekraft eines Bildes bei.
Ein bedeutender Künstler zur Zeit des Barock, der vor allem den Hell-Dunkel- Kontrast verwendete war Rembrandt (1606-1669). In seinem Werk ,,Die Anatomie des Dr. Tulp" kommt dieser Kontrast stark zum Ausdruck. Abb. 11.1. zeigt eine verallgemeinerte Farbanalyse seiner Bilder. Es stellt den Hell-Dunkel-Kontrast mit Hilfe der Familie der Brauntöne heraus.
Den Kalt-Warm-Kontrast setzte vor allem Salvador Dali (1904-1989) ein, um eine neue Form der Harmonie zu erzeugen. Sein Bild ,,Weiche Uhren" bringt das zum Ausdruck. Er grenzt durch unterschiedliche Farbigkeit Natur von der künstlichen, durch den Menschen erschaffene Welt ab.
Sehr stimmungsvoll, wenn auch teilweise bedrückend, wusste auch Pablo Picasso (1881-1973) die Kraft der Farben zu nutzen. Durch seine monochrome, kalte Farbreihe in ,,Guernica" wird das Thema Krieg und Leid hervorgehoben und bekräftig. Warme Farben hätten einen Bruch zwischen Form (eckig, kantig, gezackt) sowie Thema ergeben.
12. Farbherstellung
Prinzipiell unterscheidet man heute 3 mögliche Methoden der Farbherstellung.
1. Aus Pigmenten
Die natürlichen aus Kohle, Gips und verschiedenen Erden hergestellten Farben sind sehr beständig. Dies zeigen jahrtausendealte Höhlenmalereien. Anfang des Mittelalters kamen neue Quellen für die Pigmentgewinnung auf. So wurden Kristalle verwendet. Beispielsweise wird das ursprüngliche Ultramarin aus einem Halbedelstein hergestellt.
Der Stein wird zermahlen und nach dem Aussieben mit Wachsen und Ölen vermengt. Dann der in Textil verpackte Rohmaterialklumpen in einem Wasserbad gewalzt. Die feinen Pigmente werden auf diese Weise Schritt für Schritt ausgeschwemmt. Der Arbeitsaufwand ist enorm, der letzte Schritt muss sehr oft wiederholt werden, um ausreichend wasserunlösliche Pigmente zu erhalten. Die im Wasser sedimentierten Pigmente können dann abgeschöpft werden. Das ursprüngliche Ultramarin wurde mit Gold aufgewogen und ist auch heute noch teuer, dafür hat es aber eine Brillianz und Leuchtkraft, die keine Chemiefarbe hinreichend nachahmen könnte.
Um die Pigmente auf die Leinwand zu bekommen, werden sie noch mit einem Bindemittel (z.B. Milchkasein oder Eiweiß) versetzt. So kann die Farbe eine dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund eingehen.
2. Aus Pflanzen und Tierextrakten
Bekannte Farben werden aus organischem Material gewonnen. So zum Beispiel das Scharlachrot aus der Schildlaus oder das PurPur aufwendig aus einer bestimmten Schneckenart. Pflanzen boten so schon früher die Möglichkeit billige und weniger aufwendige Farben herzustellen. Die Indigopflanze war beispielsweise lange Zeit das Ausgangsmaterial Nummer eins für die Blauherstellung. Die Farben wurden vor allem zur Textilfärbung eingesetzt.
Dabei muss die vorverarbeitete Indigopflanze erst in einer bakterienversetzten
Alkhollösung gären, bei anderen Pflanzenbestandteilen (z.B. Zwiebelschalen) reichte ein Kochen. Das zu färbende Textil wurde speziell gebeizt, um die Farbe besser aufnehmen und länger halten zu können. Es wurde dann längere Zeit, je nach gewünschter Intensität der Farbe, in den Farbsud getaucht. Durch Luftoxidation setzte das Indigo dann das Blau frei.
3. Industriell
Mit der Industrialisierung kamen immer neuere chemische Verfahren auf. Die Steinkohleindustrie boomte und es fiel im großen Stil ein unerwünschtes Nebenprodukt übrig. Der Teer. Viele Forscher beschäftigten sich mit der Suche nach einer nützlichen Anwendung für die schwer abbaubare Substanz. Durch Zufall entdeckte ein Chemiker die Herstellung des sogenannten Anilins aus dem Teer. Durch weitere Forschung entwickelte sich daraus die Grundlage für die synthetischen Farbstoffe. Die industrielle Großproduktion billiger Farben konnte beginnen.
13. Farbe und Körper
Seit jahrtausenden wird die Körperbemalung überall auf der Welt in verschiedenster Art und Weise durchgeführt. Sie dient ästhetischen Zwecken, die aber eine enge Beziehung zur Gesellschaftsstruktur und Religion haben. Ästhetik kann nicht objektiv definiert, sondern muss subjektiv bewertet werden. Sie bildet einen Sinnzusammenhang. Der Mensch bringt durch die Körperbemalung seine Kultur zum Ausdruck und kann sich so von der Natur abgrenzen.
Dabei wird der Sinn für Ästhetik von der Gemeinschaft bestimmt. Die Art der Bemalung ist durch Regeln und Normen festgeschrieben und ist abhängig von Alter, Geschlecht und gesellschaftlicher Stellung des Menschen in der Gesellschaft, sowie vom Anlass der Bemalung (Riten, Feste, Alltag etc.).
Körperbemalungen sollen die Individualität eines Menschen bekräftigen und sind von dem momentanen Entwicklungs- bzw. Reifestadium der Person abhängig. Sie können aber auch Auskunft über die soziale Stellung oder die Stimmung eines Gesellschaftsmitgliedes geben.
In der heutigen Industriegesellschaft wird Farbe zur Korrektur eventueller Abweichungen vom Schönheitsideal verwendet. Nicht selten ist es aber eher ein Ausdruck der Freiheit der Menschen und ihrer Individualität.
Nicht zu vergessen spielt die Farbe eine große Rolle in der Welt des Theaters. Durch Maskierung kann die Schminke den Schauspieler bei der Darstellung verschiedener Charaktere unterstützen. Man kann gezielt Gestiken erzeugen, die die Aussage des Stückes visuell betonen.
14. Farbe in der Architektur
In der frühen menschlichen Architektur wurden zum Bau der Gebäude natürliche Materialien aus der unmittelbaren Umgebung verwendet. So bildeten die Farben der Bauwerke automatisch eine Harmonie mit der umliegenden Landschaft.
In der modernen Welt wird immer mehr der Beton verwendet. Dieser ist zwar universell einsetzbar und erlaubt neue Formen, er bedeutet aber gleichzeitig einen Bruch der farblichen Harmonie. Das triste Grau wirkt düster und unwirtlich. Ein Gebäude lebt nicht nur von der Form, es erhält seine Individualität erst durch die farbliche Gestaltung.
Vor allem in den 70er und 80er Jahren begann ein Boom von gigantischen Wohnsiedlungen mit großen blockartigen Wohneinheiten. Diese tristen eintönigen künstlichen Einheitslandschaften verloren jegliche Individualität. Was zählte war die raumsparende Ansammlung vieler hundert Wohnungen. Man konnte sich regelrecht verlaufen, und musste sich zum Finden der eigenen Wohnung an Hausnummern orientieren.
Heute versucht man mit einem individuellen farbigen Anstrich das zu retten, was zu retten ist. Dabei wird die Wirkung auf den Menschen berücksichtigt. Man versucht Optimismus auszustrahlen und die verlorengegangene Harmonie wiederzufinden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Farbe laut dem Text "Farblehre"?
Der Text definiert Farbe aus verschiedenen Perspektiven: chemisch (molekulare Zusammensetzung von Farbstoffen), psychologisch (Einfluss auf Stimmung und Befinden) und physikalisch (Wellenlängen des Lichts, die vom Auge als Farbe interpretiert werden).
Was sind Gegenstandsfarbe und Erscheinungsfarbe?
Gegenstandsfarbe ist die Farbe, die ein Gegenstand hat, weil er nur einen Teil des weißen Lichts reflektiert. Erscheinungsfarbe ist die Farbe, die ein Gegenstand hat, wenn er nur mit bestimmten Teilen des Lichts bestrahlt wird.
Welche Arten der Farbmischung werden unterschieden?
Es werden zwei Arten der Farbmischung unterschieden: die additive Farbmischung (Mischung von Licht) und die subtraktive Farbmischung (Mischung von Pigmenten).
Welche Unterscheidungsmerkmale hat eine Malfarbe?
Eine Malfarbe kann nach ihrem Farbton, ihrer Helligkeit und ihrer Intensität eingeordnet werden.
Welche Farbordnungen werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt den Farbkreis von Johannes Itten, die Farbkugel von Philipp Otto Runge und den Elementarstern von Paul Klee.
Was sind Komplementärfarben?
Komplementärfarben sind Farben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen. Sie erzeugen einen Kontrast und ergeben bei Mischung einen Grauton.
Was bedeutet Farbharmonie?
Farbharmonie entsteht durch Verwendung von Farbverwandtschaft, Ähnlichkeit in Farben, Helligkeit und Intensität, sowie durch den Ausgleich von Kontrasten.
Welche Farbkontraste werden im Text beschrieben?
Der Text beschreibt folgende Farbkontraste: Farbe-an-sich-Kontrast, Hell-Dunkel-Kontrast, Kalt-Warm-Kontrast, Komplementärkontrast, Simultankontrast, Qualitätskontrast und Quantitätskontrast.
Was versteht man unter Farb- und Luftperspektive?
Farbperspektive ist die Vortäuschung von Tiefe durch Verblauung, Trübung und Aufhellung von Farben. Luftperspektive ist die Vortäuschung von Tiefe durch die Abnahme der Genauigkeit bzw. der Strukturen.
Wie kann eine Farbe verändert werden?
Eine reinbunte Farbe kann durch Aufhellen (mit Weiß), Abdunkeln (mit Schwarz) und Trüben (mit Grau) verändert werden.
Welche Methoden der Farbherstellung werden unterschieden?
Es werden drei Methoden der Farbherstellung unterschieden: aus Pigmenten, aus Pflanzen- und Tierextrakten und industriell.
Welche Rolle spielt Farbe bei der Körperbemalung?
Körperbemalung dient ästhetischen Zwecken und hat eine enge Beziehung zur Gesellschaftsstruktur und Religion. Sie drückt die Kultur aus und grenzt den Menschen von der Natur ab.
Welche Bedeutung hat Farbe in der Architektur?
Farbe spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Gebäuden und trägt zur Individualität bei. Sie kann die Form und Funktion eines Gebäudes unterstützen und eine harmonische Beziehung zur Umgebung herstellen.
- Arbeit zitieren
- Sven Hubert (Autor:in), 2001, Farbenlehre. Über Ordnungen, Harmonien und die Symbolik der Farbe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99748