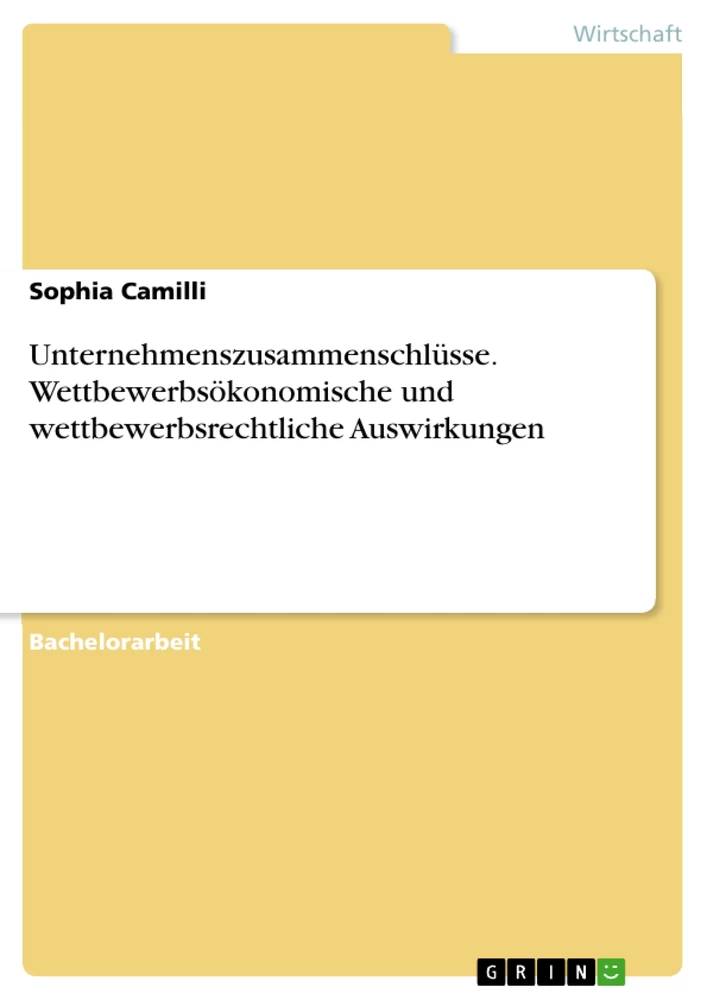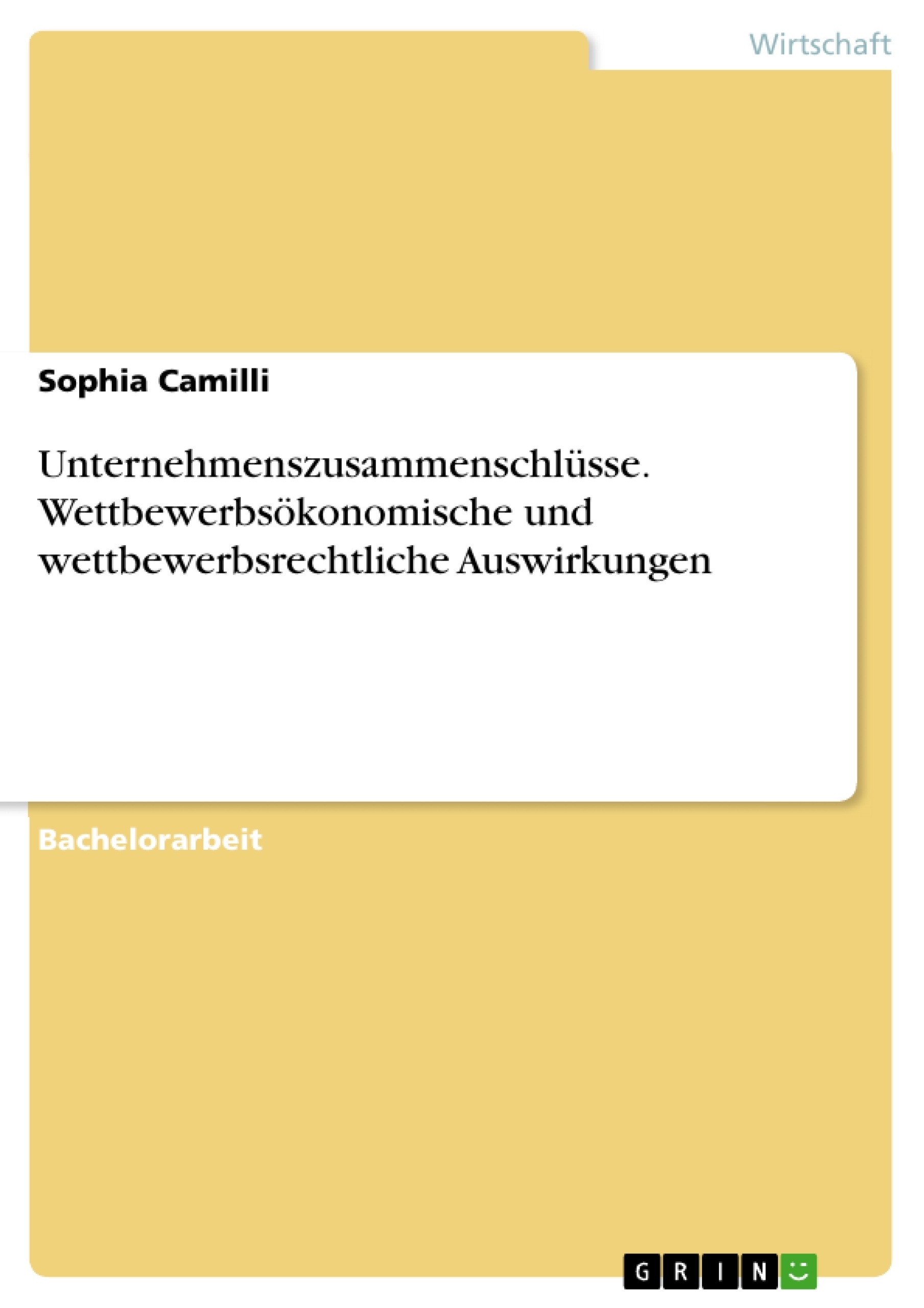Die steigende Anzahl an Unternehmenszusammenschlüssen in den letzten Jahrzehnten weist auf deren wachsende Bedeutung bezüglich wirtschaftlichen Verhaltens hin. Dennoch können Auswirkungen einer Fusion den Wettbewerb beeinflussen und müssen folglich reguliert werden. Die vorliegende Arbeit beantwortet die Frage, wie sich Fusionen auf den Wettbewerb und damit potentielle Konkurrenten, Kunden, Konsumenten und vorgelagerte Unternehmen auswirken. Es wird untersucht, wie Fusionskontrollgesetze und -methoden durch ökonomische Theorien bezüglich Wettbewerbsauswirkungen beeinflusst werden. Letztlich werden aktuelle Fallbeispiele auf die tatsächliche Anwendung theoretischer Modelle überprüft und Herausforderungen für Wettbewerbsbehörden definiert. Zur Ergebnisfindung werden Wettbewerbsgesetze und Kontrollmethoden der Behörden mit traditioneller ökonomischer Literatur verglichen.
Eine Synthese dieses Vergleichs findet durch die Analyse von drei aktuellen Fallbeispielen statt. Das Ergebnis zeigt, dass die bedeutendsten Fusionseffekte durch Marktmacht und Effizienzen entstehen, die sich wiederum auf Preise und Innovationstätigkeiten eines Marktes auswirken. Methoden und Entscheidungen können sich abhängig von spezifischen Marktstrukturmerkmalen unterscheiden. Wettbewerbsbehörden entscheiden im Allgemeinen anhand von Kombinationen aus traditionellen ökonomischen Theorien und flexiblen Analysemethoden, ob eine Fusion dem Wettbewerb schadet und demnach unterbunden werden muss. Aktuelle Fallbeispiele heben die Bedeutung des Einflusses von spezifischen markt- und unternehmensspezifischen Eigenschaften bei der Entscheidungsfindung hervor. Die Komplexität der Ermittlung von Schadenstheorien für einzelne Märkte wird ebenfalls hervorgehoben. Besonders das Entstehen neuer Märkte stellt eine Hürde für zukünftige Fusionskontrollen dar. Zusammenfassend basieren heutige Fusionskontrollen hauptsächlich auf ökonomischen Ansätzen. Exakte Evaluationen einer Fusion hängen dabei von spezifischen Markteigenschaften ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Relevanz
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau und Methodik
- 2. Fusionen
- 2.1 Definition und Typen von Fusionen
- 2.2 Fusionsmotive aus Unternehmenssicht
- 3. Wettbewerbsökonomische Betrachtung
- 3.1 Der Begriff des Wettbewerbs und seine Funktionen
- 3.2 Wettbewerbspoltische Leitbilder
- 3.2.1 Wettbewerbsformen der Neoklassik
- 3.2.2 Dynamische Wettbewerbsbetrachtung
- 3.3 Theoretische Konzepte zu Fusionsauswirkungen
- 3.3.1 Marktkonzentration
- 3.3.2 Marktmachteffekte
- 3.3.3 Effizienzeffekte
- 3.3.4 Innovationskraft des Marktes
- 3.3.5 Kollusionsgefahr
- 3.4 Empirische Untersuchungen von Fusionsauswirkungen
- 3.4.1 Auswirkungen auf Profitabilität der Konkurrenzunternehmen
- 3.4.2 Preisauswirkungen auf Konsumenten
- 4. Wettbewerbsrechtliche Betrachtung
- 4.1 Notwendigkeit und Aufgaben von Wettbewerbsbehörden
- 4.2 Wettbewerbsbehörden und Gesetze
- 4.2.1 Das Bundeskartellamt und die Europäische Kommission
- 4.2.2 Weltweite Behörden und Organisationen
- 4.3 Methoden der Europäischen Fusionskontrolle
- 4.3.1 Allgemeiner Verfahrensablauf
- 4.3.2 Markteingrenzung
- 4.3.3 Kriterien der Entscheidungsfindung
- 4.3.4 Sonderregelungen
- 4.4 Effektivität von Fusionskontrollen
- 5. Analyse von Fallbeispielen
- 5.1 Facebook und WhatsApp
- 5.2 Edeka und Kaiser's Tengelmann
- 5.3 Bayer und Monsanto
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis analysiert die Auswirkungen von Fusionen auf die Wettbewerbslandschaft. Ziel ist es, die Auswirkungen von Fusionen aus ökonomischer und rechtlicher Perspektive zu beleuchten und ein umfassendes Verständnis für die Komplexität dieser Prozesse zu entwickeln.
- Die wettbewerbsökonomischen Auswirkungen von Fusionen auf den Markt
- Die Rolle von Marktmacht und Wettbewerb bei Fusionen
- Die Bedeutung von Fusionskontrollen durch Wettbewerbsbehörden
- Die Analyse von Fallbeispielen aus verschiedenen Branchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung und Relevanz der Arbeit ein, erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 definiert den Begriff der Fusion und unterscheidet verschiedene Typen. Es werden außerdem die wichtigsten Fusionsmotive aus Unternehmenssicht dargelegt.
Kapitel 3 behandelt die wettbewerbsökonomische Betrachtung von Fusionen. Es werden verschiedene wettbewerbsökonomische Theorien beleuchtet, die sich mit den Auswirkungen von Fusionen auf Marktstruktur, Wettbewerb und Konsumenten beschäftigen. Es werden auch empirische Untersuchungen zu den Auswirkungen von Fusionen auf die Profitabilität von Unternehmen und die Preise für Konsumenten vorgestellt.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der wettbewerbsrechtlichen Betrachtung von Fusionen. Es wird die Notwendigkeit und die Aufgaben von Wettbewerbsbehörden erläutert, sowie die Methoden der Europäischen Fusionskontrolle und die Effektivität von Fusionskontrollen betrachtet.
Kapitel 5 analysiert drei Fallbeispiele von Fusionen, um die theoretischen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln zu illustrieren. Es werden die Fusionen zwischen Facebook und WhatsApp, Edeka und Kaiser's Tengelmann sowie Bayer und Monsanto analysiert.
Schlüsselwörter
Fusionen, Wettbewerbsökonomie, Wettbewerbsrecht, Marktmacht, Wettbewerbspoltik, Fusionskontrolle, Fallbeispiele.
- Quote paper
- Sophia Camilli (Author), 2018, Unternehmenszusammenschlüsse. Wettbewerbsökonomische und wettbewerbsrechtliche Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/994304