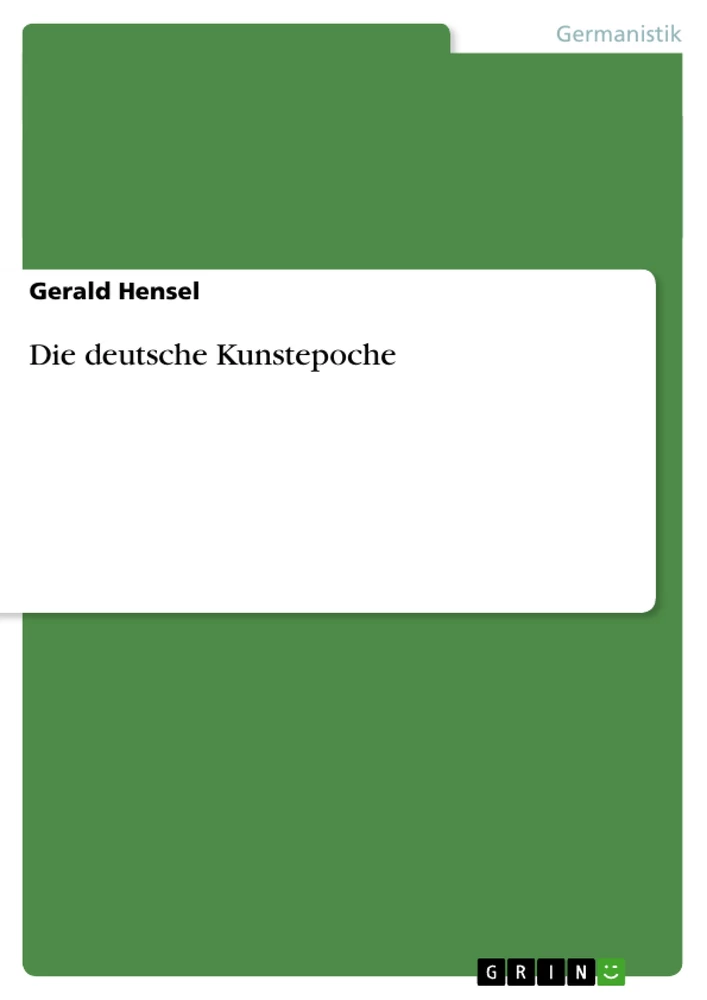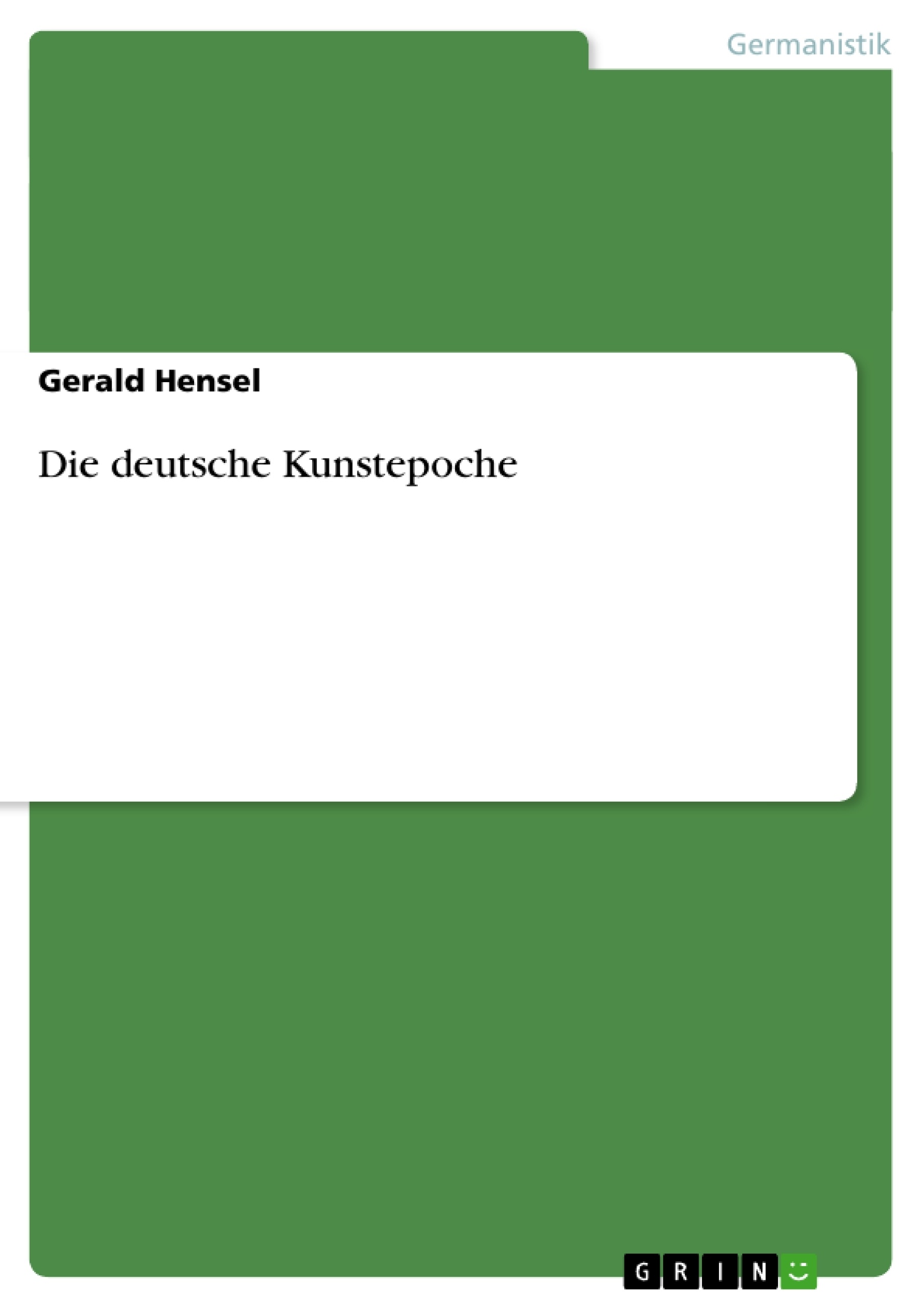Was geschah, als junge Genies gegen die Fesseln der Aufklärung rebellierten und eine neue Ära der Selbstverwirklichung einläuteten? Diese fesselnde Analyse entführt den Leser in die stürmische Welt des Sturm und Drang, einer Epoche, die von leidenschaftlicher Subjektivität, kühner Individualität und der unbändigen Kraft der Einbildungskraft geprägt war. Entdecken Sie, wie Goethes frühe Werke und Schillers "Die Räuber" die Grenzen der Konvention sprengten und ein revolutionäres Menschenbild entwarfen, in dem das Individuum im Mittelpunkt des Universums steht. Doch inmitten des idealisierten Weltbildes lauern philosophische Fallstricke: Kann eine Gesellschaft, die ausschließlich aus Individualisten besteht, überleben? Tauchen Sie ein in die Debatte um Schönheit und Ästhetik, entfacht durch Johann Christoph Gottsched und Alexander Gottlieb Baumgarten, und erfahren Sie, wie die sinnliche Wahrnehmung zur treibenden Kraft der Erkenntnis wird. Weiter geht die Reise durch die Kunstepoche, eine Zeit des Umbruchs und der künstlerischen Blüte zwischen der Französischen Revolution und Goethes Tod. Erleben Sie den Aufstieg der Klassik unter Goethe und Schiller, die eine Ästhetisierung der Gesellschaft anstrebten, und die romantische Sehnsucht nach einer Wiedervereinigung von Poesie und Mythologie. Doch die Romantik birgt auch dunkle Abgründe, existenzielle Identifikationsprobleme und die Erkenntnis, dass das Unbewusste den Menschen lenkt. Nicht zu vergessen die Jakobiner, eine Gruppe radikaler Demokraten, die Kunst und Literatur als Werkzeuge politischer Aufklärung einsetzten, um die Kluft zwischen Intellektuellen und Volk zu überwinden. Eine Epoche voller Widersprüche, Konflikte und unstillbarer Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverwirklichung, die bis heute nachwirkt. Diese umfassende Untersuchung enthüllt die tiefgreifenden Einflüsse des Sturm und Drang, der Klassik, der Romantik und der Jakobiner auf unser Verständnis von Kunst, Gesellschaft und dem menschlichen Dasein. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die deutsche Literaturgeschichte, Philosophie und die großen Fragen der Menschheit interessieren.
I. Sturm und Drang
,,Sturm und Drang - Das Z ü ndkraut der Revolution" (Goethe)
Definition: ,,...geistige Bewegung in Deutschland von Mitte der sechziger bis Ende der achtziger Jahre des 18. Jh.s. Die Bez. >Sturm und Drang< wurde nach dem Titel eines Schauspiels von F. M. Klinger (1777) auf die ganze Bewegung übertragen. Ihr Ausgangspunkt ist eine jugendliche Revolte gegen Einseitigkeiten der Aufklärung, gegen ihren Rationalismus, ihren Fortschrittsoptimismus, ihre Regelgläubigkeit und ihr verflachtes Menschenbild, aber auch gegen die >unnatürliche< Gesellschaftsordnung mit ihren Ständeschranken, erstarrten Konventionen und ihrer lebensfeindlichen Moral." (Schweikle, 1990: S. 448)
Werte des Sturm und Drang: Das Programm des Sturm und Drang war geprägt von einem neuen Menschenbild, welches des Menschen als Individuum in einer Welt begriff, die diesem die Chance zur Selbstverwirklichung ließ. Subjektivität, Individualität (nämlich die individuelle Selbstauferlegung von Regeln), Autonomie, Selbstverwirklichung waren die erklärten lebensphilosophischen Ziele der Stürmer und Dränger. Auf geistiger Ebene galten die Begrifflichkeiten Genie, Einbildungskraft und Ästhetik als hochgehaltene Werte der Epoche. Diese Werte resultierten in einer breiten Ablehnung der damals vorherrschenden Philosophie. Dogmen und bindende Regeln galten als ablehnenswerte Widersacher eines freien und neuen Menschenbildes.
Das Menschenbild: Goethes Frühwerke, wie die Gedichte Prometheus und Ganymed stehen ganz in der Tradition des Sturm und Drang. Das Individuum steht im Zentrum einer Welt, die subjektiv beurteilt wird und deren Vorstellung von Authorität und Hierarchien primär als Bühne für die Selbstverwirklichung des Subjekts fungiert. Schillers wohl bekanntestes Werk Die R ä uber, beschert dem Subjekt eine Daseinsform ausserhalb des Gesetzes, nachdem die Zweifel an althergebrachtem übermächtig wurden. Schnell lässt sich jedoch eine philosophische Unschärfe in der Sturm und Drang-Lebensauffassung identifizieren: Eine Gesellschaft, die nur aus Individualisten besteht, ist weder eine Gesellschaft noch überlebensfähig. Dementsprechend ist das idealisierte Weltbild von Sturm und Drang nicht zu verwirklichen.
Die Subjektproblematik: Schönheit und Ästhetik galt als ein zentrales Sturm und Drang- Identifikationsmoment. Mit Johann Christoph Gottsched bricht eine Diskussion los, die die Frage nach literarischer Normierung klären will. Gottsched ist der Auffassung, dass elementare Bestandteile poetischer Dichtkunst aus literarischen Werken verbannt werden müssten und eine Literaturnormierung nach dem Vorbild der Antike vorgenommen werden solle. Ab 1750 veröffentlich Alexander Gottlieb Baumgarten ein Werk mit dem Titel Aesthetica. Hier wird Ästhetik als Wissenschaft der sinnlichen Wahrnehmung definiert. Die Subjektproblematik (Gesellschaft voller Individuen ist nicht zu verwirklichen), kann literarisch bearbeitet und angegangen werden. Das Ziel ist die Vervollkommnung der sinnlichen Erkenntnis. Der subjektive Faktor wird jetzt in einem Zustand sinnlicher Wahrnehmung gesehen, den das Individuum einnimmt. Kurz: Ästhetisch ist nicht das Betrachtungsobjekt (z.B. ein Buch), sondern der Zustand, den das Individuum bei der sinnlichen Erkenntnis dieses Objektes hat.
II. Kunstepoche
In Heinrich Heines Rückblick erscheint die Kunstepoche als die Zeit zwischen der französischen Revolution (1789) und Goethes Todesjahr (1832). Heine nannte diese Literaturperiode, eine Zeit, in der der Künstler einen besonders hohen Stellenwert einnahm. Die Kunstepoche lässt sich in drei Hauptrichtungen unterscheiden: die klassische, die maßgeblich von Goethe und Schiller formuliert wurde, die romantische, die insbesondere von den Brüdern Schlegel und Novalis ausgearbeitet wurde, und die jakobinische, die von einer Reiher revolutionärer Demokraten vertreten wurde. (vgl. Stephan, 1994: S.154-157)
Gesellschaftlich-politisch fällt die Kunstepoche in die Zeit zwischen zwei Phasen europäischer Revolutionen. Während Frankreich sich seiner Aristokraten entledigte, fand die Revolution in Deutschland nicht statt. Stattdessen beschritt Deutschland einen Sonderweg mit einem aufgeklärten Absolutismus. Gesellschaftlich fand ein Prozess der Differenzierung statt. Für oder gegen Revolution, Städtisches Bürgertum oder Kleinbürgertum, Idealismus oder Materialismus: die Zeichen der Zeit standen auf Gesellschafts- und Glaubenskonflikt. In dieser konfliktträchtigen Zeit, einen Halt zu gewinnen, wurde als kulturgesellschaftliche Aufgabe gesehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Klassik: Absetzung Goethes von Sturm und Drang. Der Autonomiegedanke wird jetzt der Kunst unterworfen. Ziel: Das in sich geschlossene Kunstwerk. Kunst wirkt nicht mehr zum Selbstzweck sondern als Fortführung der Aufklärung über ästhetische Formerfahrung. Gefühle sollen in einen harmonischen Zustand gebracht werden.
Schiller: Wenn eine Gesellschaft funktionieren soll, kann der Einzelne nur bestimmte Fähigkeiten ausbilden, während andere brach liegen - Entfremdung des Subjekts durch Teilkonzentration auf bestimmte Fähigkeiten. Schiller sucht eine Ästhetisierung der Gesellschaft, wodurch das Subjekt frei wird und eine Humanität durch ästhetische Erfahrung stattfindet.
Die Hauptvertreter der deutschen Klassik lehnen die französische Revolution und ihre mögliche Ausweitung auf Deutschland ab. Literarisch wird eine Anlehnung an die griechische Klassik als höchste Kulturform gesucht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Romantik: Die Romantiker versuchen zunächst Poesie und Mythologie wieder in Einklang zu bringen. Die geschieht über eine Idealisierung und Romantisierung des Mittelalters, welches als goldene Epoche angesehen wird. Der Traum vom einigen Christentum steht hierbei in enger Verbindung mit dem Wunsch nach der Restauration des heiligen römischen Reiches deutscher Nation.
Als progressive Universalpoesie versucht die Romantik , Welt und Wissenschaft zu poetisieren, während die Poesie verwissenschaftlicht werden soll. Ziel ist die Aufhebung aller Differenzen. Die Spätromantik (mit Vertretern wie E. T. A. Hoffmann), leidet unter existentiellen Identifikationsproblemen, die sich in Spot über die Frühromantiker offenbaren. Zentrale Auffassung der Romantik ist, dass nicht das ,,Ich" Herr über das Individuum ist sondern Unbewusstes den Menschen lenkt.
Schaubild: Kulturphilosophische Auffassung der Romantik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jakobiner: Von der Reaktion als Jakobiner (nach dem nachrevolutionären französischen Schreckensregime unter Robespierre) verunglimpfte Gruppe deutscher Radikaldemokraten. Kunst und Literatur haben nach den Jakobinern keine bildende oder ästhetisierende Funktion sondern eine politisch aufklärende. (vgl. Stephan, 1994: S. 182-186) Ziel der nicht sonderlich ausgeprägten jakobinischen Literatur ist der demokratische Umsturz. Besonders die Kluft zwischen Intellektuellen und dem Volk soll überbrückt werden.
Die Jakobiner bedienten sich vor allem politischer Lyrik, Satire und dem Reiseroman. Der Reiseroman war ein Versuch, der drückenden Zensur ein Schnippchen zu schlagen, indem er über vermeintlich bessere Verhältnisse in anderen Regionen der Welt aufklärte, ohne direkt die bestehden Ordnung zu verunglimpfen.
Die Jakobinische Epoche endete in Folge der napoleonischen Kriege und die darauf folgende Besetzung Deutschlands durch französische Truppen.
Quellen:
1. Schweikle, Günther / Schweikle, Irmgard (Hg.): Metzler-Literatur-Lexikon. 2. überarbeitete Auflage, Stuttgart 1990
Häufig gestellte Fragen
Was ist Sturm und Drang?
Sturm und Drang war eine geistige Bewegung in Deutschland von Mitte der 1760er bis Ende der 1780er Jahre. Sie war eine jugendliche Revolte gegen die Einseitigkeiten der Aufklärung, wie Rationalismus, Fortschrittsoptimismus und Regelgläubigkeit, sowie gegen die gesellschaftliche Ordnung mit ihren Ständeschranken und Konventionen.
Was waren die Werte des Sturm und Drang?
Die Werte des Sturm und Drang waren geprägt von einem neuen Menschenbild, das den Menschen als Individuum mit der Chance zur Selbstverwirklichung sah. Subjektivität, Individualität, Autonomie und Selbstverwirklichung waren zentrale Ziele. Auf geistiger Ebene galten Genie, Einbildungskraft und Ästhetik als hochgehaltene Werte.
Wie sah das Menschenbild im Sturm und Drang aus?
Das Individuum stand im Zentrum, und Autorität und Hierarchien wurden primär als Bühne für die Selbstverwirklichung des Subjekts betrachtet. Schillers Werk "Die Räuber" beschreibt beispielsweise ein Subjekt außerhalb des Gesetzes.
Was ist die Subjektproblematik im Kontext des Sturm und Drang?
Die Subjektproblematik bezieht sich auf die Schwierigkeit, eine Gesellschaft zu verwirklichen, die ausschließlich aus Individualisten besteht. Ästhetik wurde als Zustand sinnlicher Wahrnehmung des Individuums betrachtet, nicht als Eigenschaft des Objekts selbst.
Was ist die Kunstepoche?
Die Kunstepoche, wie sie Heinrich Heine beschreibt, ist die Zeit zwischen der Französischen Revolution (1789) und Goethes Todesjahr (1832). In dieser Periode nahm der Künstler einen besonders hohen Stellenwert ein. Sie lässt sich in Klassik, Romantik und Jakobinische Richtung unterteilen.
Was waren die gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen der Kunstepoche?
Die Kunstepoche fiel in die Zeit zwischen zwei Phasen europäischer Revolutionen. Deutschland beschritt einen Sonderweg mit aufgeklärtem Absolutismus. Es herrschten gesellschaftliche und Glaubenskonflikte, und die Gewinnung von Halt in dieser Zeit wurde als kulturgesellschaftliche Aufgabe gesehen.
Was sind die Merkmale der Klassik in der Kunstepoche?
Die Klassik, maßgeblich von Goethe und Schiller formuliert, unterwarf den Autonomiegedanken der Kunst. Ziel war das in sich geschlossene Kunstwerk, das als Fortführung der Aufklärung über ästhetische Formerfahrung wirkte. Gefühle sollten in einen harmonischen Zustand gebracht werden.
Welche Rolle spielte Schiller in der Klassik?
Schiller sah eine Entfremdung des Subjekts durch die Teilkonzentration auf bestimmte Fähigkeiten in der Gesellschaft. Er suchte eine Ästhetisierung der Gesellschaft, durch die das Subjekt frei werden und eine Humanität durch ästhetische Erfahrung stattfinden sollte.
Was sind die Merkmale der Romantik in der Kunstepoche?
Die Romantiker versuchten Poesie und Mythologie wieder in Einklang zu bringen, insbesondere durch die Idealisierung des Mittelalters. Sie strebten eine progressive Universalpoesie an, die Welt und Wissenschaft poetisieren sollte. Eine zentrale Auffassung war, dass Unbewusstes den Menschen lenkt.
Was sind die Merkmale der Jakobinischen Richtung in der Kunstepoche?
Die Jakobiner (Radikaldemokraten) sahen Kunst und Literatur nicht als bildende oder ästhetisierende Funktion, sondern als politisch aufklärende. Ihr Ziel war der demokratische Umsturz und die Überbrückung der Kluft zwischen Intellektuellen und dem Volk.
Welche literarischen Formen nutzten die Jakobiner?
Die Jakobiner bedienten sich vor allem politischer Lyrik, Satire und dem Reiseroman, um die Zensur zu umgehen und über vermeintlich bessere Verhältnisse in anderen Regionen der Welt aufzuklären.
- Quote paper
- Gerald Hensel (Author), 2001, Die deutsche Kunstepoche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99187