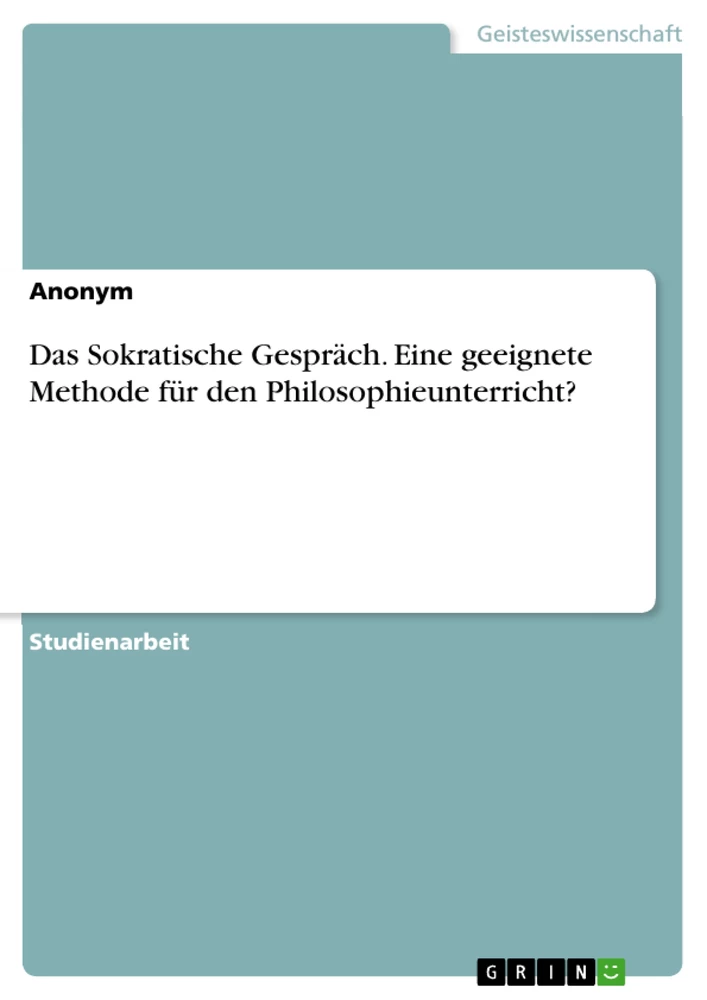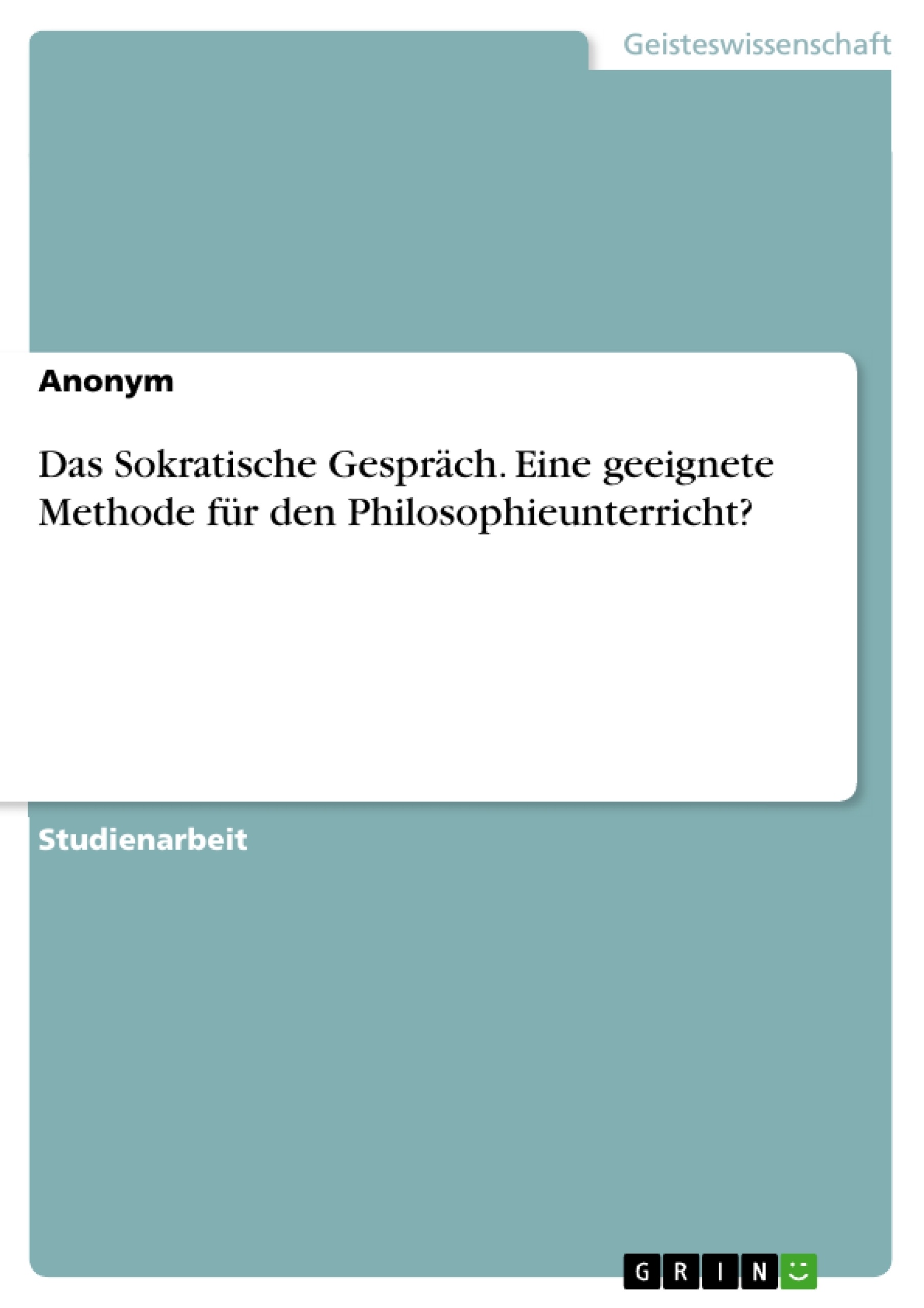Philosophie an sich ist eine freie Wissenschaft. Daher ist es schwierig zu bestimmen was ein guter Philosophie- oder Ethikunterricht beinhalten soll und ob die Philosophie überhaupt in den Ethikunterricht mit aufgenommen werden soll. Die Philosophie im Ethikunterricht dürfe nicht mit zu hohen Erwartungen überladen mit gesellschaftlichen Problemen konfrontiert werden. Vielmehr sollen die Schüler*innen lernen selbstständig nachzudenken. Eine Methode dies zu erreichen wäre beispielsweise das Sokratische Gespräch. Wieso genau dies als Methode für den Philosophieunterricht funktionieren könnte, wird im Folgenden versucht zu ermitteln. Dafür ist es wichtig zu analysieren, wie der gute Philosophieunterricht auszusehen hat. Die Thesen des deutschen Philosophen Ekkehard Martens stellen sehr gut dar, wie Philosophie in die Praxis umgesetzt werden könnte. So kann dann ermittelt werden, ob das Sokratische Gespräch die Voraussetzungen dafür erfüllt und als Methode fungieren würde. Um jedoch die Methode des Sokratischen Gesprächs zu verstehen, sollte zuerst ein Blick auf den Anfang dessen, nämlich die Sokratische Methode, geworfen werden und wie es letztendlich zum Sokratischen Gespräch wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sokratische Methode
- Sokratisches Gespräch
- Nelson
- Heckmann
- Philosophieren in der Schule nach Martens
- Methodik
- Sokratisches Gespräch als Umsetzungsidee
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Sokratischen Gesprächs im Philosophieunterricht. Sie analysiert die Sokratische Methode, entwickelt von Sokrates, und ihre Weiterentwicklung zum Sokratischen Gespräch durch Nelson und Heckmann. Die Arbeit beleuchtet die didaktischen Konzepte von Ekkehard Martens und prüft, inwiefern das Sokratische Gespräch deren Kriterien für guten Philosophieunterricht erfüllt.
- Die Sokratische Methode und ihre Prinzipien
- Die Entwicklung des Sokratischen Gesprächs von der dyadischen zur polylogischen Form
- Die didaktischen Ansätze von Ekkehard Martens für den Philosophieunterricht
- Die Eignung des Sokratischen Gesprächs als Methode im Philosophieunterricht
- Die Rolle des Lehrers im Sokratischen Gespräch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Philosophieunterrichts und die Bedeutung des Lehrens und Lernens in der Philosophie ein. Sie stellt die Frage nach geeigneten Methoden für den Philosophieunterricht und hebt das Sokratische Gespräch als mögliche Lösung hervor. Die Arbeit skizziert den Ansatz, die Eignung des Sokratischen Gesprächs anhand der Thesen von Ekkehard Martens zu überprüfen.
Die Sokratische Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Sokratische Methode als ein Verfahren zur Erkenntnisgewinnung, das auf der selbstständigen Auseinandersetzung mit Problemen basiert. Der Lehrer fungiert hier als Begleiter und Unterstützer, der die Schüler zum selbstständigen Denken anregt, anstatt sie direkt zu belehren. Der Fokus liegt auf dem Aufdecken von Nichtwissen und der Förderung des dialogischen Philosophierens als Weg zur Erkenntnis. Die Bedeutung des Dialogs für die Erziehung und Bildung wird hervorgehoben.
Sokratisches Gespräch: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Sokratischen Methode zum Sokratischen Gespräch. Im Gegensatz zum dyadischen Dialog der ursprünglichen Methode findet das Sokratische Gespräch in einem Polylog statt, wobei eine gemeinsam geteilte Erkenntnis im Mittelpunkt steht. Es wird der Beitrag von Leonard Nelson und Gustav Heckmann zur Weiterentwicklung des Sokratischen Gesprächs für den universitären und schulischen Kontext erläutert. Nelson strebte eine Begründung der Philosophie als Wissenschaft an, indem er das Sokratische Gespräch als Methode des philosophischen Unterrichts etablieren wollte.
Philosophieren in der Schule nach Martens: Dieser Abschnitt präsentiert die Thesen des Philosophen Ekkehard Martens zum Philosophieren in der Schule. Die Methodik und die Umsetzungsidee des Sokratischen Gesprächs werden im Kontext von Martens' Ansatz analysiert, um zu bewerten, ob das Sokratische Gespräch den von Martens formulierten Kriterien für guten Philosophieunterricht entspricht. Dieser Teil fokussiert auf die praktische Anwendbarkeit und die didaktischen Implikationen.
Schlüsselwörter
Sokratische Methode, Sokratisches Gespräch, Philosophieunterricht, Dialogisches Philosophieren, Erkenntnisgewinnung, Didaktik, Ekkehard Martens, Leonard Nelson, Gustav Heckmann, Selbstständiges Denken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Anwendbarkeit des Sokratischen Gesprächs im Philosophieunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Sokratischen Gesprächs im Philosophieunterricht. Sie analysiert die Sokratische Methode, ihre Weiterentwicklung zum Sokratischen Gespräch und die didaktischen Konzepte von Ekkehard Martens, um zu prüfen, inwiefern das Sokratische Gespräch Martens' Kriterien für guten Philosophieunterricht erfüllt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Sokratische Methode und ihre Prinzipien, die Entwicklung des Sokratischen Gesprächs von der dyadischen zur polylogischen Form, die didaktischen Ansätze von Ekkehard Martens, die Eignung des Sokratischen Gesprächs als Methode im Philosophieunterricht und die Rolle des Lehrers im Sokratischen Gespräch.
Wer sind die wichtigsten Autoren, die in der Arbeit behandelt werden?
Die Arbeit befasst sich schwerpunktmäßig mit den Beiträgen von Sokrates, Leonard Nelson, Gustav Heckmann und Ekkehard Martens zum Thema des Sokratischen Gesprächs und des Philosophieunterrichts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Sokratischen Methode, zum Sokratischen Gespräch (inkl. der Beiträge von Nelson und Heckmann), zum Philosophieren in der Schule nach Martens und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist die Kernfrage der Arbeit?
Die zentrale Frage ist, ob und inwiefern das Sokratische Gespräch eine geeignete Methode für den Philosophieunterricht darstellt, insbesondere im Hinblick auf die didaktischen Kriterien von Ekkehard Martens.
Welche Methode wird im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht im Detail das Sokratische Gespräch, sowohl seine historische Entwicklung von der dyadischen (Sokrates) zur polylogischen Form (Nelson, Heckmann) als auch seine praktische Anwendbarkeit im Schulkontext anhand der didaktischen Konzepte von Ekkehard Martens.
Welche Rolle spielt Ekkehard Martens in dieser Arbeit?
Ekkehard Martens' didaktische Ansätze zum Philosophieren in der Schule dienen als Maßstab, um die Eignung des Sokratischen Gesprächs als Unterrichtsmethode zu bewerten. Seine Kriterien für guten Philosophieunterricht werden mit dem Sokratischen Gespräch verglichen.
Wie unterscheidet sich die Sokratische Methode vom Sokratischen Gespräch?
Die Sokratische Methode ist ein Verfahren zur Erkenntnisgewinnung durch selbstständige Auseinandersetzung mit Problemen im dyadischen Dialog. Das Sokratische Gespräch erweitert dies auf einen polylogischen Dialog, der eine gemeinsam geteilte Erkenntnis anstrebt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sokratische Methode, Sokratisches Gespräch, Philosophieunterricht, Dialogisches Philosophieren, Erkenntnisgewinnung, Didaktik, Ekkehard Martens, Leonard Nelson, Gustav Heckmann, Selbstständiges Denken.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Sokratische Methode, Sokratisches Gespräch, Philosophieren nach Martens) ist im Dokument enthalten.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Das Sokratische Gespräch. Eine geeignete Methode für den Philosophieunterricht?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988809